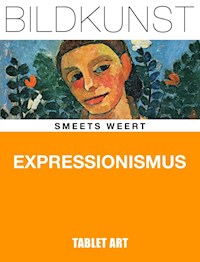
Expressionismus E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Serges Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Vom bildnerischen Engagement zur Kunstwende“ drückt aus, wie die faszinierende Kunstrichtung des Expressionismus in dieser Dokumentation behandelt wird. In etwa 100 farbigen Werk–Beispielen und Kurzbiografien der vorgestellten Maler wie Max Beckmann, Otto Dix Emil Nolde , Paul Klee, Gabriele Münter oder Van Gogh beschreiben die Autoren diesen revolutionierenden Malstil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BILDKUNST
EXPRESSIONISMUS
TABLET ART
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Antiakademische Grundhaltung in Romantik und Expressionismus
Die neue Rolle der Farbe und der symbolistische Themenwechsel
Internationalisierung der Kunstszene als Voraussetzung des Expressionismus
Zentren expressionistischer Bildkunst: „Brücke“ und „Der Blaue Reiter“
Wie lässt sich „Expressionismus“ verstehen?
Grundlagen und Richtungen des neuen Sehens
Verfahren expressionistischer Malerei
Das Umgehen mit den Bildern der Kunstwende
Anmerkungen zum Einführungstext
Nachweis der Zitate im Text zu den Farbtafeln
Literaturhinweise
Kurzbiografien der vorgestellten Maler
Farbtafeln mit Kurzinterpretationen
Impressum
Digitale Kunstbücher, die als E-Books erschienen sind
Bildkunst des 20. Jahrhunderts
Mit 80 Farbtafeln der Maler
Derain
Nolde
Feininger
Ensor
Pechstein
Hofer
Gauguin
Schmidt-Rottluff
Kokoschka
Munch
Campendonk
Kubin
van Dongen
Jawlensky
Meidner
van Gogh
Kandinsky
Modersohn-Becker
Vlaminck
Klee
Rohlfs
Heckel
Macke
Beckmann
Kirchner
Marc
Dix
O. Mueller
Münter
Grosz
„Wir waren Besessene. In Cafés, auf den Straßen und Plätzen, in den Ateliers, Tag und Nacht, waren wir ‚auf dem Marsch‘, setzten uns selbst in rasante Bewegung, um das Unergründliche zu ergründen und um, als Dichter, Maler, Musiker vereint, die ‚Kunst des Jahrhunderts‘ zu schaffen, die unvergleichliche, die alle Künste aller vergangenen Jahrhunderte überragende.“
J. R. Becher
„Es war eine belastete Generation: verlacht, verhöhnt, politisch als entartet ausgestoßen - eine Generation jäh, blitzend, stürzend, von Unfällen und Kriegen betroffen, auf kurzes Leben angelegt.“
G.Benn
Antiakademische Grundhaltung in Romantik und Expressionismus
„Subjektive Kunst“, „bloße Stimmungsmalerei“, „aus der individuellen Einbildungskraft kommende Gestaltung“, „subjektiverregter Ausdruck des Gefühls“. Solche und ähnliche Formulierungen werden heutzutage wenn nicht gleich für die Rede über Kunst im allgemeinen, so doch am ehesten im Hinblick auf die Malerei der Romantik angewendet, auf eine Malerei, wie sie z.B. die große Ausstellung der Werke Caspar David Friedrichs (1774-1840) in Hamburg 1974 so unerwartet publikumswirksam zeigte. Doch die unserer tradierten Bildungssprache angehörenden Wörter „Subjektivität“, „Gefühl“, „Individualität“, „Empfindung“ usw. sind kaum mehr als Schlagwörter, wenn sie - vielleicht mit geringen Abweichungen - auch zur Charakterisierung der programmatischen Kunstbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts, des Expressionismus, herangezogen werden.
Im Hinblick auf das Engagement der Künstler lassen sich zwischen Romantik und Expressionismus einige auffällige Parallelen feststellen. Beiden Stilhaltungen war der Wille nach künstlerischer wie gesellschaftlicher Erneuerung des Lebens eigentümlich. Die romantischen Künstler richteten sich gegen die leere Routine der - so Philipp Otto Runge (1777-1810) - akademischen „Gettos“, gegen die Kunstschulen als „Siechenanstalten“ - dies eine Schillersche Formulierung. C. D. Friedrich vertrat die Ansicht, die Kunstakademien machten den bildenden Künstler zur „Maschine“.
Was trägt dieser Antiakademismus aus? Welche Folgen hat er für die künstlerische Tätigkeit als einer bildnerischen Praxis?
Wurde im 16. Jahrhundert etwa das Genie von den Akademien gemacht und getragen, so wird das romantische Genie gerade unter den Akademiegegnern geboren. Dieses ‚Originalgenie‘, wie es Wilhelm Heinse in seinem Künstlerroman - übrigens dem ersten seiner Art - „Ardinghello oder die glückseligen Inseln“ (1787) entworfen hat, lehnt sich gegen die öffentliche Institution Kunstschule ebenso auf wie gegen das vor allem an akademische Kunst gewöhnte Publikum. So möchte der romantische Künstler denn auch kein Regeldiktat mehr dulden in der festen Absicht, seiner eigenen künstlerischen Einbildungskraft zum Durchbruch zu verhelfen. Mit der Rede von der Subjektivität ist dann zunächst soviel gesagt: Der einzelne Künstler erkennt den akademisch geltenden Regelkanon nicht mehr an. Statt dessen unternimmt er den Versuch, nach anderen, von Institutionen noch nicht vereinnahmten und verwalteten, also vor allem nach selbstgefundenen Regeln zu arbeiten. Diese Regeln betreffen sowohl die künstlerischen Mittel, die malerischen Verfahren wie auch die Bildthemen. Zum akademisehen Kanon traditioneller Malerei etwa gehörte es, dass das Bild aus geometrischen Grundfiguren, z. B. Kreisen, Ellipsen, Dreiecken usw. aufzubauen sei. Akademisch geprägte Norm war es auch, Bildthemen vornehmlich der griechischen Mythologie und der christlichen Überlieferung zu entnehmen.
Für den antiakademisch eingestellten Maler der Romantik gibt es keine Beschränkung der Bildthemen mehr; er gehorcht auch insofern keiner fremden Norm, als er sich an vorgegebene Sehweisen von Gegenständen der sichtbaren Welt nicht mehr gebunden fühlt. Er etabliert andere, seine eigenen und in diesem Sinne individuellen Verfahren, organisiert das Bild auf seine Weise und entwirft eine eigene Bild-Sprache, die ihrerseits natürlich wieder normenbildenden Anspruch erhebt, wie man es z.B. am Werk Runges eindrücklich belegen kann. Die so verstandenen subjektiven künstlerischen Handlungsweisen bewirken, dass das Verhältnis des Künstlers zu den dargestellten Gegenständen eigens betont wird. Er geht nämlich aus von den Erfahrungsmustern, die er bei seinem individuellen Umgang mit der Welt entwickelt hat.
Die radikal aufgelösten Bindungen an die Kunstschulen werden durch stärkere Bindungen der Künstler untereinander ersetzt. Hier haben die Künstlerfreundschaften und die Gründung von Künstlervereinigungen in der Romantik ihren Ursprung. Diese Verbindungen, die den ganzen Menschen mit seinem Glauben und seiner Weltanschauung einschließen, bilden das Pendant zur Institution Akademie und sind gleichzeitig gegen die herrschende gesellschaftliche Praxis gerichtet, so dass man neben der gemeinschaftlichen künstlerischen Praxis eine dieser Tätigkeit angepasste neue Lebensform, z.B. religiös-asketischer Art, zu verwirklichen trachtet.
Die für die Kunst des beginnenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts typisch gewordene antiakademische Haltung der Künstler ist weiter gekennzeichnet durch das stetige Anwachsen künstlerischer Selbstkommentare, der sogenannten Künstler- oder Atelierreflexionen. Bislang waren die Akademien für die Vermittlung des geistig-philosophischen Rahmens künstlerischer Tätigkeit zuständig, in welchem sich die Kunstschüler wie selbstverständlich bewegten. Jetzt begann der an diese Normen nicht mehr gebundene Künstler konsequenterweise aus dem Zusammenhang seiner eigenen bildnerischen Praxis nach und nach selbst neue Normen aufzustellen und zu reflektieren. Hier liegt der besondere Bezug zur Praxis, der diese gedanklichen Bemühungen auszeichnet.
Diese zunächst einmal aus eigener bildnerischer Praxis gewonnenen Erfahrungen, Basis für die Kennerschaft auf dem Gebiete vergangener und gegenwärtiger Kunst, sind weder ein Ersatz für Ästhetik noch eine besondere Art von Rezepten oder Gebrauchsanweisungen; es handelt sich vielmehr im wesentlichen um Überlegungen, die die Herstellung künstlerischer Gegenstände betreffen, also die visuellen Problemstellungen des künstlerischen Handelns und seine besonderen Produktionsabsichten. Daher sind solche Überlegungen durchaus geeignet, darüber Auskunft zu geben, worauf es beim betrachtenden Verstehen dieser Werke ankommen soll. D. h., Atelierreflexionen geben oft unersetzliche Leithilfen, um die jeweils spezielle Kommunikationsabsicht der Bildwerke eines Künstlers ausmachen zu können, so dass sich für den Betrachter ihr Erkenntniswert auf diese Weise erschließen lässt.
Für das ausgehende 19. und das beginnende 20. Jahrhundert ist Antiakademismus das Stichwort, das die internationale Kunstszene beherrscht: Der Auszug der Einwohner des alten Rom, mit dem es ihnen gelang, ihre Rechte durchzusetzen, mag als „secessio plebis“ Vorbild für die Künstler um die Jahrhundertwende gewesen sein. Unter Protest zogen sie, wie in der Romantik 1809 die Lukasbrüder (Johann Friedrich Overbeck [1779-1869] und Franz Pforr [1788-1812] als Gründer des Lukasbundes) in Wien, aus den Kunstschulen und veralteten Künstlerbünden aus, gründeten ihrerseits offene Künstlervereinigungen mit neuen Zielen, die zum Fluktuieren über die einzelnen Gruppen hinweg und zu internationalem Austausch künstlerischer Konzepte führten. 1892 wurde z. B. die Münchener Sezession gegründet, 1897 die Wiener Sezession, 1898 die Berliner Sezession. Ihre Ausstellungen waren Dokumentationen eines neuen künstlerischen Weltbildes. Kunstfeindliche Naturkopie und Gründerzeitakademismus haben restlos abgewirtschaftet. Man macht Front gegen die verlogene Repräsentationskunst der Wilhelminischen Zeit, schätzt den unmittelbaren Umgang mit Farbe und Licht der Impressionisten, möchte aber der dem Impressionismus innewohnenden Gefahr der Veräußerlichung durch bloße Eindrucksabhängigkeit entgehen.
Die um Fragen der Herstellung und Wirkung von Bildern bemühten Künstler, die sich gleichzeitig über ihre Aufgaben in der Gesellschaft Klarheit verschaffen wollen, geben wie die expressionistische Künstlergruppe „Brücke“ in Dresden nicht nur kurzlebige Manifeste und Programme heraus. Der Russe Wassily Kandinsky, Mitbegründer der zweiten expressionistischen Gruppe in Deutschland, „Der Blaue Reiter“ in München, diskutiert die visuellen bildnerischen Probleme, von der Handhabung der einfachsten künstlerischen Mittel angefangen: die Kunstlehre des 20. Jahrhunderts wird entscheidend mitgeprägt von seinem Traktat „Punkt und Linie zur Fläche“ von 1926. Er legt zum ersten Mal den Entwurf einer von gegenständlichen Sehweisen freien Syntax visueller Zeichen vor.
Gab es in der Romantik keine Beschränkung der Bildthemen mehr, so kommt Kandinsky 1910 zur Gestaltung eines in der freien Kunst bislang nicht ernsthaft in Erwägung gezogenen Themengebietes: Statt Häuser, Bäume, Tiere, Menschen zu malen, unternimmt er es, einfach Linien zu bündeln, farbige Formen miteinander auf der Fläche in Beziehung zu setzen, mit künstlerischen Mitteln zu ‚improvisieren‘. Kurzum: er malt, ungegenständliche', ‚abstrakte‘ bzw. ‚konkrete' Bilder. Von ungegenständlicher Malerei lässt sich insofern sprechen, als keine vorgegebenen Gegenstände der sichtbaren Welt (natürliche, kulturelle, gesellschaftliche) dargestellt werden. Das Wort „abstrakt“ wird im Hinblick auf Malerei so verwendet, dass diese Malerei von der sichtbaren Welt abzusehen versucht. Dagegen betont die Verwendung des Wortes „konkret“ für solche Malerei den Sachverhalt, dass hier vom Künstler durch und bloß mit den Mitteln der Malerei aus sich und in sich selbst existierende Gebilde verwirklicht werden, die ihren eigenen Zusammenhang konkretisieren.
Schon in der Frühromantik hatten Kritiker, J. W. von Goethe zum Beispiel, bemerkt, dass einige der Bilder der romantischen Künstler ein so unwesentliches Verhältnis zum Gegenstand der sichtbaren Welt zeigten, dass sie ohne weiteres auch „auf dem Kopfe gesehen werden“ könnten.
Die neue Rolle der Farbe und der symbolistische Themenwechsel
Der Gebrauch von Wörtern, mit denen die verschiedenen Richtungen, Stile, Stillagen, bestimmte Eigentümlichkeiten künstlerischer Hervorbringungen unterschieden und charakterisiert werden sollen, hat Kritikern wie Kunsthistorikern immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Dies nicht zuletzt deshalb, weil solche Unterscheidungen und Charakterisierungen, insbesondere, was die Moderne betrifft, oftmals von Betrachtern eingeführt wurden, die - obwohl erst wenige Beispiele vor Augen - möglichst gleich dem von ihnen beobachteten Neuen einen Namen gaben, etwa wie ein Junge wegen eines bestimmten äußeren Merkmals (etwa Rothaarigkeit), typischer Verhaltens- oder Handlungsweisen einen Spitznamen bekommt, der sich dann sogar gegen seinen Taufnamen mehr und mehr durchsetzen kann. Bekanntes Beispiel: Kritiker, angeregt durch das 1874 in Paris ausgestellte Werk von Claude Monet (1840-1926) „Impression. Soleil levant“ begannen, das Neue dieser Art Malerei mit „Impressionismus“ zu kennzeichnen. So handelt es sich denn auch bei den vielen Ismen der Moderne, „Fauvismus“„,Expressionismus“„,Futurismus“„,Kubismus“ usw. nicht selten um vergleichsweise spontane, zufällige Charakterisierungen, die sich dann (wie bei einem Spitznamen) späterhin als Name für bestimmte Stillagen einbürgerten.
Dies trifft in besonderem Maße für das zu, was wir in der Kunst des beginnenden 20. Jahrhunderts uns angewöhnt haben, „Expressionismus“ zu nennen. Wie ungenau dieser Kennzeichnungsversuch historisch war, lässt sich belegen: Im Katalog zur Ausstellung des Salon des Indépendants 1901 in Paris, an der u.a. Albert Marquet (1875-1947) und Henri Matisse (1869-1954) teilnahmen, war hinsichtlich einiger naturalistischer Studien von J. A. Hervé von „expressionisme“ die Rede. Zur Kennzeichnung einer bestimmten Auffassung der Malerei fand dieses Wort in Frankreich aber keine Verbreitung. Erst durch die 22. Berliner Sezessionsausstellung von 1911 unter ihrem neuen Vorsitzenden Lovis Corinth (1858-1925), der Max Liebermann (1847-1935) abgelöst hatte, bei der Arbeiten von Georges Braque (1882-1963), André Derain, Emile Othon Friesz (1879-1940), Pablo Picasso (1881-1974), Raoul Dufy (1877-1953) und Albert Marquet unter dem Namen „Expressionisten“ gezeigt wurden, kam „Expressionismus“ als Stilname schnell in Gebrauch, auch und vor allen Dingen jetzt für junge deutsche Künstler, so dass z. B. Kunsthistoriker wie Wilhelm Worringer in unmittelbarem Anschluss dieses Wort in eben diesem Sinne verwendeten. Weiter lässt sich historisch festmachen, dass bildende Künstler aufgrund ihrer Werke diesen Namen erhielten, sich selber aber kaum so nannten. Später erst wurde „Expressionismus“ in Bezug auf Dichtung gebraucht. Die klassische Anthologie des Expressionismus gab Ende 1919 Kurt Pinthus unter dem Titel „Menschheitsdämmerung - Symphonie jüngster Dichtung“ heraus1.
Wie sich am Aufkommen des Wortes „Expressionismus“ verdeutlichen lässt, wurde hier zunächst auf breiter Front das charakterisiert, was sich innerhalb der europäischen Avantgarde nicht mehr unter „Impressionismus“ zusammenfassen ließ. Auch nach der sehr kurzen Zeit deutscher Malerei dieses Stils- bereits 1925 erschienen Publikationen wie „Nachexpressionismus“, und 1927 „Die Überwindung des Expressionismus“2- blieb für sie „Expressionismus“ reserviert. Ihm läuft in Frankreich im wesentlichen der Kubismus und in Italien der Futurismus parallel. Auf die Vorläuferschaft des französischen Fauvismus für den Expressionismus wollen wir zuerst eingehen.
Seit ihrer gemeinsamen Ausstellung im Salon d'Automne 1905 wurde für einen lockeren Kreis junger Künstler, der sich in den Jahren 1898-1905 in Paris um Matisse gesammelt hatte, das französische Wort „fauves“ („Wilde“) als eine Art Spitzname gebraucht, der schnelle Verbreitung fand. Für diese Künstler, zu denen außer Matisse u. a. die Maler Derain (→ Bild 1, → Bild 2), Maurice Vlaminck (→ Bild 16, → Bild 17), Kees van Dongen (→ Bild 11, → Bild 12) gehörten, die heute vielfach auch Vorexpressionisten genannt werden, war kein ausgearbeitetes Programm verpflichtend; sie wurden eher durch die Schwierigkeiten zusammengehalten, die sie bis zu ihren Erfolgsjahren 1905 bis 1907 hatten, ihr bildnerisches Konzept beim Publikum durchzusetzen.
Die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigte in ihren verschiedenen künstlerischen Ausprägungen die optische Problemstellung, Licht, Lichtwirkungen und Atmosphäre, die die Gegenstände ‚zusammenhält‘, malerisch darzustellen. Über die Stationen der Pleinairmaierei (Freilichtmalerei, z. B. Johann Jongkind [1819-1891]), des farbtheoretisch motivierten Impressionismus, den die Farben komma- und tupfenartig auftragenden Virgulismus und den Neoimpressionismus bzw. Divisionismus, der die Farben des Spektrums Punkt für Punkt zu flächigen Bildgegenständen zusammensetzt, findet dieses Problem seinen Abschluss in den Bemühungen der Fauves, bei der Konzentration auf die Farbe deren Ausdruckswert dadurch zu steigern, dass sie diese von ihrer traditionellen Aufgabe, bloß Lokal- bzw. Gegenstandsfarbe zu sein, zu befreien sucht, so dass ihr Ziel, wie einer ihrer Vertreter, Emile Othon Friesz, formuliert hat, die „reine Farbigkeit“ ist und ihr „Ausgangspunkt (…) die Empfindung angesichts der Natur“. Die Befreiung der Farbe aus ihrer ‚dienenden‘ Funktion lässt sie nach und nach zu einem selbständigen Bauelement des Bildzusammenhangs werden, so etwa in „Küstenlandschaft“ von Derain (→ Bild 2) oder in Vlamincks „Segelboot“ (→ Bild 16).
Bei dem Versuch, die Farben innerhalb des Bildes als selbständiges Element zu behandeln, sah sich der Künstler der Tatsache gegenüber, dass Farben, die die Gegenstände innerhalb der bildnerischen Darstellung nicht mehr nur bunt machen sollen, immer noch - um überhaupt als Farbe im Bild erscheinen zu können - kleinere oder größere Teilflächen für sich beanspruchen, also immer als Farbformen auftreten. Insofern auch noch Darstellung von Dingen (Berge, Bäume usw.) beabsichtigt ist, geraten Farbformen und Dingformen in Widerstreit, wobei dann selbständige Farbformen allmählich die Dingformen zu überlappen, zu überlagern und zu verdrängen beginnen.
Den Fauves waren dabei insbesondere gerade die späten Arbeiten von Vincent van Gogh (→ Bild 13, → Bild 14,15) mit ihrer jeweils in der Farbigkeit wechselnden, ihrem auf Farbabstufungen und Übergänge verzichtenden teigig-pastosen Pinselstrich ebenso Anregung wie die mit Neigung zum Dekorativen großflächig nebeneinandergestellten Farbformen in Paul Gauguins Bildern (→ Bild 5, → Bild 6).
Schon bei Gauguin und der Gruppe der Nabis (hebräisch: Propheten), die sich im Anschluss an Treffen Gauguins mit Paul Sérusier (1863-1927) im Jahre 1888 bildete - außer diesen gehörten zu ihr u.a. Pierre Bonnard (1867-1946), Felix Valloton (1865-1925), Edouard Vuillard (1868-1940) und Maurice Denis (1870-1943) als deren Theoretiker-, führte dies zu Farbformen als Flächenformen, die die zu unterscheidenden Bildgegenstände übergreifen, so dass es neben der gegenständlichen Komposition zu von Gegenständen unabhängigen Formen kommt, die dann immer mehr das Hauptgewicht für diese Malerei erhalten. Zur Folge hat das den Verzicht auf zentralperspektivische Konventionen, die Aufhebung der Farbperspektive (reine, warme Farben treten auch in Mittel- und Hintergrund des Bildes auf) und damit die Betonung der Flächigkeit und Zweidimensionalität des Bildgevierts.
Unterstützt wird das malerische Verfahren z. B. durch Hochlegen oder gezieltes Überspielen des Horizonts (→ Bild 1, → Bild 6). Diese Organisation der Bilder verwirklicht zum ersten Mal die Kommunikationsabsicht, dass es anstatt etwa um einen roten Rock oder um rote Dachziegel oder um das Flimmern der Luft darum geht, dem Betrachter einen, Fall von Rot' bzw. Charakteristika von Rot vor Augen zu führen, um ihn aufzufordern, mit der Farbe Rot unmittelbar umzugehen. Dies gelingt in dem Maße, wie der gegenständliche Ausschnitt der sichtbaren Welt als Motiv für das Bild, als Bildmotiv, bildnerisch nur insoweit in Anspruch genommen wird, als er für den Aufbau und das Zusammenspiel der Farbformen erforderlich ist und z.B. die optische Festigung der Bildränder übernehmen kann. Die Anwendung überkommener zeichnerisch-graphischer Konventionen der gegenständlichen Darstellung, die das lineare Gerüst der Bilder garantiert, bleibt dabei weitgehend erhalten.
Der Thematisierung der Farbe geht ein Wechsel in der Darstellung dessen parallel, was man für darstellungswürdig und darstellenswert erachtet. Statt die Gegenstände der sichtbaren Welt, wie sie den Menschen umgeben, zum Thema zu nehmen, werden natürliche Prozesse, Zustände und elementare menschliche Verhaltensweisen bevorzugt. Bei dieser Thematik kommt es, insofern es sich hier um nicht mehr eindeutig fassbare visuelle Gegenstände handelt, aufgrund dieses Themenwechsels ebenfalls zum Abrücken von den Konventionen der Darstellung des Gegenständlichen, wie sie uns durch unseren alltäglichen Umgang mit der sichtbaren Welt geläufig und durch die abendländische Tradition der Malerei vertraut sind. Zwei Beispiele:
Der 1860 in Ostende geborene James Ensor - er starb dort 1949, ohne seine Vaterstadt bis auf einen kurzen Aufenthalt in Brüssel je verlassen zu haben -, der von der Lichtmalerei des Engländers William Turner (1775-1851) beeinflusst war, hat davon gesprochen, er habe als einer der ersten die „Befreiung der Vision“ ermöglicht. Seine Maskendarstellungen entspringen eindeutig bildorganisierenden Absichten. Sie erlauben ihm, von der akademischen Norm der Darstellung von Gegenständen der sichtbaren Welt abzuweichen und eigene Bildgegenständlichkeiten zu entwerfen. Anlässlich der Ausstellung seiner Werkeim Jeu de Paume, Paris, im Juni 1932 erläutert der Maler: „Die Maske bedeutet mir Frische des Tons, überspitzten Ausdruck, prächtigen Dekor, große, unvermutete Gesten, ungehemmte Bewegungen, erlesene Turbulenz…“3 Den ausdrucksstarken Charakter dieser Bilder hinsichtlich des Themas Mensch erreicht Ensor nicht auf direktem Wege, sondern er entwirft Masken und Larven als Bildzusammenhang, mit dem die Emotionalität des Betrachters als Abwehr, Ablehnung, Angst usw. erregt werden soll.
Der vor allem die graphischen Techniken revolutionierende Norweger Edvard Munch, der 1889 auch in Paris arbeitete, lernte dort insbesondere Bilder von van Gogh und Gauguin kennen. 1892 erregte er mit einer Ausstellung seiner frühen Hauptwerke in Berlin einen Skandal. Dies war der Anlass, dass sich die jungen Maler vom Verein der Berliner Künstler, der für die Ausstellung verantwortlich zeichnete,





























