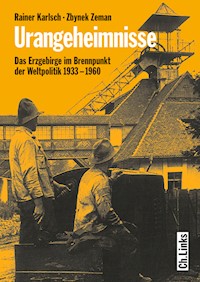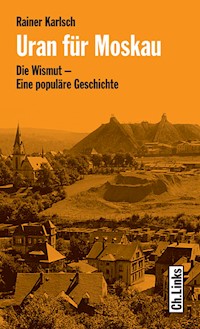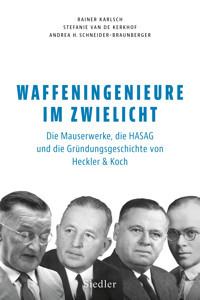Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die populärwissenschaftliche Darstellung zeigt erstmals die Auswirkungen der Verdrängungs- und Enteignungspolitik der sowjetischen Besatzungsmacht und des SED-Regimes für die Familienunternehmenslandschaft in Ostdeutschland bis heute auf. Die staatsdirigistischen Eingriffe führten zum einen zur Abwanderung von Betrieben in den Westen. Zum anderen zeigten sich nun erst recht Resilienz, Einfallsreichtum und Beharrlichkeit der verbleibenden Familienunternehmer*innen. Nach der friedlichen Revolution machten sich viele Unternehmer*innen aus Ost und West auf, die Familientraditionen wiederzubeleben. Auf den harten Strukturbruch in den 1990er Jahren folgte eine partielle Reindustrialisierung. Heute sind 92 Prozent der ostdeutschen Betriebe Familienunternehmen. Der Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch arbeitet in dem reich bebilderten, von der Stiftung Familienunternehmen herausgegebenen Buch zahlreiche individuelle Geschichten durch unterschiedlichste Branchen auf: Viele davon sind Erfolgsgeschichten trotz widrigster Umstände.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Umschlagfotos: historische und aktuelle Werbung ostdeutscher Familienunternehmen; Bildvorlagen: Cover, oben v. l.: Alfred Weigel Federnfabrik GmbH & Co. KG, Komet Gerolf Pöhle & Co. GmbH, Mühle-Glashütte GmbH nautische Instrumente und Feinmechanik, Kosmetische Fabrik Wolfgang Haschke, Mitte: TILLIG Modellbahnen GmbH, unten v. l.: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (Public Domain), KATHI Rainer Thiele GmbH, MAWA Kosmetik GmbH/Foto: Europäisches Flakonglasmuseum, Archiv Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH; hinterer Umschlag, v. l.: N. L. Chrestensen Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH, ORAFOL Europe GmbH, APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Wendt & Kühn KG
Redaktionsschluss: Januar 2023
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages und der Stiftung Familienunternehmen unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage
© 2023 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-842-5
Inhalt
Prolog
I. Enteignungen in der Sowjetischen Besatzungszone 1945–1949
1. Besatzungssystem, Demontagen und Sowjetische Aktiengesellschaften
2. Die erste große Enteignungswelle
3. Massenhafte Firmenabwanderungen
4. Währungsreform, Schauprozesse und „kalte“ Enteignungen
II. Wirtschaftskrieg gegen die Privatindustrie 1950–1955
1. Planwirtschaft nach sowjetischem Muster
2. Widerstand gegen die Benachteiligung von privaten Betrieben
3. Die zweite Enteignungswelle
4. Die Aktion „Rose“
5. Ausländische Familienunternehmen „in Verwaltung“
III. Zwischenspiel: Betriebe mit staatlicher Beteiligung 1956–1971
1. Betriebe mit staatlicher Beteiligung
2. Eine mittelstandsfreundliche Reformära?
3. Innovative Familienunternehmen
IV. Das „Aus“ für den Mittelstand und seine Folgen 1972–1990
1. Aktion „Zitrone“
2. Finaler Schlag gegen den Mittelstand
3. Verlusterfahrungen und langfristige Folgen
4. Die durchgängige Kombinatsbildung
5. Die friedliche Revolution
6. Zwischenresümee: Vom „Klassenfeind“ zum „Bündnispartner“?
V. Schwieriger Neustart 1990–2000
1. „Schocktherapie“ und Transformationskrise
2. Die Mittelstandspolitik der Treuhand
3. Reprivatisierung ostdeutscher Traditionsunternehmen
4. Umkämpftes Eigentum
5. Management-Buy-out/Management-Buy-in
VI. Familienunternehmen als Rückgrat der Wirtschaft 2001–2022
1. Rückkehrer
2. Firmensitzverlegungen und neue Eigentümer
3. Neugründungen
4. Internationale Familienunternehmen
5. Autobahnökonomie und familiengeführte Agrarbetriebe
6. Neue Champions im Osten
7. Resümee
Anmerkungen
Quellen, Literatur und Medien
Bildnachweis
Über den Herausgeber: Die Stiftung Familienunternehmen
Prolog
Die Geschichte von Familienunternehmen ist aus mehreren Gründen faszinierend. Oft handelt es sich um Firmen, die bereits seit langer Zeit existieren und das Auf und Ab der Zeitläufe in einem Mikrokosmos widerspiegeln. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt, kann man viel über interessante Persönlichkeiten, Produkte, Innovationen, Märkte, die Wechselfälle des Lebens und vor allem auch über die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen agieren mussten, erfahren.
Als eines der hervorstechendsten Merkmale von Familienunternehmen gilt gemeinhin ihr auf langfristige Ziele ausgerichtetes Wirtschaften. Nicht die Quartals- oder Jahresbilanzen, wie bei anonymen Publikumsgesellschaften, deren Aktien sich in Streubesitz befinden, stellen den entscheidenden Maßstab für ihren Erfolg dar, sondern der generationenübergreifende Erhalt und die selbstbestimmte Weiterentwicklung des Unternehmens.
Sucht man nach dem Erfolgsgeheimnis der deutschen Wirtschaft, ihrer bis heute trotz aller Probleme hohen Innovationskraft, dann landet man rasch beim Mittelstand. Es sind die vielen kleineren und mittelgroßen Firmen, die in den jeweiligen Branchen Außergewöhnliches leisten und nicht selten mit ihren Produkten zu den Hidden Champions gehören. Darunter versteht man weniger bekannte Firmen, die in ihrer Branche in der Welt in der Ersten Liga spielen beziehungsweise die nationale Nummer eins sind. Diese Firmen sind meist inhabergeführt und bedienen oft Nischenmärkte.1 Der Begriff „Hidden Champion“ wurde zwar erst 1990 in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt, lässt sich aber auch auf die Unternehmensgeschichte des 19. Jahrhunderts anwenden.
Im vorliegenden Buch geht es nicht vorrangig um heimliche Weltmarktführer, sondern um die Geschichten von Familienunternehmen in Ostdeutschland von 1945 bis heute allgemein. Im Mittelpunkt stehen dabei Familienunternehmen des produzierenden Gewerbes aus den verschiedensten Branchen. Nur punktuell werden auch Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen in den Blick genommen.
Nicht wenige der in diesem Buch vorgestellten industriellen Familienunternehmen sind bereits im 19. Jahrhundert oder noch früher gegründet worden. Einigen von ihnen gelang der Aufstieg zum Hidden Champion. Um besser zu verstehen, welch vielfältige und innovative Gewerbelandschaften in dieser Zeit in „Ostdeutschland“ existierten, werden im Folgenden, stellvertretend für viele andere, Gründergeschichten von herausragenden Familienunternehmen unseres Untersuchungsgebietes kurz vorgestellt. Viele „verschwanden“ nach dem Zweiten Weltkrieg aus noch zu erläuternden Gründen ganz oder verlegten ihre Unternehmenssitze nach Westdeutschland.
Das heutige „Ostdeutschland“ – ein ahistorischer Begriff, der sich nach 1990 in der Umgangssprache durchgesetzt hat und daher trotz Bedenken auch in diesem Buch verwendet wird – und die wiedervereinigte Hauptstadt Berlin stellten sich vor 1945 administrativ wie wirtschaftlich als heterogener und vielgestaltiger Raum dar. Dieser umfasste zum einen die Länder Sachsen und Thüringen (mit jeweils etwas kleinerem Territorium als die heutigen Länder), Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz sowie Anhalt. Zum anderen bestand Ostdeutschland, das damals in der Mitte Deutschlands verortet war, aus den preußischen Provinzen Brandenburg und Sachsen sowie aus Teilen Schlesiens und Pommerns und einigen Einsprengseln des Landes Braunschweig. Ein ähnlich vielgestaltiges Bild bot die Wirtschaftsstruktur unseres Untersuchungsgebietes.
Berlin entwickelte sich nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 zur kontinentaleuropäischen Industriemetropole. Träger dieser Entwicklung waren der Maschinenbau und die Elektroindustrie. Mit Bewunderung sprachen Zeitgenossen von der „Elektropolis“, mit Unternehmen wie AEG, Siemens, Telefunken und Lorenz. In der deutschen Hauptstadt gab es die größte Ansammlung von Unternehmen der Elektroindustrie weltweit.2 Die herausragende politische Bedeutung der Stadt trug dazu bei, dass sich die Ost-West- und Nord-Süd-Trassen der Eisenbahn hier kreuzten. Am augenfälligsten schlug sich diese Konstellation in der Ansiedlung zahlreicher Fabrikunternehmen nieder, die Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen und Materialien für den Bedarf der Eisenbahnen produzierten.3 Zu den Pionieren des deutschen Lokomotivbaus zählte August Borsig.4 Auch Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der Druck- und Papierverarbeitung, der chemischen Industrie und der feinmechanisch-optischen Industrie waren in Berlin stark vertreten und hatten jeweils zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit dem Aufkommen von Kino und Rundfunk wurde die Hauptstadt auch zur Medienstadt. All dies wurde flankiert vom Aufstieg Berlins zum führenden Banken- und Börsenplatz in Deutschland.5
Bedeutende urbane und gewerbliche Kraftzentren gab es mit Chemnitz, Leipzig und Dresden in Sachsen und ausgedehnte industriell-gewerbliche Ballungsräume im sächsischthüringischen Raum und im südlichen Sachsen-Anhalt. Andererseits bestand ein großes Nord-Süd-Gefälle. Weithin ländlich geprägt blieben große Teile der preußischen Provinz Brandenburg, der nördliche Teil der preußischen Provinz Sachsen (heute Sachsen-Anhalt) sowie Mecklenburg und Vorpommern.
Nimmt man alte Reichsstatistiken über den Anteil der Beschäftigten an der Industrie in ausgewählten Regionen zur Hand, dann wird man feststellen können, dass die Industriequote in Sachsen, Thüringen und Anhalt weit über dem Reichsdurchschnitt lag.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs gehörte das Königreich Sachsen zu den wirtschaftlich fortgeschrittensten Regionen Europas. Dies messen Wirtschaftshistoriker vor allem an der Entwicklung der Beschäftigten in den drei Hauptsektoren der Wirtschaft: Landwirtschaft (primär), Industrie (sekundär) und Dienstleistungswesen (tertiär). Diesbezüglich hatte die sächsische Gesellschaft einen stürmischen Wandel von der Agrarzur Industriegesellschaft erlebt. Um 1910 waren bereits rund 60 Prozent aller Beschäftigten in der Industrie, im Bergbau und dem Handwerk tätig, wohingegen der Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen nur noch bei knapp über 10 Prozent lag.6
Insgesamt wurde die sächsische Industrielandschaft von arbeitsintensiven, teilweise hochspezialisierten familiengeführten Klein- und Mittelbetrieben geprägt.7 Ein Zeitgenosse verwies stolz darauf, „dass man in Sachsen neben Spezialitäten, die sonst nur an ganz wenigen Plätzen der Welt noch zu haben sind, mit wenigen Ausnahmen alles herstellt oder herstellen kann, was auf gewerblich-industriellem Gebiet überhaupt erzeugt wird“.8 Zu danken war diese Entwicklung vielen tausend Familienunternehmen, von denen einige mit ihren Produkten Weltgeltung erlangt hatten. Der Historiker Rudolf Forberger bezeichnet Sachsen daher als „Pionierland der industriellen Revolution in Deutschland“.9
Im Erzgebirge entwickelte sich seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert ein vielseitiges Heimgewerbe. In Bergstädten wie Annaberg, Marienberg oder Schneeberg wurden geklöppelte Spitzen und Kleiderbesätze (Posamenten), ebenso Alltagsgegenstände aus Metall und Holz gefertigt. Einige Orte spezialisierten sich auf die Herstellung von Holzspielzeug. Im angrenzenden Vogtland produzierte man Musikinstrumente aus Holz und Blech.10 Zum Teil wurden diese Waren bis in die DDR-Zeit hinein in Heim- und Handarbeit hergestellt. Vor allem in den metallverarbeitenden Branchen fanden sich aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Unternehmer, die dazu übergingen, bisher heimgewerblich hergestellte Gebrauchsgegenstände fabrikmäßig zu produzieren. Ein Paradebeispiel dafür war das von Karl August Wellner 1860 in Aue gegründete Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Bestecken spezialisierte. Die Firma stieg zu einem der führenden deutschen Produzenten von Besteckwaren auf.11 Eine ähnliche Erfolgsgeschichte fand in der Blechwarenfabrik von Karl Louis Krauß im benachbarten Schwarzenberg statt.12 Mit der Produktion von Trommelwaschmaschinen trug seine Firma zur technischen Ausstattung von zahlreichen Haushalten bei. Die Kraußwerke wurden 1946 verstaatlich und bildeten den Nukleus für den VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg, den größten Hersteller von Waschmaschinen in der DDR.
In enger Verbundenheit mit der Blechwarenindustrie entwickelte sich ein Maschinenbau, der auf die Konstruktion und Herstellung von Werkzeugen und Maschinen zur Blechbearbeitung spezialisiert war. Der Pionier dieser Branche war Erdmann Kircheis. Sein 1861 in Aue gegründetes Maschinenbauunternehmen beschäftigte vor dem Ersten Weltkrieg bereits mehr als 1.000 Arbeiter und Angestellte.13 Auch Kircheis’ Unternehmen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet.
Noch bedeutsamer für die industrielle Entwicklung Sachsens waren die zahlreichen Textilgewerbe, die ebenfalls auf jahrhundertelange vorindustrielle Traditionen zurückblicken konnten. Die ersten beiden sächsischen Baumwollmaschinenspinnereien gingen schon im Jahr 1800 in Betrieb, und in den nächsten Jahren schossen solche „Spinnmühlen“ in Chemnitz und seiner weiteren Umgebung wie Pilze aus der Erde. Einige dieser frühen Fabrikunternehmen befanden sich auch noch hundert Jahre später im Besitz der Gründerfamilie.14 Eine ganze Reihe namhafter Familienunternehmen brachte die sächsische Wirkwarenindustrie – Strümpfe, Handschuhe, Trikotagen – hervor. Die Ansiedlung dieses Gewerbes ging auf die Initiative eines einzelnen Mannes zurück: Johann Georg Esche. Ihm gelang der Nachbau eines französischen Strumpfwirkerstuhls. Binnen weniger Jahrzehnte verbreitete sich die Strumpfwirkerei im weiteren Umkreis der Stadt Chemnitz.15
Die industrielle Transformation der Textilgewerbe des Vogtlandes, des Erzgebirgsvorlandes und der Oberlausitz stand in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung einer bedeutsamen Maschinenbauindustrie. Vor allem in Chemnitz, dem „sächsischen Manchester“, entstanden zahlreiche Werkstätten, die die Wartung und Reparatur der Spinnmaschinen englischer Bauart übernahmen und sich auch bald an deren Nachbau versuchten.
Als zweiter bedeutender Zweig des Maschinenbaus entwickelte sich in Chemnitz der Werkzeugmaschinenbau. Zu den Gründerpersönlichkeiten gehörte Julius Eduard Reinecker. Er hatte als Handwerksgeselle in den Chemnitzer Maschinenfabriken Arbeit gefunden, bevor er sich 1859 mit einer kleinen Werkstatt selbstständig machte. Nach und nach baute er seinen Betrieb zu einem Fabrikunternehmen aus, das sich auf die Produktion von Fräs- und Schleifmaschinen spezialisierte. Nach Reineckers Tod 1894 führten seine drei Söhne das Unternehmen weiter. 1911, als die Firma J. E. Reinecker rund 2.000 Arbeiter in ihren Fabrikhallen beschäftigte, folgte der Übergang zur Kapitalgesellschaft, wobei aber sorgsam darauf geachtet wurde, dass die Aktienmehrheit auch in den folgenden Jahrzehnten im Besitz der Gründerfamilie verblieb.16 Wir werden später darauf zurückkommen, dass die Firma Reinecker durch die Demontagen und Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg einen tiefen Einschnitt erlebte. Der Maschinenbau in Sachsen verlor dadurch sein bekanntestes Familienunternehmen.
Zu dem Zeitpunkt, an dem die Reinecker-Söhne ihr Familienunternehmen in eine AG umwandelten, hatte sich in der Region bereits eine weitere zukunftsträchtige Branche des Maschinenbaus angesiedelt. Der Konstrukteur August Horch hatte in Zwickau im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gleich zwei Automarken mit klangvollen Namen begründet: Horch und Audi.
Automobile gehörten bald auch zum Produktionsprogramm der Chemnitzer Wanderer-Werke, und im nahen Zschopau wurden seit den 1920er Jahren Motorräder und Kleinwagen der Marke DKW hergestellt. Keine dieser Firmen, die schließlich allesamt 1932 zur Auto-Union fusionierten, entwickelte sich allerdings über die Gründergeneration hinaus zum Familienunternehmen. Anders die Zittauer Phänomen-Werke: Deren Gründer, Karl Gustav Hiller, fing 1888 mit dem Bau von Fahrrädern an, sattelte um die Jahrhundertwende auf die Herstellung von Motorrädern um und spezialisierte sich schließlich auf den Bau eines dreirädrigen Lieferwagens. Auch nach dem Ersten Weltkrieg baute der Zittauer Betrieb, nun unter der Leitung des Sohns des Firmengründers, Rudolf Hiller, vornehmlich Phänomen-Lieferwagen.17
Entlang der Flussläufe siedelte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine weitere, rasch wachsende Industriebranche an: die Papierherstellung. Zu den Ersten, die das innovative Holzschliffverfahren in Sachsen einführten, gehörten Fritz Kübler und Albert Niethammer. Die beiden Schwaben übernahmen 1856 eine heruntergekommene Papiermühle in Kriebstein, modernisierten sie und gliederten eine Holzschleiferei im oberen Erzgebirge an. Nach Küblers Tod führte Niethammer das Unternehmen allein weiter und baute es in den folgenden Jahrzehnten zum Marktführer in der deutschen Papierindustrie aus. Am Ende der 1920er Jahre waren rund 1.600 Arbeiter und Angestellte in zahlreichen Betriebsstätten von Kübler & Niethammer beschäftigt.18
In der Residenzstadt Dresden siedelten sich Industrien und Gewerbe an, die (zunächst) für den Bedarf der relativ wohlhabenden Einwohnerschaft produzierten. Es entstand hier frühzeitig eine vielfältige Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Um 1900 war Dresden ein Zentrum der deutschen Zigarettenindustrie. Melitta Benz erfand hier zu dieser Zeit den Kaffeefilter und gründete zusammen mit ihrem Mann ein heute noch bestehendes Unternehmen.19
Ähnlich wie in Chemnitz zogen die neuen Konsumgüterindustrien auch in Dresden einen auf ihre Bedürfnisse eingestellten Spezialmaschinenbau an. Johann Martin Lehmann etwa bot den Dresdner Schokoladenfabrikanten bereits seit den 1830er Jahren seine von ihm selbst konstruierten Walzenreibmaschinen an. Später folgten Pressen zur Entölung des Kakaos, Schneidemaschinen und anderes mehr. Nach dem Tod des Gründers 1869 trat sein damals erst 17-jähriger Sohn Louis Bernhard Lehmann in die Unternehmensnachfolge ein. Unter seiner Leitung wurden die Betriebsanlagen ausgebaut und ein weiteres Werk im Vorort Heidenau errichtet.20
Anzeige für Odol-Mundwasser, Lingner-Werke AG Dresden, in der Illustrierten „Die Woche“, Nr. 29, 20. Juli 1912. Die Lingner-Werke wurden im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört, ihre Eigentümer gingen in den Westen.
Um die Jahrhundertwende siedelten sich zudem Unternehmen der optischen und feinmechanischen Industrie in Dresden an. Vornehmlich wurden hier Filmkameras und Fotoapparate gebaut. Ein Pionier dieser Branche war Heinrich Ernemann, der 1891 seine „Fabrik photographischer Apparate, mit Dampfbetrieb“ eröffnete und in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltbekannten Unternehmen ausbaute. Sein Sohn Alexander übernahm nach dem Ersten Weltkrieg die Firmenleitung und fungierte seit 1926 als einer der Direktoren der Zeiss-Ikon AG. Mit dieser Fusion verlor sich allerdings der Charakter der Ernemann-Werke als Familienunternehmen.21
Ein besonders traditionsreiches Familienunternehmen der feinmechanischen Industrie entstand bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in der Peripherie der sächsischen Landeshauptstadt, die Firma Lange & Söhne in Glashütte im Osterzgebirge. Der Dresdner Uhrmacher Ferdinand Adolph Lange trug in den 1840er „Hungerjahren“ der sächsischen Regierung den Plan vor, der notleidenden erzgebirgischen Bevölkerung eine neue Erwerbsquelle zu erschließen. Lange zog 1845 nach Glashütte und eröffnete mit staatlicher Unterstützung eine Werkstatt, in der er junge Leute in der Uhrmacherei ausbildete. Seit der Aufnahme von Emil und Richard Lange 1868 firmierte das Unternehmen unter dem Namen „Lange & Söhne“.22
Illustre Namen finden sich auch unter den Gründergestalten der pharmazeutisch-kosmetischen Industrie, die sich im Dresdner Raum niederließ: Franz-Ludwig Gehe, Friedrich von Heyden, Karl August Lingner, der mit dem Mundwasser „Odol“ ein Vermögen verdiente, oder Ottomar Heinsius von Mayenburg, der um 1910 mit der Zahnpasta „Chlorodont“ ein damals neues Produkt weltmarktfähig machte. Neben den großen Unternehmen gab es in dieser Branche auch zahlreiche kleinere und mittlere Firmen, von denen nicht wenige über längere Zeit hinweg in Familienbesitz blieben. Dazu gehört etwa bis heute die Firma APOGEPHA.23
Die Stadt Leipzig fungierte vor 1945 als Schaltzentrale des deutschen Buchhandels. Von alters her wurden hier Bücher nicht nur gehandelt, sondern auch gedruckt und gebunden. Einige der großen Verlagshäuser unterhielten eigene Druckereien oder waren aus Druckereibetrieben hervorgegangen. Und es war die Firma F. A. Brockhaus, die bereits 1826 mit der Aufstellung dampfbetriebener „Schnellpressen“ den Schritt vom Druckhandwerk zur polygrafischen Industrie vollzog. Der Gründer des renommierten Lexikon-Verlags, Friedrich Arnold Brockhaus, hatte sein Geschäft erst neun Jahre zuvor nach Leipzig verlagert. Dort blieb das Familienunternehmen Brockhaus fünf Generationen lang ansässig.
Auf ein spezielles Druckerzeugnis konzentrierte sich die Druckerei von Giesecke & Devrient: Banknoten und andere Wertpapiere. Hermann Giesecke entstammte einer Leipziger Unternehmerfamilie. Da aber seine älteren Halbbrüder nach dem Tod des Vaters die familieneigene Schriftgießerei übernahmen, benutzte der gerade 21-Jährige sein Erbteil 1852 als Startkapital zur Gründung eines eigenen polygrafischen Unternehmens. Einen Partner fand er in dem zehn Jahre älteren Alphonse Devrient, dem Sohn eines Zwickauer Fabrikanten. Bereits am Ende des Gründungsjahres richteten Giesecke & Devrient eine Kupfer- und Stahlstichdruckerei ein. Sie legten damit den Grundstein für die weitere Entwicklung ihres Unternehmens, das sich zunehmend auf das technisch anspruchsvolle Feld des Drucks von Banknoten, Aktien und Pfandbriefen verlagerte. Um die Wende zum 20. Jahrhundert zählten Giesecke & Devrient zu den führenden deutschen privaten Wertpapierdruckereien.24
Bedeutsamer noch als der Buchhandel für die Anziehungskraft Leipzigs auf industrielle Unternehmen war der Status der Stadt als wichtigster Messeplatz Mitteleuropas. Der Standort Leipzig war einerseits für Industrieunternehmen interessant, die ihre Erzeugnisse überregional vermarkten wollten. Gerade für den Export nach Osteuropa bot die Messestadt als Drehscheibe des West-Ost-Handels günstige Voraussetzungen. Andererseits wurden in Leipzig Rohstoffe und Halbwaren in großer Vielfalt und Quantität umgeschlagen, was die Ansiedlung weiterverarbeitender Branchen in der Messestadt und ihrer Umgebung förderte. So wurde bereits im 18. Jahrhundert auf den Leipziger Messen eine reiche Auswahl an Aromastoffen und Essenzen angeboten. Zu den „Drogenhandlungen“ dieser Zeit reichen die Wurzeln der Firma Schimmel & Co. zurück, die 1855 in den alleinigen Besitz des Kaufmanns Hermann Fritzsche überging. Unter seiner Leitung wurden die Produktionsanlagen stark erweitert, bis Schimmel & Co. schließlich 1901 im nahen Miltitz ein weitläufigeres Fabrikgelände fanden. Hermann Fritzsches Enkel wandelten das inzwischen zum Weltmarktführer aufgestiegene Unternehmen 1927 in eine Aktiengesellschaft um, deren Anteile aber im Besitz der Gründerfamilie blieben.25
Werbung mit Darstellung des Werksgeländes der Firma Schimmel & Co. in Miltitz bei Leipzig, um 1900
Ähnlich weit zurückreichende Vorläufe wie in Sachsen lassen sich auch für etliche der Thüringer Industriebranchen feststellen. Auch dort hatte sich in der Frühen Neuzeit ein vielgestaltiges Textilexportgewerbe entwickelt. Ein Zentrum der Strumpfwirkerei hatte sich in und um Zeulenroda herausgebildet. In Greiz und Gera wurden ganz ähnliche Artikel – Tuche, Kammgarngewebe, Möbelstoffe – hergestellt wie im angrenzenden Sachsen.26
Auf eine lange gewerbliche Tradition konnte man auch in Suhl und Zella-Mehlis zurückblicken. Dort wurden bereits seit dem ausgehenden Mittelalter Gewehre hergestellt, für die der Holzreichtum und die Eisenhütten des Thüringer Walds die Werkstoffe lieferten. Nach der Eingliederung dieser Region und des Gebiets um Erfurt in den preußischen Staatsverband 1815 nahm der Gewehrbau einen raschen Aufschwung. In Suhl und in Sömmerda bei Erfurt entstanden nun neben den Handwerksbetrieben größere Produktionseinheiten. Dort wurden unter anderem die neuen Zündnadelgewehre für die preußische Armee produziert. Zu einem der wichtigsten Akteure dieser Branche entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Unternehmen, das die Brüder Moses und Löb Simson 1856 in Suhl begründeten. Die Simsons waren eine seit Generationen in der Gegend ansässige jüdische Kaufmannsfamilie. Die Bajonett- und Ladestock-Fabrik der Gebrüder Simson begann als Zulieferbetrieb der Suhler Gewehrindustrie. Ihr Unternehmen, das bereits in den 1860er Jahren auf die zweite Generation übergegangen war, expandierte rasch und stieg in den eigentlichen Gewehrbau ein. Schon bald zählte die Firma Simson zu den Hauptlieferanten der preußischen wie der sächsischen Militärbehörden. Seit den 1890er Jahren bemühte sich die Firmenleitung verstärkt um die Aufnahme ziviler Produktlinien, auch um die Abhängigkeit von den staatlichen Beschaffungsstellen zu vermindern. Es wurden zunächst Fahrräder, bald auch Automobile in den Simson-Werken produziert.27
Zu den traditionellen Standorten des thüringischen Waffenhandwerks gehörte auch der Ort Ruhla bei Eisenach. Hier eröffneten die Brüder Georg und Christian Thiel 1862 einen metallverarbeitenden Betrieb, der Beschläge für die örtliche Tabakpfeifenherstellung fertigte. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte wuchs die Firma Gebrüder Thiel zu einem umsatzstarken Industrieunternehmen, das über ein eigenes Messingwalzwerk verfügte und ein umfangreiches Sortiment an metallenen Gebrauchsgegenständen und Einzelteilen produzierte. Zum Sortiment gehörten auch Spielzeuguhren, aus denen in den 1890er Jahren ein Artikel entwickelt wurde, der bald zum Markenzeichen der Thiels werden sollte: preiswerte Taschenuhren. Die Diversifikation des Unternehmens ging nach der Jahrhundertwende weiter. Die Thiels stiegen in den Werkzeugmaschinenbau ein. In der Zwischenkriegszeit war ein verzweigtes Unternehmenskonglomerat entstanden, das an verschiedenen Standorten insgesamt rund 7.000 Mitarbeiter beschäftigte.28
Die größte Stadt Thüringens, Erfurt, wurde im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Schuhfabrikation. Die Gründung und Entwicklung der Firma Lingel mag exemplarisch für die Industrialisierung der Schuhmacherei stehen. Eduard Lingel eröffnete 1872 eine Werkstatt, in der er einige Schuhmachermeister beschäftigte, den Großteil der Produktion aber zunächst an Heimarbeiter auslagerte. Der kinderlose Firmengründer nahm 1886/91 seine beiden langjährigen Mitarbeiter, die Brüder Louis und Fritz Dreßler, als Teilhaber in das Unternehmen auf. 1898 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, deren Mehrheitseigner die bisherigen Teilhaber blieben. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg vergrößerte sich die Lingel AG durch die Eingliederung von drei weiteren Erfurter Schuhfabriken.29
In der Region des heutigen Sachsen-Anhalt stand die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, insbesondere die Zuckerindustrie, am Beginn der Industrialisierung. Von diesen Branchen gingen Anstöße für die Entwicklung des Maschinenbaus vor allem in Magdeburg, Halle, Nordhausen und Dessau aus.
Einer der wichtigsten Frühindustriellen war der Kaufmann Johann Gottlob Nathusius. Er gründete in Magdeburg 1787 nach der Aufhebung des königlichen Tabakmonopols die erste private Tabakmanufaktur in Preußen. Ende des Jahrhunderts war Nathusius’ Manufaktur in der Elbestadt der führende Tabakhersteller und von erheblicher Bedeutung für das örtliche Wirtschaftsleben.30 Als Napoleon 1810 die Kontinentalsperre verhängte, um damit den Export englischer Waren nach Kontinentaleuropa zu blockieren, geriet auch das Tabakgeschäft in eine Krise. Nathusius reagierte mit dem Kauf des ehemaligen Klosterguts Althaldensleben und des benachbarten Guts Hundisburg, wo er den Anbau von Tabak, Zuckerrüben, Zichorien, Kartoffeln und Getreide mit der Errichtung von Verarbeitungsbetrieben verband.31 Dazu gehörten Getreide- und Ölmühlen, eine Nudelfabrik, eine Brennerei, eine Stärkefabrik, Obstweinund Essigfabriken, eine Zuckerrübenfabrik, eine Brauerei, Ziegeleien und Steinbrüche sowie eine Porzellan- und eine Steingutmanufaktur.
Dank der Tatkraft von Nathusius entwickelte sich Haldensleben von einer Ackerbürger- zu einer Industriestadt. Von vielen Zeitgenossen wurde Nathusius, der reichste Bürger Magdeburgs, bewundert. Der Schriftsteller Karl Immermann wählte ihn 1836 als literarisches Vorbild für den ersten deutschen Industriellenroman „Die Epigonen“. Tatsächlich kann Nathusius als der erste deutsche Unternehmer gelten, dem der Aufbau eines diversifizierten „Agrar-Industrie-Komplexes“ mit mehr als 30 Einzelbetrieben gelang.
Im Jahr 1835 starb Johann Gottlob Nathusius. Die bisherigen Prokuristen Hillebrand und Steinbrück führten – als Mitgesellschafter – die Firma auf Rechnung der Erben weiter. Am 1. Januar 1845 wurde nach achtjähriger Tätigkeit in der Firma der Neffe des verstorbenen Gründers, Moritz Nathusius, als Teilhaber aufgenommen. Er und seine Nachkommen führten die Firma bis 1950. Im Juli 1950 wurde das bedeutende und inzwischen in fünfter Generation geführte Familienunternehmen von der DDR-Regierung enteignet.
Ludwig Klamroth eröffnete 1836 eine Rübenzuckerfabrik und wurde damit zum ersten Industrieunternehmer Halberstadts. Auf diese folgte in Gröningen eine zweite Rübenzuckerfabrik, bevor sein Sohn Gustav in Nienburg an der Weser eine Düngemittelfabrik gründete. Die Klamroths blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die wichtigsten Industriellen in Halberstadt. Johann Georg Klamroth, seit 1923 Teilhaber, beteiligte sich als Offizier am Widerstand gegen Hitler. Er wurde ebenso wie sein Neffe Bernhard Klamroth, der als Generalstabsoffizier in die Pläne von Oberst von Stauffenberg eingeweiht war, im August 1944 hingerichtet.32 Im Jahr 1948 zog die Ehefrau mit ihren beiden jüngsten Töchtern von Halberstadt nach Braunschweig. Das Familienunternehmen war durch den Krieg und die deutsche Teilung ruiniert.
Der „Zuckerkönig“ Carl Wentzel baute bei Eisleben seit der Jahrhundertwende ein vertikal verflochtenes agrarindustrielles Konglomerat auf. Dazu gehörten landwirtschaftliche Betriebe, Braun- und Steinkohlengruben, Kalkbrüche und Kalköfen, Tonwarenfabriken, Kalibergwerke, Zuckerraffinerien, Brennereien, Mühlen, eine Kartoffelflocken- und eine Malzfabrik.33
An Saale und Unstrut liegt das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands, dessen wohl bekanntestes Markenerzeugnis bis heute der „Rotkäppchen“-Sekt ist. Dieser Schaumwein stammte aus den Kellern eines Familienunternehmens, das die Brüder Moritz und Julius Kloss mit ihrem Freund Carl Foerster 1856 in Freyburg an der Unstrut als Weinhandelsgeschäft gegründet hatten.34
Im Südosten des späteren Bundeslandes Sachsen-Anhalt war es die reichlich vorhandene Braunkohle, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die industrielle Entwicklung antrieb. Auf der Grundlage der Paraffinerzeugung mittels Braunkohleverschwelung entstand zwischen Halle, Bitterfeld und Merseburg eine chemische Großindustrie, die vor allem während des Ersten Weltkriegs und im Zuge der Rüstungs- und Autarkiepolitik des Naziregimes starke Wachstumsimpulse erhielt. Für das Gedeihen von Familienunternehmen boten allerdings die großindustriellen Strukturen im mitteldeutschen Chemiedreieck keinen günstigen Boden.35
Staßfurt war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das bedeutendste Zentrum des deutschen Kalibergbaus. Die hier gewonnenen Kaliumsalze bildeten den Ausgangsstoff für die Produktion von Schießpulver und wurden als Düngemittel verwendet. In Bernburg siedelte sich 1881 das belgische Familienunternehmen Solvay an, um hier eine Sodafabrik zu errichten.36 Solvay war Weltmarktführer in der Sodaproduktion und baute seine Bernburger Fabrik zu einem der größten Standorte des Unternehmens aus.
Industrielles Kraftzentrum der preußischen Provinz Brandenburg war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Landes- und Reichshauptstadt Berlin und ihre weitere Umgebung. Während „junge“ Industrien entstanden, wanderte die Textilindustrie bereits in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts aus Berlin ab. Sie siedelte sich vornehmlich im Südosten der Provinz Brandenburg an, etwa in Cottbus und Luckenwalde. In Guben und Forst konnte die für den überregionalen Absatz eingerichtete Tuchmacherei bereits auf eine längere Tradition zurückblicken. Zu den bedeutendsten Gubener Textilunternehmen gehörte der Betrieb von Johanna Caroline Lehmann. Sie hatte 1818 die Werkstatt ihres früh verstorbenen Mannes übernommen und baute sie in den folgenden Jahrzehnten zum größten Fabrikbetrieb der Stadt aus. Nach ihrem Tod 1842 führten ihre beiden Söhne Carl und Wilhelm die Tuchfabrik unter der Firma C. Lehmann’s Witwe weiter, einem Namen, den auch die kommenden Generationen der Unternehmerfamilie Lehmann bis ins 20. Jahrhundert beibehielten.37
Hier in der Niederlausitz und der nördlichen Oberlausitz, die bis 1945 zur preußischen Provinz Schlesien gehörte, begann in den 1840er Jahren der Braunkohleabbau in größerem Stil. Die Lausitzer Braunkohle spielte eine wichtige Rolle bei der Industrialisierung der regionalen Tuchmacherei. Um 1870 verbrauchten die Tuchfabriken gut die Hälfte der Förderung des Reviers. Andere große Abnehmer waren die Ziegeleien und die Glashütten, später auch die chemische Industrie. Ansonsten erfasste die Industrialisierung in Brandenburg vor allem die weitere Peripherie Berlins. Dort fanden zahlreiche der großen Maschinenbau- und Elektrounternehmen seit dem späteren 19. Jahrhundert günstigere Bedingungen für den Ausbau ihrer Produktionsanlagen vor als in der Hauptstadt, wo die Grundstückspreise stark angezogen hatten. Sie zogen unter anderem nach Brandenburg, Eberswalde, Wildau und Finsterwalde.
Die Wiege der optischen Industrie in Deutschland stand in Rathenow.38 Hier wurde 1801 die „Königlich privilegierte optische Industrie-Anstalt“ vom Prediger Johann Duncker gegründet. Mit einer von ihm entwickelten Schleifmaschine bearbeiteten invalide Soldaten und Waisenkinder die Linsen für die Brillen. Unter der Leitung seines Nachfolgers Eduard Busch entwickelte sich die optische Industrieanstalt Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Großbetrieb. Um 1900 gab es in Rathenow bereits mehr als 160 familiengeführte optische Betriebe, womit sich der Ort den Beinamen „Stadt der Optik“ erwarb.
Zu den Familienunternehmen in der preußischen Provinz Brandenburg, die es in der Zeit der Hochindustrialisierung schafften, international bekannt zu werden, gehörte die Firma Reiss in Bad Liebenwerda.39 Firmengründer Hermann Robert Reiss wirkte seit 1881 als Landmesser beim königlichen Katasteramt Liebenwerda. Dort gründete er einen Versandhandel für Vermessungsbedarf und Bürohilfsmittel. Sein Unternehmen spezialisierte sich auf die Fertigung von Vermessungstechnik, Lichtpaustechnik, Mess- und Rechentechnik sowie Büromöbeln. Robert und sein Bruder Paul entwickelten die Produktion von der einfachen Messlatte bis hin zu geodätischen Präzisionsgeräten.40 Mit den „Reiss-Brettern“ (Zeichenmaschinen) gelang der internationale Durchbruch. Nur wenige Jahre später konnte die Firma für sich in Anspruch nehmen, auf diesem Gebiet die größte Spezialfabrik des Kontinents zu sein. Inzwischen hatte die Gebr. Wichmann GmbH Berlin, ebenfalls ein Familienunternehmen, die Mehrheit der Anteile an der Reiss GmbH übernommen.
Größere Teile Brandenburgs blieben aber weiterhin stark agrarisch geprägt.41 Ähnliches gilt noch in größerem Maße für das heutige Mecklenburg-Vorpommern.42 Eine nennenswerte Entwicklung zu Industriestandorten machten vor 1914 allenfalls die mecklenburgischen Hafenstädte Rostock und Wismar durch, wo seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einige moderne Schiffsbau-Unternehmen entstanden waren. Der bedeutendste dieser Betriebe war die 1850 gegründete Rostocker Neptunwerft, die zeitweise mehr als 1.000 Arbeiter beschäftigte.
Eine Geschichte der Familienunternehmen in Ostdeutschland von 1945 bis heute erzählt notwendigerweise von mehreren radikalen Brüchen. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Gebiet zwischen Elbe und Oder, wie gezeigt, zahlreiche Familienunternehmen mit weltbekannten Marken und Produkten, die nach 1945 entweder ganz ausgelöscht wurden oder in den Westen abwanderten. Einen weiteren Einschnitt markierte das Jahr 1972, in dem die letzten noch in privater Hand befindlichen Betriebe des produzierenden Gewerbes, Betriebe mit staatlicher Beteiligung sowie Produktionsgenossenschaften des Handwerks verstaatlicht wurden. Der wirtschaftliche Schaden, den der Krieg, die deutsche Teilung, die Enteignungen in der SBZ- und DDR-Zeit bis hin zur vollständigen Verstaatlichung der noch in Privathand befindlichen Familienunternehmen im Jahr 1972 anrichteten, lässt sich nicht einmal annähernd beziffern.
Diese Verwerfungen wirkten lange nach und konnten auch in den drei Jahrzehnten nach der deutschen Einheit noch nicht vollständig kompensiert werden. Dennoch geben gerade die Geschichten von Familienunternehmen, denen nach 1990 die Reprivatisierung gelang, die von West nach Ost zurückkehrten oder auch die zahlreichen Neugründungen begründeten Anlass zum Optimismus. Es ist an der Zeit, diese in allen ostdeutschen Bundesländern zu findenden Erfolgsgeschichten mehr in den Blick zu nehmen und zu würdigen.
Filmplakat zum Spielfilm „Geheimakten Solvay“ von 1953. Die Enteignung der Firma wurde propagandistisch ausgeschlachtet, „um die Wachsamkeit unserer Werktätigen, ihre revolutionäre Schlagkraft zu erhöhen“ (Neues Deutschland, 27. Januar 1953).
1. Besatzungssystem, Demontagen und Sowjetische Aktiengesellschaften
In den Nachkriegsjahren wurden alle für die Wirtschaftsentwicklung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wichtigen Fragen von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) entschieden. Neben der SMAD – und teilweise auch gegen sie – agierten noch verschiedene Sonderorganisationen der Besatzungsmacht, wie ein mit den Demontagen beauftragtes Sonderkomitee. Die fünf Landes- beziehungsweise Provinzialregierungen besaßen demgegenüber nur geringe Spielräume. Für die Unternehmen in der SBZ waren die neuen Machtverhältnisse anfangs nur schwer zu durchschauen. Sie litten unter Plünderungen und Diebstählen, die von den Besatzungstruppen und von Teilen der Bevölkerung verübt wurden, und mussten versuchen, irgendwie mit den sich oft widersprechenden Befehlen und Anordnungen der SMAD klarzukommen. Größtes Problem war die Unsicherheit über die künftigen Eigentumsverhältnisse.
Die beginnende Transformation der Wirtschaftsverfassung vollzog sich vor dem Hintergrund einer von der Besatzungsmacht anfangs rigoros durchgeführten Politik der „industriellen Abrüstung“. Deren Ziel war die Schwächung des ehemaligen Kriegsgegners, die Zerstörung seines rüstungswirtschaftlichen Potenzials und der Transfer von Gütern und Know-how aller Art zugunsten des Wiederaufbaus in der Sowjetunion.43
Die SMAD konnte jedoch kein Interesse an einer völligen Deindustrialisierung des von ihr verwalteten Besatzungsgebiets haben. Ihre Offiziere waren für die Wiederingangsetzung der Wirtschaft verantwortlich. Daher kam es häufig zu Konflikten zwischen der SMAD und den von den Moskauer Ministerien in die SBZ geschickten Beauftragten des Sonderkomitees.
Nach dem Befehl zur Totaldemontage der völlig intakten Papierfabrik Schoeller & Bausch im Jahr 1946 stehen die Hallen leer, aber die Neu-Kalißer erwirken einen „Wiederaufbaubefehl“ bei der SMAD. Bis 1949 baut die Belegschaft unter der Leitung von Viktor Bausch aus alten Teilen eine neue Papiermaschine. Erst danach wird das Unternehmen unter fadenscheinigen Gründen enteignet.
Nachdem die erste Welle von Beschlagnahmungen – von den Siegern als Trophäenaktion bezeichnet – abgeebbt war, hofften die Unternehmer in der SBZ auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft, zumal der Oberste Chef der SMAD, Marschall Georgi Schukow, bereits am 21. Juli 1945 einen Befehl zur Wiederingangsetzung der Betriebe erlassen hatte.44
Auch die Papierfabrik Schoeller & Bausch im kleinen mecklenburgischen Ort Neu-Kaliß sollte rasch wieder ihre Produktion aufnehmen. So versicherten es Offiziere der SMAD und Vertreter des Moskauer Volkskommissariats (Ministerium) für Papierwirtschaft mehrfach. Doch dann wurde Ende März 1946 der Befehl zur Totaldemontage erlassen. Erika von Hornstein, die Frau des Unternehmers Viktor Bausch, hat die Erlebnisse in dieser dramatischen Zeit in ihren Erinnerungen geschildert. Vergeblich versuchte die Familie die Demontage abzuwenden, indem sie bei der Sowjetischen Militäradministration in Schwerin und der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) in Ost-Berlin, Vorläufer der späteren DDR-Regierung, vorsprach: „In der DWK herrschte nervöses Durcheinander. Unzählige warteten auf den breiten Gängen des früheren Luftfahrtministeriums. Ihren Fabriken war das gleiche Schicksal zudiktiert worden, und sie wollten ebenfalls versuchen, es zu wenden. Die Beamten der Abteilung Leichtindustrie zuckten hilflos die Achseln und deuteten nur auf die Listen, mit denen ihre Arbeitstische bedeckt waren. In langen Reihen standen darauf die Namen der Fabriken, die von den Russen zur Demontage bestimmt waren. Hunderte! Hier etwas erreichen zu wollen schien sinnlos.“45
Selbst der Hauptverantwortliche für die Durchführung der Demontagen in Mecklenburg, Oberst Rasin, hielt die Demontage der völlig intakten Fabrik für Wahnsinn, musste aber den Befehl nach einigem Hin und Her exekutieren.46 Etwa 3.000 Demontagearbeiter, zwangsverpflichtete Deutsche und sowjetische Strafbataillone, wurden dafür mobilisiert. „‚Unsere schöne Fabrik schlagen sie kaputt, unsere schöne Fabrik‘. Manchem Arbeiter standen die Tränen in den Augen. Aber als der erste Schock überwunden war, hatten alle nur den einen Gedanken: Wir werden wiederaufbauen.“47
Ähnliches geschah auch in Kriebstein, dem Zentrum der Papierindustrie in Sachsen. Die dortigen Papierfabriken der Firma Kübler & Niethammer – mit rund 1.400 Beschäftigten an vier Standorten das größte Familienunternehmen der Branche – sollten abgebaut werden.48 Firmeninhaber Wilhelm Niethammer erwirkte einen Demontagestopp, da sein Unternehmen das Papier für die von der Besatzungsmacht herausgegebene „Tägliche Rundschau“ produzierte. Doch im Oktober 1945 wurden die Familienmitglieder, die prominente Funktionen in der nationalsozialistischen Wirtschaftslenkung innegehabt hatten, verhaftet und in ein Internierungslager auf der Insel Rügen verbracht. Ihre Wohnhäuser und Fabriken wurden beschlagnahmt und Treuhänder eingesetzt. Die Belegschaft schrieb an die neuen Machthaber, lobte die sozialen Einrichtungen der Firma Niethammer und bat um die Freilassung der Inhaber. Alles vergebens. Die Papierfabriken wurden demontiert. Nach ihrer Haftentlassung gingen die Niethammers nach Aschaffenburg und begannen mit dem Wiederaufbau ihres Unternehmens. Den Kontakt zum einstigen Firmensitz ließen sie trotzdem nie ganz abreißen.49
Zu einem spektakulären Protest kam es im Januar 1947 in Freital. Das Freitaler Stahlwerk war bereits demontiert worden. Nun sollten auch noch die mechanischen Werkstätten abgebaut werden. Betriebsleiter Johannes Vogler verfasste folgendes Flugblatt: „Arbeiter schützt Eure Betriebe gegen Saboteure am Volksvermögen! Wir protestieren gegen derartige Willkür und nehmen an keiner Demontage teil.“50 Voglers Werdegang war typisch für viele aus der Not geborene Unternehmer, die mit einem unbändigen Willen an den Wiederaufbau gingen. Auch als das in „Mechanische Werkstätten Freital – J. Vogler“ umbenannte Werk im September 1948 in Landeseigentum überführt wurde, blieb er als Werkleiter tätig.
Die Industrie der SBZ verlor durch die Demontagen rund 3.500 Betriebe und ein Drittel ihres Anlagevermögens.51 Zum Vergleich: Auch in den drei Westzonen wurde demontiert, teilweise sogar noch bis 1951. Betroffen davon waren aber nur 668 Werke. Die Kapazitätsverluste von 3 bis 5 Prozent fielen weniger stark ins Gewicht als befürchtet, so dass die Bundesrepublik 1949 mit einem erstaunlich intakten Kapitalstock den Wiederaufbau beginnen konnte.52
In der SBZ hingegen gingen die Demontagen weit über die reine Rüstungsindustrie hinaus. Besonders hart traf es die Deutsche Reichsbahn, die ungefähr ein Drittel ihrer Lokomotiven, darunter fast alle Elektrolokomotiven, und nahezu drei Viertel ihrer Güterwaggons und Personenwagen verlor. 11.800 Kilometer des Schienennetzes, überwiegend das „zweite Gleis“ mehrgleisiger Strecken, wurden abgebaut. Erst 1966 konnte die Deutsche Reichsbahn die vor dem Krieg erbrachte Betriebsleistung, bei noch immer geringeren Kapazitäten, wieder erreichen.53
Von Demontagen in der SBZ und Berlin betroffen waren mindestens 2.500 Familienunternehmen. Knapp die Hälfte davon sind nach dem Ende der Demontagen von den Wirtschaftsbehörden der Länder als „unauffindbar“ eingestuft worden. Zumeist hatten ihre Besitzer die SBZ verlassen.
Die Mehrzahl der demontierten Betriebe hatte keinen militärischen Charakter. In der Provinz Sachsen – ab März 1947 Sachsen-Anhalt – wurden beispielsweise Zuckerfabriken, Molkereien, Schuhfabriken, Ziegeleien, Sägewerke, Möbelfabriken, Druckereien, Konservenfabriken, Werkstätten zur Produktion von Kachelöfen und ein Rundfunksender abgebaut.54
Tabelle 1: Demontierte Betriebe nach Ländern der SBZ (Stand Mai 1947)
Land
Zahl der demontierten Betriebe
Sachsen
983
Berlin insgesamt
818
– davon West-Berlin
(605)
Mecklenburg
494
Brandenburg
470
Thüringen
409
Sachsen-Anhalt
298
Insgesamt
3.472
Quelle: Zusammengestellt nach: Demontagedatei des Zentrums für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Die Demontagen in der SBZ erreichten ein solches Ausmaß, dass amerikanische Volkswirte für den Fall der baldigen Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftseinheit mit erheblichen Belastungen durch die geschwächte Wirtschaft des Ostens rechneten.55 Auch die SMAD sah mit Sorge auf die Folgen der Demontagepolitik und drängte in Moskau auf einen Politikwechsel. Tatsächlich wurden die Demontagen zugunsten von Entnahmen aus der laufenden Produktion eingeschränkt. Wichtigstes Element der neuen Reparationspolitik war die Bildung von Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG).56 Insgesamt wurden 213 Betriebe als Reparationsleistung in sowjetisches Eigentum überführt.57 Es handelte sich um die größten Industriebetriebe der SBZ, darunter die Werke von Siemens in Ost-Berlin, alle Werke der I. G. Farbenindustrie AG in Sachsen-Anhalt, die Werke von Krupp-Gruson, Otto Gruson, Buckau & Wolf sowie Schäfer & Budenberg in Magdeburg, das Eisenhüttenwerk Thale und die Neptun-Werft in Rostock. In den größten SAG-Betrieben waren jeweils mehrere tausend Beschäftigte tätig und in allen SAG-Betrieben zusammengerechnet bis zu 600.000. Die Produkte der SAG-Betriebe wurden als Reparationsleistungen in die Sowjetunion und nach Polen geliefert, in der SBZ verkauft oder zu einem geringeren Teil auch exportiert.
Ungeachtet aller anderen noch zu erläuternden Enteignungsmaßnahmen führte allein schon die Bildung eines vollständig von der Besatzungsmacht kontrollierten Industriesektors zu einer enormen Schwächung der Privatwirtschaft.58 Rund ein Drittel der gesamten Industrieproduktion der SBZ entfiel auf die SAG-Betriebe. Diese wurden im Zuge der Reduzierung der Reparationslasten schrittweise der Regierung der DDR übertragen und als Staatsbetriebe weitergeführt.
2. Die erste große Enteignungswelle
Die Umgestaltung der Besitzverhältnisse in der Wirtschaft gehörte zu den erklärten Zielen der aus dem Moskauer Exil nach Berlin zurückgekehrten KPD-Führung. Die Kommunisten sahen unter den Bedingungen der sowjetischen Besatzungsherrschaft eine Chance, die Gesellschaftsstrukturen in der SBZ nach ihren Vorstellungen radikal zu verändern. Das theoretische Rüstzeug dafür boten ihnen die Schriften von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir I. Lenin.
Karl Marx war der erste Theoretiker, der die Dynamik des Kapitalismus in seinem bereits 1867 erschienenen Hauptwerk „Das Kapital“ beschrieben hatte. Er führte den permanenten Verwertungsdruck auf den technischen Fortschritt und den Wettbewerb der Unternehmen zurück. Marx sah voraus, dass der Kapitalismus zur Bildung von Oligopolen tendiert. Die kleinen Firmen werden verdrängt, bis nur noch wenige große Konzerne eine Branche beherrschen. Damit würden sie jedoch auch ihr Ende herbeiführen, denn die ausgebeuteten „Volksmassen“ bei einer Revolution würden nur noch die wenigen Kapitalisten entfernen.
Der russische Revolutionär Wladimir I. Lenin berief sich zwar auf Marx, dachte und handelte aber viel radikaler. Er sprach nicht nur allgemein von der Enteignung von Landbesitzern und Industriellen, sondern rief in seinem Artikel „Wie soll man den Wettbewerb organisieren?“ vom Dezember 1917 zur Gewalt gegen sie auf und bediente sich dabei einer inhumanen Sprache. Die Reichen, die Gauner, die als Ungeziefer, Parasiten, Flöhe, Wanzen tituliert werden, müssten von der russischen Erde getilgt werden, um das Ziel der sozialistischen Revolution zu erreichen. Sie sollten Klosetts reinigen, ins Gefängnis gesteckt werden, spezielle Ausweise erhalten oder zur Abschreckung gleich erschossen werden. Diesen Worten ließen die Bolschewiki in den Jahren des russischen Bürgerkriegs (1917–1921) Taten folgen. Eine ganze Gesellschaftsschicht wurde kollektiv in Haft genommen und das private Unternehmertum innerhalb weniger Jahre ausgelöscht.
In einer derart radikalen Art und Weise konnten die deutschen Kommunisten schon aufgrund der Teilung Deutschlands in Besatzungszonen nicht vorgehen. Das Ziel einer möglichst vollständigen Verstaatlichung der Wirtschaft hatten sie dennoch stets im Blick. Die Frage war nicht, ob es dazu kommen sollte, sondern nur, in welchem Tempo und mit welchen Methoden dieses vermeintliche Idealziel erreicht werden sollte.
Im Herbst 1945 ergriffen die Besatzungsmacht und die KPD die Initiative für eine Bodenreform. Die mit ihrer Umsetzung beauftragten Kommissionen auf Kreis- und Gemeindeebene gingen rigoros vor, ohne an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden zu sein. Der gesamte Grundbesitz über 100 Hektar wurde entschädigungslos enteignet und in einen staatlichen Bodenfonds eingebracht. Aus diesem erhielten Landlose, Flüchtlingsfamilien und Kleineigentümer Parzellen bis maximal fünf Hektar Größe. Widerständische Eigentümer oder Pächter von enteigneten Betrieben wurden aus ihren Landkreisen ausgewiesen. Dieses Vorgehen zeigte, dass mit der Bodenreform in erster Linie eine politische Zielsetzung verfolgt wurde.
Gleiches kann auch von der Veränderung der Besitzstände in der Industrie gesagt werden. Von einer Übertragung des sowjetischen Systems war anfangs noch keine Rede. Dennoch hatte die KPD/SED-Führung klare Vorstellungen vom anzustrebenden Ziel. Die Wirtschaft, in einem ersten Schritt zumindest die Großbetriebe, sollte verstaatlicht werden. Einen Ausgangspunkt dafür bot der Umgang mit „herrenlosen Betrieben“, deren Eigentümer entweder geflohen oder von den Besatzungsbehörden verhaftet worden waren. Diese Betriebe wurden der Kontrolle der eigens dafür gebildeten „Ämter für Betriebsneuordnung“ unterworfen.59
Von den Landesverwaltungen bereits geplante Enteignungen ließen die Besatzungsmacht aktiv werden. Die SMAD erließ im Oktober 1945 die Befehle Nr. 124 und 126. Auf Grundlage dieser Befehle „über die Beschlagnahme und provisorische Übernahme einiger Eigentumskategorien“ wurde das Vermögen des deutschen Staates, führender Mitglieder der NSDAP und von Personen, die das sowjetische Militärkommando benannte, beschlagnahmt.
Sequesterkommissionen mit Vertretern der neu zugelassenen Parteien und Organisationen – von der sowjetischen Besatzungsmacht waren ab Juni 1945 kurz nacheinander die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Christlich Demokratische Union (CDU) und die Liberal Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) sowie der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) zugelassen worden – überprüften die Betriebe und stuften sie in zwei Listen ein: Liste A umfasste die zur Enteignung vorgesehenen Unternehmen, während Liste B die Betriebe enthielt, die an ihre Eigentümer zurückgegeben werden sollten.60 Außerdem gab es noch eine Liste C mit Unternehmen, über die allein die Besatzungsmacht entschied. Die auf dieser Liste geführten Betriebe wurden, wie bereits erwähnt, als Reparationsleistung enteignet und ab Mitte 1946 an sowjetische Aktiengesellschaften übergeben.
Die Beschlagnahmungen sollten nach dem Willen der KPDbeziehungsweise SED-Führung – im April 1946 erfolgte die überwiegend auf Zwang beruhende Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei (SED) – nicht nur und nicht in erster Linie der Bestrafung der Verantwortlichen für die nationalsozialistische Herrschaft und den Krieg dienen. Wie dabei vorgegangen werden sollte, erläuterte der sächsische Minister für Wirtschaft und Wirtschaftsplanung, Fritz Selbmann, vor SED-Funktionären im Mai 1946: „Es wird nur enteignet, wer Kriegsverbrecher und Kriegsinteressent war und Gefahr für die demokratische Entwicklung ist. Was wir dann tun, das ist eine andere Sache […]. Es schafft günstige Ausgangspositionen für die Politik unserer Partei.“61
Die Landesverwaltung Sachsen gab „Richtlinien“ vor, mit denen definiert wurde, wer als „Naziverbrecher“, „aktiver Nazi“ und „Kriegsinteressent“ einzustufen sei.62 „Kriegsinteressenten“ waren alle Personen, die in der Zeit des Kriegs „eine führende Stelle in kriegswichtigen Wirtschaftsorganisationen der deutschen Wirtschaft oder in den Verwaltungsorganisationen der von der deutschen Wehrmacht besetzten Länder“ innegehabt hatten.63 Die Richtlinie wurde gegenüber der Ursprungsfassung durch die Bezugnahme auf die „Gewinnsucht“ noch verschärft. Demnach galten auch natürliche und juristische Personen als „Kriegsinteressenten“, wenn sie vor Ausbruch des Kriegs aus „Gewinnsucht“ an der Aufrüstung der deutschen Wirtschaft aktiv teilgenommen hatten. Erst recht traf dies auf die Kriegszeit zu und für den Fall, dass sich natürliche und juristische Personen „in besonderem Maße um die Zuweisung von ausländischen Arbeitskräften für Rüstungszwecke“ bemüht hatten.64 Diese Punkte trafen de facto auf jede größere Firma zu. In der Praxis der meisten Sequesterkommissionen wurden Unternehmen auf die Liste A gesetzt, wenn sie eine bestimmte wirtschaftliche Größe hatten, unabhängig davon, ob ihre Eigentümer tatsächlich politisch belastet waren.65 Die Vertreter der SED und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) in den Kommissionen plädierten für eine scharfe Gangart, während die Vertreter der Christlich-Demokratischen Union und der Liberal Demokratischen Partei Deutschlands die Beschlagnahmungen begrenzen wollten. Es kam zu harten Auseinandersetzungen. Die SED-Führung genoss in der Frage der Enteignungen die volle Unterstützung der Besatzungsmacht und ließ sich von ihrem Kurs nicht abbringen. Daher blieben die Interventionen der bürgerlichen Parteien meist ohne Erfolg.
Die geplanten Enteignungen sollten mit einem Volksentscheid im hochindustrialisierten Land Sachsen legitimiert werden. Der sowjetische Diktator Stalin stimmte einem entsprechenden Vorschlag von Walter Ulbricht, dem Stellvertretenden Vorsitzenden der KPD/SED und eigentlichen starken Mann in der SBZ, Anfang Februar 1946 zu.66 Mit großem propagandistischem Aufwand wurde der Volksentscheid vorbereitet. Angesichts der Verheerungen des Kriegs und der Verstrickungen der Großindustrie (und auch von Teilen der mittelständischen Wirtschaft) in die nationalsozialistische Diktatur fand die Forderung nach der Bestrafung von Nazis und Kriegsverbrechern durchaus Resonanz in der Bevölkerung. Familienunternehmer und Handwerker lehnten den Volksentscheid überwiegend ab, so berichtete es das Landesnachrichtenamt der Landesregierung.67 Sie befürchteten zu Recht, wie sich später herausstellen sollte, dass der Volksentscheid nur den Auftakt zur völligen Ausschaltung des privaten Unternehmertums bilden würde. In Kreisen der sächsischen CDU wurde gemutmaßt, dass mit Nein Stimmenden eine „nazistische Haltung“ unterstellt werden könnte.
Auf betrieblicher Ebene regte sich Widerstand gegen die bevorstehende Enteignung. So setzten sich Crimmitschauer Bürger dafür ein, dass die Inhaber der Textilmaschinenfabrik Paul Trützschler & Gey nicht als „Kriegsverbrecher“ eingestuft werden. Ihr Betrieb sollte nicht enteignet werden.68 Die Sequesterkommission gab das Unternehmen an die Eigentümer zurück, doch ihre Entscheidung wurde 1949 von den staatlichen Stellen mit dem Vorwurf der „Wirtschaftsspionage“ rückgängig gemacht.
Blick in die Malerei-Abteilung der 1915 gegründeten Firma Wendt & Kühn, um 1936
Im Fall der Wendt & Kühn KG, Grünhainichen, eines 1915 von Margarete Wendt und Margarete Kühn gegründeten Betriebs, der Holzfiguren und Spieldosen in der Tradition des Erzgebirges fertigte, gelang es der Familie Wendt mit Unterstützung ihrer Beschäftigten, erfolgreich gegen die Enteignung zu protestieren. Otto Buchwitz, der sächsische SED-Landesvorsitzende und Mitglied der Landessequesterkommission, teilte der Familie fünf Tage vor dem Volksentscheid mit, dass ihr Unternehmen zwar zur Enteignung anstünde, aber in Privatbesitz bleiben solle, wohl auch um die Abwanderung nach Westdeutschland zu verhindern.69 Nur Johannes Wendt, der sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befand, wurde formal enteignet. Jedoch durfte Margarete Wendt den Anteil ihres Bruders zurückkaufen. Damit wahrte die Sequesterkommission den Schein: Wendt & Kühn blieb auf Liste A und wurde dennoch nicht enteignet.
Am 30. Juni 1946 stimmten fast 78 Prozent der Abstimmungsberechtigten in Sachsen für das Gesetz über die Enteignung von Kriegs- und Naziverbrechern.70 Mit Gerechtigkeit im Sinne der Feststellung individueller Schuld hatte der Volksentscheid wenig zu tun. Per Kollektivschuldthese wurden vor allem größere Unternehmen für die Unterstützung des nationalsozialistischen Regimes zur Verantwortung gezogen. In den anderen vier Ländern der SBZ gab es keine Volksentscheide zur Enteignung. Dort erließen die Landesregierungen entsprechende Verordnungen.
Die Sequestrierung war noch keine endgültige Konfiskation, sondern eine provisorische Unterbindung aller Zugriffsrechte der bisherigen Eigentümer auf ihr Betriebskapital. Die förmliche Enteignung erfolgte dann durch den am 17. April 1948 erlassenen Befehl Nr. 64 der SMAD, der zugleich die Beendigung der Sequesterverfahren anordnete.
Tabelle 2: Enteignete und in staatliches Eigentum überführte Betriebe in den einzelnen Ländern der SBZ (Stand 1948)
Land
Betriebe
Thüringen
2.606
Sachsen
2.297
Sachsen-Anhalt
2.064
Brandenburg
1.428
Mecklenburg
883
Insgesamt
9.281
Quelle: Fritz Selbmann: Volksbetriebe im Wirtschaftsplan, Berlin 1948, S. 12.
Allerdings war auch nach der Enteignung von fast 9.300 Betrieben kein Ende der Verstaatlichung von Betriebsvermögen abzusehen. In hunderten von Fällen war es den Kommissionen für Sequester nicht gelungen, die Verfahren zum Abschluss zu bringen. Um diese entbrannten in den Landesregierungen auch weiterhin heftige Konflikte zwischen der SED und führenden Politikern der LDPD und der CDU. Letztgenannte verlangten eine unverzügliche Rückgabe des Eigentums, wenn keinerlei Belastungsmaterial vorhanden war.71 Sie hatten aber nur selten Erfolg mit ihren Forderungen, zumal führende Köpfe der LDPD und der CDU von der Besatzungsmacht unter Druck gesetzt oder verhaftet wurden. Andere flohen noch rechtzeitig.
Auf die Großbetriebe, die als Reparationsleistung in sowjetische Aktiengesellschaften überführt wurden, ist bereits verwiesen worden. Die Besatzungsmacht beließ es dabei nicht, sondern griff in einigen Fällen zudem auf mittelständische Familienbetriebe zu. Dies betraf unter anderem die Akkumulatorenfabrik Friemann & Wolf in Zwickau. Das Unternehmen war 1884 als Maschinen- und Grubenlampenfabrik von Heinrich Friemann und Carl Wolf gegründet worden. Hauptprodukt war eine von Carl Wolf entwickelte Benzinsicherheitslampe für den Bergbau. Wie in SAG-Betrieben üblich, erhielt das Unternehmen einen sowjetischen Generaldirektor, dem die deutsche Betriebsleitung unterstellt wurde. Die Produkte des Werkes waren für den Steinkohlenbergbau und den 1947 in Sachsen begonnenen Uranerzbergbau unverzichtbar. Die Reparationsproduktion sicherte die Existenz des Werkes, führte allerdings zum Abschneiden aller Verbindungen zur Zweigstelle des Unternehmens in Duisburg. Wer dorthin noch Beziehungen unterhielt, wie der kaufmännische Direktor, wurde entlassen.72 Die Erben von Friemann und Wolf begannen mit dem Wiederaufbau des Unternehmens in der zerstörten Niederlassung in Duisburg.
Auch die ebenfalls in Zwickau ansässige Chemische Fabrik Louis Blumer war für die Besatzungsmacht von besonderem Interesse, da sie über internationale Reputation bei der Entwicklung von Kunststoffen und der Herstellung von biegsamen Metallschläuchen für Presslufthämmer verfügte.73 Das Familienunternehmen wurde ebenfalls in sowjetischen Besitz überführt.74
Im Zuge einer Absenkung der sowjetischen Reparationsforderungen wurden die Akkumulatorenfabrik Friemann & Wolf und die Chemische Fabrik Louis Blumer zum 1. April 1952 an die DDR übergeben. Friemann & Wolf benannte man in Volkseigener Betrieb (VEB) Grubenlampenwerke Zwickau um und die Chemische Fabrik Louis Blumer wurde zum VEB Lackkunstharz- und Lackfabrik Zwickau.