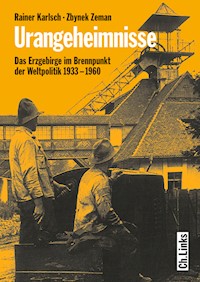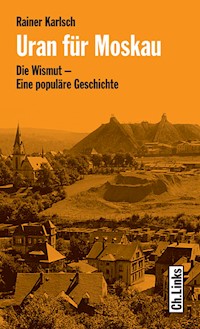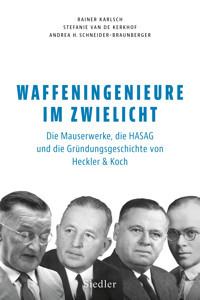32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die erste wissenschaftlich fundierte Geschichte von adidas
adidas ist eine Weltmarke – nicht nur zählt das Unternehmen zu den global größten Sportartikelherstellern, um adidas ranken sich auch viele Legenden. Jetzt ist die fast 100-jährige Geschichte zum ersten Mal wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Ausgehend von dem Werdegang des Vorgängerunternehmens der Gebrüder Dassler in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus widmet sich das vorliegende Buch vor allem der Geschichte der Familie und der Unternehmensorganisation seit der offiziellen Gründung 1949. Dabei behandeln die Autoren auch die Markenstrategien und die Internationalisierung seit den sechziger Jahren, als sich adidas unter anderem in Osteuropa und DDR engagierte. Ein besonderer Blick auf den Aufstieg eines Weltunternehmens – und ein faszinierendes Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte.
- 2019: 70 Jahre Adidas
- Die erste Darstellung der Unternehmensgeschichte auf breiter Quellenbasis
- Mit vielen vierfarbigen Abbildungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Ähnliche
Rainer Karlsch
Christian Kleinschmidt
Jörg Lesczenski
Anne Sudrow
UNTERNEHMEN SPORT
Die Geschichte von adidas
In Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte
www.unternehmensgeschichte.de
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage Oktober 2018
Copyright © 2018 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung unter Verwendung einer Fotografie
von The adidas Archive (aD I-17017)
Lithografie: Lorenz & Zeller, Inning a. Ammersee
Gestaltung und Produktion: bookwise GmbH, München
eISBN 978-3-641-23703-5V001
www.siedler-verlag.de
INHALT
1Einleitung
2Das Unternehmen Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler. Von der Gründung bis zum Ende von Nationalsozialismus und Entnazifizierung (1919 bis 1948)
2.1Gründung des Unternehmens in den Traditionen der Schuhherstellung und des Sports in Herzogenaurach
2.2Die „Ära Waitzer“: Sportliche Großereignisse, die Entwicklung des Produkts Sportschuh und die Zusammenarbeit mit staatlichen Organisationen
2.3Verhältnis zum Nationalsozialismus und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens nach 1933
2.4Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin
2.5Sportartikelproduktion im Krieg (1939 bis 1944)
2.6Rüstungsgüterproduktion als Unterlieferant der Firma Schricker & Co. (Oktober 1943 bis Mai 1945)
2.7Bruderzwist: Beginn und Verlauf des Konflikts (1940 bis 1948)
2.8Nachkriegswirtschaft, Treuhandschaft und Entnazifizierung
3Das andere „Wunder von Bern“. Der Aufstieg von adidas und markenorientierte Unternehmensführung nach dem Zweiten Weltkrieg
3.1Neugründung und Markenfindung
3.2Sportliche Großereignisse und familiäre Markenführung – das „System Adi Dassler“
3.3Medialisierung, Professionalisierung, Kommerzialisierung
3.4Internationalisierung und Diversifikation
3.5Selbstsicherheit und defizitäre Markenstrategie
4Vom Familienunternehmen zur Aktiengesellschaft (1948 bis 1995)
4.1Unternehmen und Familie bis zum Tod Adi Dasslers (1948/49 bis 1978)
4.2Die Ära Käthe und Horst Dassler. Der lange Abschied vom Familienunternehmen (1978 bis 1987)
4.3Auf dem Weg in die Aktiengesellschaft (1987 bis 1989/90)
4.4Unruhige Jahre. adidas als Spielball von Investoren und zerstrittenen Familienzweigen. Von Bernard Tapie zu Robert Louis-Dreyfus (1989/90 bis 1995)
4.5Fazit
5Wandel durch Handel. Die „Ostverträge“ von adidas
5.1Osteuropäische Werbeikonen im Kalten Krieg
5.2Promotion-Verträge mit osteuropäischen Verbänden und Vereinen
5.3Die Promotion-Verträge mit dem DTSB
5.4Lohn- und Lizenzproduktionen in Jugoslawien und im Ostblock
5.5Produktionsstandort DDR?
5.6adidas und das Ende des Ostblocks
5.7Fazit
6Von der Marken- zur Marketingorientierung
6.1Übergangsphase und neue Herausforderungen
6.2Vom Produktmarketing zum globalen Sportmarketing
6.3„Wiedergeburt“ der Marke adidas
7Fazit
Anmerkungen
Quellenverzeichnis – Archive
Bildnachweis
Personenregister
Firmenregister/Institutionenregister
EINLEITUNG
CHRISTIAN KLEINSCHMIDT, JÖRG LESCZENSKI, RAINER KARLSCH
Was für ein Unternehmen ist adidas? Was zeichnet adidas und seine Geschichte aus? Und welches sind die zentralen Entwicklungslinien einer fast 100jährigen Historie – von der Gründung als kleiner Familienbetrieb der Gebrüder Dassler in den 1920er Jahren bis zum global agierenden Sportartikelkonzern im 21. Jahrhundert? Dass ein Unternehmen über einen so langen Zeitraum erfolgreich am Markt existiert, dass es die Herausforderungen unterschiedlicher politischer Systeme, ökonomischer Wechsellagen sowie sich wandelnder familiärer und organisatorischer Konstellationen erfolgreich meistert, ist eher die Ausnahme als die Regel. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe spricht daher auch von der „Unwahrscheinlichkeit des Jubiläums“, wobei theoretisch davon auszugehen sei, „dass Unternehmen periodisch in existenzielle Krisen geraten, ihr dauerhaftes Überleben also gerade nicht gesichert ist“.1 Tatsächlich trifft dies auch auf adidas und sein Vorläuferunternehmen zu. Es gab solche Krisen zur Zeit des Nationalsozialismus, bedingt durch Rohstoffknappheiten und Produktionsstillegungen, es gab sie aufgrund familiärer Streitigkeiten, die noch während der letzten Kriegsjahre in Pläne zur Aufspaltung der Firma der Gebrüder Dassler mündeten, was wiederum die Geschichte der Nachfolgeunternehmen über Jahrzehnte prägen sollte. Es gab krisenhafte Entwicklungen, bedingt durch neue Herausforderungen und Konkurrenten auf zunehmend internationalen und globalen Märkten, verstärkt durch familiäre Streitigkeiten sowie den Wandel von Rechtsformen, die Ende der 80er Jahre fast zur Insolvenz des Unternehmens geführt hätten. Heute wissen wir, dass adidas diese Herausforderungen und Krisen – und damit die „Unwahrscheinlichkeit des Jubiläums“ erfolgreich gemeistert hat. Es kann im Jahr 2019 tatsächlich ein solches Jubiläum als einer der weltweit erfolgreichsten Sportartikelhersteller feiern.
Heute ist adidas eines der bekanntesten deutschen Unternehmen und der zweitgrößte Sportartikelproduzent weltweit. Mit dem Markenzeichen seiner Kernmarke, den „Drei Streifen“, zählt es zu den wertvollsten Bekleidungsmarken. Als global agierendes Unternehmen mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern der Erde erzielt adidas einen jährlichen Umsatz von ca. 21,2 Mrd. Euro (2017). Zum Markenportfolio zählt dabei neben adidas, das sich als „globale Marke mit deutschen Wurzeln versteht“, auch Reebok.
Untrennbar verbunden ist die Historie von adidas mit der Geschichte des Sports und seiner im Laufe des 20. Jahrhunderts stetig gewachsenen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Bedeutung. Es gibt kaum ein sportliches Großereignis, ob Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften, bei dem adidas nicht als Ausrüster der erfolgreichsten Sportler präsent ist. Dabei blickt das Unternehmen auf eine lange Tradition zurück, die sich bis in die Zeit der adidas-Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg sowie auf das Vorgängerunternehmen der Gebrüder Dassler in den 20er Jahren zurückverfolgen lässt. Ein zentrales Unternehmensziel besteht seit jeher darin, das „beste Sportartikelunternehmen der Welt zu werden“.2 Während dieses Ziel in der Gründungsphase, mit Blick auf den damals vornehmlich deutschen Markt und einer überschaubaren Anzahl an Wettbewerbern, noch relativ einfach zu erzielen war, wuchsen in Zeiten der Internationalisierung seit den 60er/70er Jahren und des globalen Wettbewerbs seit den 80er Jahren die Herausforderungen, denen sich adidas zu stellen hatte. Das betraf nicht allein die quantitative Entwicklung des Unternehmens, die durch Unternehmenswachstum mit steigenden Umsätzen und Beschäftigungszahlen gekennzeichnet war; daneben wuchs auch der Anspruch an ein nachhaltiges Wachstum sowie eine „Corporate Governance“ im Sinne einer guten Unternehmensführung unter Berücksichtigung rechtlicher Grundlagen und umfangreicher Sozial- und Umweltaspekte.3 Das Ziel, ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Unternehmen zu sein, besteht heutzutage für adidas darin, „das Gleichgewicht zwischen den Interessen unserer Aktionäre auf der einen Seite sowie den Bedürfnissen und Anliegen unserer Mitarbeiter, der Beschäftigten in unserer Beschaffungskette und der Umwelt auf der anderen Seite aufrechtzuerhalten“.4 Diese hohen Ansprüche, die adidas als global agierendes Unternehmen an sich selbst stellt, dienen auch einer kritischen medialen Öffentlichkeit als Maßstab. adidas steht damit unter permanenter Beobachtung und ist Gegenstand öffentlicher Wahrnehmung, Kommunikation und Diskussion. Das betrifft in jüngster Zeit etwa den Wechsel an der Unternehmensspitze von Herbert Hainer zu Kasper Rorsted, die gute Performance der adidas-Aktie, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren, neue und innovative Produkte, die Beziehung zu den Konkurrenten Puma und Nike, aber auch Fragen von Produktionsbedingungen in Ländern der „Dritten Welt“ oder Verstrickungen ehemaliger Mitarbeiter in Skandale um die FIFA und den DFB. Diese Entwicklungen beziehen sich auf Zeiträume, die teilweise mehrere Jahrzehnte zurückreichen und damit historische Dimensionen annehmen.
1 Adi Dassler im Mannschaftsquartier bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Bern 1954
Im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung
Hinzu kommt, dass adidas zahlreiche Anfragen erhält, die die Geschichte und Tradition des Unternehmens betreffen – so etwa zur Entwicklung der Firma Gebrüder Dassler während der Zeit des Nationalsozialismus und den damit verbundenen Fragen zu Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit, zur adidas-Produktion in der ehemaligen DDR, zur Rolle einzelner Familienmitglieder sowie zur Unternehmensorganisation und Markenentwicklung.
Häufig beziehen sich entsprechende Anfragen auf Presseberichte. In Zusammenhang mit der zeitweiligen Umstellung der Produktion auf Rüstungsgüter während des Zweiten Weltkriegs berichtete z.B. Spiegel Online im Jahr 2009 über einen „Panzerschreck aus dem Hause Dassler“ bzw. über „Waffen made by Dassler“, die vor allem gegen Ende des Krieges zum Einsatz kamen.5 Dieses Beispiel zeigt die Folgen einer verkürzten und verzerrten journalistischen Darstellung. Es entstand der Eindruck, als ob diese Waffe von der Firma Gebrüder Dassler produziert wurde. Tatsächlich wurden „Raketen-Panzerbüchsen“, im Volksmund „Panzerschreck“ genannt, von dem Unternehmen Schricker & Co. aus Vach hergestellt,6 das wiederum Maschinen zur Bearbeitung bestimmter Fertigungsteile dieser Waffe an die Firma der Gebrüder Dassler auslieh. Die vereinfachte Darstellung in diesem Pressebericht ging somit auf Kosten der historischen Genauigkeit. Zweifellos war das Unternehmen der Dasslers damals in die Rüstungsproduktion involviert und stellte u.a. Spezialschuhe für die Wehrmacht her. Aber es bedeutet schließlich einen qualitativen Unterschied, ob ein Schuhhersteller komplette Waffen produziert oder lediglich als Teilezulieferer fungiert.
2014 berichteten sowohl das Handelsblatt als auch Zeit Online in identischen Artikeln über die „Erfinder der modernen Sportkorruption“, wobei sich der Autor vor allem auf die Person Horst Dasslers bezog. Ähnliche Artikel waren bereits 30 Jahre zuvor erschienen, damals hatten Der Spiegel wie auch die Zeitschrift Stern auf die Bedeutung Horst Dasslers für die Kommerzialisierung und den Einzug der Korruption im Sport verwiesen.7 Der Artikel aus dem Jahr 2014 ging zudem davon aus, dass „Dasslers Spuren bis heute sichtbar [sind]“.8 Das bezog sich auf Horst Dasslers mittelbaren Nachfolger Robert Louis-Dreyfus und dessen Geschäfte mit Uli Hoeneß sowie auf den Verdacht, die Austragung der Fußball-WM 2006 in Deutschland „gekauft zu haben“,9 was wiederum auf die undurchsichtige Rolle der FIFA in diesem Zusammenhang verwies. Darüber hinaus wurden „heikle Andeutungen“ des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger zu den Beziehungen zwischen adidas und dem DFB zitiert.
Für große öffentliche Aufmerksamkeit sorgte schließlich auch die Ausstrahlung zweier Fernsehfilme über die beiden Dassler-Brüder Rudolf und Adi, der eine 2016 im Privatsender RTL, der andere ein Jahr später in der ARD. Dabei handelte es sich nicht um Dokumentationen, sondern um Spielfilme mit fiktionalen Elementen. Häufig diskutierte Themen wie etwa das Verhalten von Adi Dasslers Frau Käthe als angeblich treibende Kraft des Bruderstreits (RTL-Produktion), die Bedeutung der Schraubstollen-Erfindung für die Weltmeisterschaft 1954 oder die Rolle einzelner Familienmitglieder im Rahmen der Unternehmensorganisation werden darin in einer Weise aufgegriffen, die sich nicht durch ein hohes Maß an historischer Genauigkeit auszeichnet, gleichwohl aber bis heute prägend ist für das Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit.
Diese immer wiederkehrenden Darstellungen und die damit verbundenen Anfragen an das Unternehmen stellten wesentliche Motive für die vorliegende Publikation dar – mit der Zielsetzung einer historisch-kritischen Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte von den Anfängen bis in die jüngste Zeit. In den entsprechenden Beiträgen zu den ausgewählten Schwerpunktthemen werden gleichzeitig zentrale Aspekte der adidas-Unternehmensgeschichte behandelt. Die Konzentration auf bestimmte Themen bedeutet jedoch zugleich, mit diesem Buch keine vollständige adidas-Unternehmensgeschichte vorzulegen. Dies hätte erfordert, weitere Aspekte wie etwa die Entwicklung der Belegschaften, industrielle Beziehungen, die betriebliche Sozialpolitik sowie Fragen der Unternehmensfinanzierung und Unternehmenskultur zu berücksichtigen. Diese standen jedoch zum einen nicht im Fokus des Interesses, zum anderen fehlten teilweise entsprechende Quellenüberlieferungen. Darin liegen auch die Gründe für eine Begrenzung des Untersuchungszeitraums. Zeitlich endet diese Studie 2001. Dieses Jahr stellt für die adidas-Unternehmensgeschichte eine Zäsur dar: Mit der Amtsübernahme des Vorstandsvorsitzender Herbert Hainer begann eine neue Ära und eine alte, die wir thesenartig als die „Ära Horst Dassler“ kennzeichnen, endete. Zwar war Horst Dassler, der Sohn des Firmengründers Adi Dassler, bereits im Jahr 1987 verstorben, seine Art der Unternehmensführung prägte jedoch die Entwicklung von adidas bis zum Ende des Jahrtausends. Die Zeit ab 2001, insbesondere die aktuell diskutierten Fragen rund um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2006 inklusive der involvierten Personen, lässt sich aufgrund laufender juristischer Verfahren derzeit nicht im Sinne unseres Anspruchs einer historisch-kritischen Aufarbeitung darstellen; schließlich sind die entsprechenden Akten in zentralen Archiven wie dem DFB- oder dem FIFA-Archiv nicht zugänglich. Presseartikel dazu gibt es zwar in großem Umfang, der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und damit auf Nachprüfbarkeit der Quellen und Materialien sowie neue, über den bisherigen Sachstand hinausreichende Informationen können vor dem Hintergrund fehlender Quellen aus wichtigen Archiven zurzeit jedoch nicht gewährleistet werden.
Auch hinsichtlich weiter zurückliegender Geschehnisse der adidas-Geschichte und deren Darstellung in Presseveröffentlichungen, Fernsehbeiträgen und Diskussionen wurde zweierlei deutlich:
1. Die Geschichte von adidas (und Puma) erregt nach wie vor die Öffentlichkeit und reizt zu kontroversen Diskussionen.
2. Die Grundlagen dieser Diskussionen beruhen in vielen Fällen auf Spekulationen und Behauptungen, es gibt wenig fundierte und gesicherte, d.h. wissenschaftlich basierte, systematisch erfasste und quellengestützte Informationen über die Geschichte von adidas.
Kritische Betrachtung bisheriger Publikationen
Das Unternehmen selbst weiß wenig über sich und seine Geschichte, nicht zuletzt deshalb, weil es bis vor Kurzem über kein institutionalisiertes Gedächtnis, sprich ein Unternehmensarchiv, verfügte – und weil bislang keine unmittelbar aus den Quellen rekonstruierte Unternehmensgeschichte von adidas existiert.10 Zwar gibt es einen umfangreichen Wissensfundus im Unternehmen, etwa in Form langjähriger sowie auch ehemaliger Mitarbeiter, bislang verstreuter Aktenbestände, umfangreicher Produktsammlungen und einer firmeninternen Ausstellung – die bereits publizierte Literatur weist bezüglich verifizierbarer historischer Quellen jedoch erhebliche Lücken auf. Es existieren nur sehr wenige wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte von adidas, wie etwa jüngst ein Text zur Erfolgsgeschichte des Schuhmodells „Superstar“11 sowie eine Abhandlung über adidas-Kontakte in die DDR.12 Es ist generell erstaunlich, dass ein derart bedeutendes gesellschaftliches und ökonomisches Phänomen wie der Sport bislang in der Geschichtsschreibung so wenig präsent ist. Das gilt insbesondere für die wirtschafts- und unternehmenshistorische Perspektive. Bei den von adidas in diesem Zusammenhang selbst herausgegebenen Publikationen handelt es sich in erster Linie um Bildbände, die mit Blick auf Großsportereignisse die adidas-Produkte in den Mittelpunkt stellen.13 Journalistisch-populäre Darstellungen widmen sich vor allem den zentralen Unternehmerpersönlichkeiten Adi Dassler und seinem Sohn Horst. Das Buch Adi Dassler von Wilfried Geldner erzählt in knappen Kapiteln schlaglichtartig die Erfolgsgeschichte des Unternehmensgründers und die Entwicklung des Unternehmens bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nach.14 Geldner stützt sich dabei u. a. auf das Buch Making a Difference sowie auf eine Biografie über Horst Dassler, die von Paulheinz Grupe im Jahr 1972 verfasst wurde und in überarbeiteter Form 1992 erschien.15 Grupe widmet sich der Person Horst Dassler und seiner Familie; insbesondere geht er dabei auf die Entwicklung von adidas France ein sowie auf Horst Dasslers Bedeutung für die internationale Vernetzung, die Kommerzialisierung und Professionalisierung des Unternehmens adidas. Woher Grupe seine Informationen bezogen hat, bleibt unklar. Im Nachwort erwähnt er „unzählige Dokumente, Berichte, Gespräche, Interviews und andere Zeugnisse […]“,16 ohne diese genauer zu benennen.
In seiner Sneaker-Story schildert Christoph Bieber den „Zweikampf von adidas und Nike“ als spannende Geschichte zwischen „Air Jordan“ und „Predator“ und widmet sich der Markeninszenierung der „Drei Streifen“ und des „Swoosh“ im Umfeld von „Jugend, Pop, Kultur“.17 Als Informationsgrundlage dienen ihm u.a. das Buch von Geldner und andere populäre Darstellungen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie journalistische Literatur über sportliche Großereignisse wie den FIFA World Cup oder die Olympischen Spiele, in denen auch adidas Erwähnung findet. Dabei handelt es sich oftmals um Publikationen, die im weiteren Sinne dem Genre des investigativen Journalismus zuzuordnen sind und die – im Unterschied zu bebilderten Hochglanzpublikationen oder personenorientierten Biografien und Erfolgsgeschichten – auch und insbesondere kritische Töne anschlagen. Stellvertretend seien hier etwa die Bücher des britischen Journalisten und Dozenten an der University of Brighton, Andrew Jennings, zum Olympiakartell18 oder von Thomas Kistner über die FIFA MAFIA sowie den Olympischen Sumpf angesprochen.19 Charakteristisch für diese Bücher sind nicht nur ihre reißerischen Titel und eine flotte Schreibweise, die sich offenbar an ein Massenpublikum richtet,20 sondern teilweise auch fehlende Belege oder eine äußerst eingeschränkte Material- und Informationsbasis aus zweiter Hand, die sich ihrerseits auf bereits publizierte Literatur oder auf Presseartikel stützt.21
Dies gilt im Übrigen auch für die bislang umfangreichste Darstellung über adidas (und Puma), die von der Journalistin Barbara Smit stammt. In ihrem Buch Drei Streifen gegen Puma aus dem Jahr 2005, das 2017 in zweiter Auflage erschienen ist, zeichnet sie den Kampf der beiden „verfeindeten Brüder um die Weltmarktführerschaft“ nach. Für das Buch habe die Autorin, so der Klappentext, „fünf Jahre recherchiert, internationale Archive durchforstet“ sowie „exklusive Gespräche mit Mitarbeitern, Managern sowie Familienmitgliedern geführt“.22 Tatsächlich finden sich im Anhang vereinzelt Verweise auf das Bundesarchiv und das Staatsarchiv Nürnberg sowie einige wenige Hinweise auf Briefwechsel, Presseerklärungen und hausinterne Publikationen (adidas-Magazin). Originäres adidas-Quellenmaterial, Akten oder gedruckte Quellen konnte die Autorin nicht auswerten, da der Aufbau des adidas-Archivs erst 2009/10, derjenige des Stiftungsarchivs der Adi & Käthe Dassler Memorial Stiftung erst 2011 begann. Smit stützt sich, wie angegeben, vor allem auf „Gespräche“, Briefwechsel und Telefonate, die – methodisch betrachtet – zunächst nur als subjektive Quellen gelten können, welche in erster Linie die Meinung und Einschätzung der Befragten wiedergeben und damit keinen wissenschaftlichen, intersubjektiv überprüfbaren Aussagen entsprechen. Das ist durchaus legitim und soll auch die Leistung Smits nicht schmälern, die hier umfangreiche Informationen zusammengestellt hat und interessante Einblicke in zwei Unternehmen gewährt, wobei sie sich vor allem mit „familiären Intrigen, dubiosen Korruptionsgeschäften und finsteren Rückschlägen“ auseinandersetzt.23 Methodisch fragwürdig ist es jedoch, wenn die Interviews sich aufgrund des Fehlens von Anmerkungen keinen Textstellen zuordnen lassen und damit der Eindruck entsteht, als beruhe der Text auf Tatsachen.24 Eine solche Vorgehensweise entspricht nicht der wissenschaftlichen anerkannten Methode der „Oral History“, bei der mündliche historische Quellen, zumeist in Interviewform, durch zugängliche Aufzeichnungen nachprüfbar gemacht werden. Bei Smits Buch handelt es sich also um einen journalistischen Text, der durchaus informationsgesättigt ist und dessen Inhalte meist plausibel klingen – es ist nicht zu unterstellen, dass die Informationen bewusst falsch oder verfälschend sind. Für Dritte nachprüfbar und damit wissenschaftlichen Ansprüchen genügend sind sie allerdings nicht.
Das gilt sogar für einen Text, der sich als „case study“ der Harvard Business School mit Horst Dasslers Kommerzialisierungsstrategien bei adidas auseinandersetzt. Dieser beruht zu großen Teilen auf Smits Buch und bietet keinerlei eigenständige Forschungen.25 So wird deutlich, dass unterschiedliche Autoren sich jeweils aufeinander beziehen und dabei ungesicherte und nicht nachprüfbare Informationen weitergeben. Wo jedoch nachprüfbare und gesicherte Informationen fehlen, sind Mythenbildungen, Spekulationen und Gerüchten Tür und Tor geöffnet. Und solche gibt es im Falle von adidas, das zeigen die bisherigen Publikationen und öffentliche Medienbeiträge, zu Genüge.
Historische Forschung und Quellenlage
Es war allerdings nicht in erster Linie unsere Zielsetzung, eine „Anti-Mythen-Publikation“ zu verfassen und gegen die bisherige, journalistisch dominierte Literatur anzuschreiben. Unser Ziel war ein positives, nämlich die erste wissenschaftliche sowie quellengestützte und damit nachprüfbare und transparente Geschichte des Unternehmens adidas zu verfassen. Dabei geht es allerdings nicht um eine Gesamtgeschichte des Unternehmens, die nicht zuletzt aufgrund der lückenhaften Quellenlage zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht darstellbar ist. Hauptgegenstand unserer Untersuchung sind Themenschwerpunkte, die sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch mit Blick auf aktuelle Forschungsfragen vor dem Hintergrund der vorhandenen Quellenüberlieferung von Interesse sind. Das betrifft im Einzelnen die Gründungsphase des Unternehmens, die Zeit des Nationalsozialismus, die unmittelbare Nachkriegszeit, die Familien- und Organisationsgeschichte von adidas, die Beziehungen zur DDR und zum „Ostblock“ während des Kalten Krieges sowie die Marke und die markenorientierte Unternehmensführung.
Den Anlass zu dieser Studie boten dabei weniger die bisherigen Publikationen als vielmehr die erwähnten zahlreichen Anfragen einer interessierten Öffentlichkeit an die adidas-Abteilung „History Management“ in den letzten Jahren, die nicht nur wegen der beschriebenen Problematik in der bisherigen Literatur, sondern auch aufgrund fehlender archivalischer Überlieferung bislang nur unvollständig beantwortet werden konnten. Zudem bestand die wissenschaftliche Herausforderung, eine Lücke auf dem Gebiet der Unternehmensgeschichte des Sports zu schließen.
Ein adidas-Archiv im klassischen Sinne existierte bislang nicht. Ein erstes sogenanntes Archiv war zwar 1998 gegründet worden, es bestand im Wesentlichen jedoch zunächst aus einer umfangreichen Schuhsammlung. Ab 2009 wurden dann auch Schriftquellen gesammelt, die seit 2012 im „The adidas Archive“ aufbewahrt und ständig ergänzt werden.26 Die Entscheidung für eine wissenschaftliche adidas-Unternehmensgeschichte fiel schließlich im Jahr 2014. In Kooperation mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte wurde ein Autorenteam zur Erforschung der adidas-Unternehmensgeschichte zusammengestellt und zugleich der Ausbau des Archivs in Angriff genommen. Beides verlief Hand in Hand. Für die Bearbeiter bedeutete dies, neu akquirierte Quellenbestände noch vor der Verzeichnung einsehen und bearbeiten zu können. Dies galt sowohl für Bestände aus unterschiedlichen adidas-Abteilungen in Herzogenaurach als auch für die erst in jüngster Zeit erschlossenen Akten der ehemaligen Tochtergesellschaft adidas France, die ohne den Umweg über die adidas-Mitarbeiter direkt den Autoren zugänglich gemacht wurden. Aktenerschließung und Manuskripterstellung erfolgten auf diese Weise „just-in-time“. Das setzte bei allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität, aber auch an Vertrauen und Offenheit voraus.
Allein auf der Basis der adidas-Archivbestände hätte jedoch die vorliegende Publikation nicht geschrieben werden können. Wichtige Informationen stammen aus dem Bundesarchiv sowie der „Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR“ (Stasi-Unterlagenbehörde), aus Staats- und Regionalarchiven, aus dem Archiv des IOC sowie einige wenige Dokumente aus dem Unternehmensarchiv von Puma. Dafür möchten wir uns ebenso bedanken wie für den teilweisen Zugang zu Materialien der Adi & Käthe Dassler Memorial Stiftung in Vaduz. Mündliche Quellen, beispielsweise in Form von aktuell oder vor längerer Zeit geführten und aufgezeichneten Interviews, wurden von uns ebenfalls berücksichtigt, haben aber einen eher ergänzenden Charakter und wurden im Text sparsam verwendet.
2 adidas Firmenzentrale in Herzogenaurach (Mitte der 80er Jahre)
Thematische Schwerpunktsetzung
Die thematische Bearbeitung dieser adidas-Geschichte beginnt mit der Gründungsphase des Unternehmens der Gebrüder Dassler nach dem Ersten Weltkrieg und verfolgt diese bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. zur Besatzungszeit. Dabei wird der Zeit des Nationalsozialismus und der Kriegswirtschaft große Aufmerksamkeit geschenkt. Zwar existieren heutzutage zahlreiche Arbeiten zur Geschichte von Unternehmen während des Nationalsozialismus, dabei stehen jedoch zumeist Großunternehmen im Mittelpunkt. Anne Sudrow widmet sich mit ihrem Beitrag über adidas einem mittelgroßen Unternehmen, welches auch zur Zeit der Umstellung auf Rüstungsproduktion nicht mehr als 100 Beschäftigte hatte. Ihr Interesse richtet sich dabei nicht allein auf die personelle und produktionstechnische Ausrichtung des Unternehmens der Gebrüder Dassler auf das NS-Regime und die Kriegswirtschaft, sondern auch auf die unmittelbare Nachkriegszeit, die Wiederaufnahme der Produktion, die Entnazifizierung, die Umstellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft sowie auf die Teilung des Unternehmens.
adidas war in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ein Familienunternehmen mit Adi Dassler an der Spitze sowie „mithelfenden Familienangehörigen“, seiner Frau Käthe sowie seinen Kindern, die unterschiedliche Funktionen im Unternehmen bekleideten. Das rasche Wachstum des Unternehmens seit den 50er/60er Jahren, die zunehmende Ausdifferenzierung der Organisationsstruktur sowie das wachsende Ungleichgewicht zwischen den unternehmensstrategischen Herausforderungen und den Kapazitäten der Familie, so zeigt Jörg Lesczenski, führten schließlich zu einer Änderung der Rechtsform und zur Gründung einer Aktiengesellschaft. Der lange Weg vom Familienunternehmen zum Unternehmen ohne Familie, der sich seit dem Tod von Adi Dassler 1978 langsam abzeichnete, wurde durch zahlreiche Streitigkeiten zwischen den Familienzweigen maßgeblich beeinflusst. Die Jahre vor, aber auch die Zeit nach der AG-Gründung brachten schmerzhafte Anpassungsprozesse in der Familie sowie im Unternehmen mit sich, die bis in die 90er Jahre hinein zu familieninternen Auseinandersetzungen und im Zuge der organisatorischen Neugestaltung zu komplizierten Beteiligungsverhältnissen führten. Diese veränderten sich überdies in kurzer Taktfolge – mit entsprechenden Auswirkungen auf den Erfolg bzw. Misserfolg des Unternehmens.
adidas war seit den 50er Jahren ein global agierendes Unternehmen. In Zeiten des Kalten Krieges, der sich auch im Bereich des Sports widerspiegelte, betraf dies auch das Verhältnis zur DDR sowie zum gesamten „Ostblock“. Der „Ostpolitik“ von adidas geht Rainer Karlsch in seinem Beitrag nach. Trotz erheblicher politischer Restriktionen waren viele westliche Unternehmen unterschiedlicher Branchen an Handelsbeziehungen mit den sozialistischen Ländern interessiert, und einige Unternehmen ließen in osteuropäischen Staaten produzieren. Eine größere Bedeutung als Produktionsstandorte für adidas erlangten zunächst Jugoslawien und Ungarn und seit Ende der 70er sogar die Sowjetunion. Das sowjetische Außenhandelsunternehmen LIT und mehrere jugoslawische Betriebe gehörten zeitweilig zu den umsatzstärksten Lizenznehmern. Die Bemühungen von adidas, auch mit DDR-Betrieben Lohn- und Lizenzverträge abzuschließen, blieben hingegen erfolglos. Daher stellt sich die erst seit einigen Jahren medial aufgeworfene Frage nach Häftlingsarbeit in der DDR zwar für andere westliche Firmen, aber nicht für adidas.27
Für das weltweite Marketing von adidas war der Abschluss von Ausrüstungs- und Promotion-Verträgen mit Sportverbänden und Vereinen des Ostblocks wichtig, zumal diese in vielen Sportarten dominierten. Die Führung des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) der DDR sträubte sich länger als alle anderen Sportverbände des Ostblocks gegen die Kommerzialisierung, schwenkte aber 1982 unter dem Eindruck wachsender wirtschaftlicher Probleme um. Nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges boten sich adidas neue Chancen in Osteuropa, zumal das Unternehmen auf seinen Nimbus als „first mover“ aufbauen konnte.
Gerahmt werden die Beiträge der vorliegenden Publikation durch Abhandlungen von Christian Kleinschmidt, der sich mit der Entwicklung der Marke, den Werbe- und Marketingstrategien von adidas sowie Fragen der Professionalisierung und Kommerzialisierung auseinandersetzt. Im letzten Geschäftsbericht unter dem Vorstandsvorsitzenden Herbert Hainer aus dem Jahr 2015 betont dieser mit Blick auf die zukünftigen Ziele des Unternehmens den neuen Geschäftsplan „Creating the New“. Die Strategie des Unternehmens ziele vor allem darauf ab, „die Begehrlichkeit unserer Marken deutlich zu erhöhen und damit unser Wachstum bis 2020 zu beschleunigen. […] Im Rahmen der Maxime ‚Brands First‘ stehen nun die Marken an allererster Stelle“.28 Im Grunde genommen begleitete diese Strategie das Unternehmen von Beginn an. Die große Bedeutung der Marke zeigte sich schon bei der Unternehmensgründung nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Markenpolitik und Markenstrategien sind für Unternehmen nichts ungewöhnliches, und zahlreiche Unternehmen waren nach 1945 bestrebt, mithilfe ihrer Marken und Markenprodukte an ihre erfolgreiche Vorkriegsentwicklung anzuknüpfen. Dabei handelte es sich allerdings zumeist um Großunternehmen, die mit ihrer Markenpolitik auf Kontinuität im Wiederaufbau setzen konnten. Für ein kleines Unternehmen wie adidas mit vier Dutzend Beschäftigten Ende der 40er Jahre war dies allerdings eher ungewöhnlich und ist wohl vor allem mit der besonderen Konkurrenzsituation zu Puma zu erklären, die ein Abgrenzungs- und Identifikationsmerkmal zur Behauptung am Markt dringend erforderlich machte.
Wir hoffen, mit den Schwerpunktsetzungen der vorliegenden Publikation einen Grundstein für eine wissenschaftliche Geschichte von adidas zu legen, der zugleich einen Beitrag leistet für die bislang wenig erforschte Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte des Sports und Anregungen für weitere Forschungen gibt, die dann auch im Rahmen eines neu errichteten Unternehmensarchivs erfolgen können.
Dank
Unser besonderer Dank geht an Michael Bermejo-Wenzel und an Sandra Trapp von der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte. Herr Bermejo-Wenzel hat in zahlreichen Archiven im In- und Ausland wichtige Recherchen durchgeführt, die von zentraler Bedeutung für die einzelnen Themenbereiche der Darstellung sind. Frau Trapp hat entsprechende Recherchen im adidas Archiv getätigt und den permantenten Neuzugang von Archivmaterial für uns nutzbar gemacht. Beide haben sich in diesem Zusammenhang Kenntnisse über die adidas-Geschichte angeeignet, die wiederum für uns eine große Hilfe waren. Ohne diese Arbeit hätte das Buch in der vorliegenden Form nicht entstehen können. Ein herzlicher Dank geht schließlich auch an Tilman Pflock für ein umsichtiges und kompetentes Lektorat.
DAS UNTERNEHMEN SPÜRTSCHUH-FABRIK GEBRÜDER DASSLER. VÜN DER GRÜNDUNG BIS ZUM ENDE VON NATIONALSOZIALISMUS UND ENTNAZIFIZIERUNG (1919 BIS 1948)
ANNE SUDROW
2.1 Gründung des Unternehmens in den Traditionen der Schuhherstellung und des Sports in Herzogenaurach
Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
Die Gründung der Schuhfabrik Gebrüder Dassler fand in einer politisch und wirtschaftlich sehr bewegten Zeit statt. Der Erste Weltkrieg endete für Bayern, wie für das übrige Deutschland, in einer Revolution gegen die alte Regierungsform und gipfelte schließlich im Bürgerkrieg zwischen demokratischen und anti-demokratischen Kräften. Im November 1918 wurde in der bayerischen Hauptstadt die Monarchie abgeschafft. Der neue Ministerpräsident Kurt Eisner erklärte Bayern zum Freistaat. Im Januar 1919 fanden die ersten freien und demokratischen Wahlen für den bayerischen Landtag statt. Erstmals durften auch Frauen wählen. Im Februar trat dann in Weimar die Nationalversammlung zusammen, um eine demokratische Verfassung für das gesamte Deutsche Reich auszuarbeiten. Nachdem sich die politischen Auseinandersetzungen um die „richtige“ Form der Demokratie immer weiter verschärften, rief der Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte im April 1919 in München die Räterepublik aus. Diese hatte nur wenige Wochen Bestand und wurde von den Freikorps-Truppen um Franz Ritter von Epp blutig niedergeschlagen.
In diesem politisch ereignisreichen Frühjahr 1919 wurde Adolf Dassler (1900–1978) im Alter von 18 Jahren „demobilisiert“, d. h. aus dem Kriegsdienst entlassen. Er hatte die letzten Monate des Ersten Weltkriegs in der Rekrutenausbildung in Belgien verbracht. Wie sein Bruder Rudolf, der drei Jahre als Soldat an der Front gedient hatte, war Adolf Dassler 1917 zum Kriegsdienst eingezogen worden. Er hatte jedoch nicht mehr an Kampfhandlungen teilgenommen.1 Das Herzogenaurach, in das Adolf Dassler 1919 zurückkehrte, war geprägt durch die wirtschaftliche Not, die Arbeitslosigkeit und den Wohnungsmangel der unmittelbaren Nachkriegszeit. Auch in der fränkischen Provinz kam es zu politischen Auseinandersetzungen zwischen den neu gegründeten Arbeiterräten und den bürgerlich-konservativen Kräften. Die Bürger der Stadt begegneten dieser Krise während der Nachkriegsjahre „mit Notstandsmaßnahmen, staatlichen Hilfen und sehr viel Eigeninitiative“.2 Adolf Dassler, der zunächst ebenfalls „arbeitslos“ war, begann Anfang des Jahres 1920 im Haus seiner Eltern Christof und Pauline Dassler, Am Hirtengraben, mit sehr einfachen Mitteln Schuhe zu produzieren. Mit dieser Form der wirtschaftlichen Selbsthilfe reihte er sich in handwerkliche und berufliche Traditionen ein, die schon länger in der Stadt Herzogenaurach und in seiner Familie bestanden.
In Herzogenaurach, das 1920 etwa 3.500 Einwohner zählte, war die Schuhherstellung bereits um das Jahr 1900 zum wichtigsten Gewerbezweig geworden. Rund die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung war in der Schuhindustrie beschäftigt.3 Zum einen hatte sich seit den 1850er Jahren eine kleingewerbliche Fertigung von Hausschuhen aus Wollstoffen – die sogenannte „Schlappenschusterei“ – in der Stadt verbreitet. Zum anderen war eine Heimindustrie auf Verlagsbasis entstanden, die Hausschuhe aus Wollstoffen für Fürther und Nürnberger Unternehmen fertigte. Diese Verleger lieferten die Materialien, die in Herzogenaurach von ganzen Familien in Heimarbeit zu Hausschuhen verarbeitet und dann über Fürth und Nürnberg vermarktet wurden. Darauf basierte schließlich die spätere industrielle Fabrikation von Schuhen in der Stadt. Sie begann, als 1888 die Vereinigte Schuhfabriken AG Berneis-Wessels mit Sitz in Augsburg und Nürnberg, die damals weltweit größte Filzschuhfabrik, einen Zweigbetrieb in Herzogenaurach eröffnete.4 Dort wurden ebenfalls vor allem Hausschuhe aus Wollfilz hergestellt. Das zweitgrößte Schuhunternehmen –die Schuhfabrik Heinrich Schürr – entstand aus den heim-gewerblichen Ursprüngen als Verleger dieser ersten Firma heraus.5
Die Pioniere der Industrialisierung Herzogenaurachs waren seit den 1860er Jahren Tuchmacher gewesen, die erste Fabriken – mit Dampf betriebene Wollspinnereien, Färbereien und Walken – errichteten. Sie bildeten den Abschluss einer langen Tradition des Textilgewerbes in der Stadt. Nur wenige Jahre später begann die Verarbeitung von Wollstoffen zu Hausschuhen, den sogenannten „Schlappen“, und verdrängte schließlich die Tuchherstellung. Diese neue Industrie fing die Folgen des Niedergangs des alten Gewerbezweiges auf. Personifizieren lässt sich dieser Wandel der führenden Gewerbe Herzogenaurachs seit dem späten 19. Jahrhundert an Christof Dassler, dem Vater der vier Geschwister Fritz, Marie, Rudolf und Adolf Dassler. Selbst gelernter Tuchmacher aus einer alteingesessenen Herzogenauracher Tuchmacherfamilie, lernte er auf Wanderschaft in Gera seine Frau Pauline kennen. Bei seiner Rückkehr nach Herzogenaurach 1896 musste er feststellen, dass in seinem Beruf kein Auskommen mehr in der Stadt zu finden war. So verdingte er sich stattdessen als Fabrikarbeiter in der größten Schuhfabrik am Ort: damals noch die „Vereinigten Fränkischen Schuhfabriken vorm. Max Brust vorm. B. Berneis AG“. Seinen zweitältesten Sohn Rudolf (1898–1974) ließ er dort ab 1911 eine Lehre absolvieren;6 seine Tochter Marie arbeitete als Stepperin ebenfalls in diesem Betrieb.7
1 Die Vereinigte Schuhfabriken AG Berneis-Wessels in der Würzburger Straße in Herzogenaurach (ca. 1920)
Beginn einer Schuhproduktion durch Adolf Dassler (1920 bis 1923)
Nachdem Adolf Dassler eine Zeitlang beim Schuhmacher Hieronymus Wild in dessen Werkstatt ausgeholfen hatte, begann er im Februar 1920 mit einer eigenen Schuhproduktion.8 Mit der Hilfe des Vaters fand diese zunächst in der stillgelegten Waschküche seiner Mutter im 1900 erbauten Wohnhaus seiner Eltern statt. Adolf Dasslers Geschäftspartner dieser frühen Zeit war Karl Zech.9 Ihr Vorhaben entsprach – folgt man zeitgenössischen Dokumenten – auch einem spezifischen Gründertrend ihrer Zeit. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Krise der Schuhindustrie und hoher Arbeitslosigkeit unter den Schuhfabrikarbeitern in der Stadt verfasste im Dezember 1925 der Stadtrat von Herzogenaurach einen Bericht für die bayerische Staatsregierung in München. Hierin meldete der Stadtrat, dass von den 22 Schuhfabriken der Stadt lediglich fünf schon vor dem Ersten Weltkrieg existiert hatten. Die meisten waren während oder kurz nach dem Krieg gegründet worden – so wie die Schuhfabrik der Gebrüder Dassler. Über die Gründungswelle von Schuhfabriken seit dem Krieg hieß es in dem Bericht: „Während des Krieges war den jugendlichen Arbeitern in der Kriegsindustrie reichlich Verdienst geboten. […] Die Inflation [ab 1920] mit ihren verlockenden Existenzmöglichkeiten bei sehr flottem Warenverkauf ließ Schuhfabrikationsbetriebe wie Pilze aus dem Boden wachsen. Die Befürchtung […], es könnte einmal eine ganz unliebsame Enttäuschung eintreten, ist nun zu bald zur bitteren Wahrheit geworden.“10
Als eine dieser Neugründungen nach dem Krieg wurde in dem Bericht die „Schuhfabrik Gebrüder Dassler“ mit drei Fabrikarbeitern genannt. Dies waren vermutlich die beiden Brüder und eventuell Josef Erhard, der ab September 1921 bei den Dasslers arbeitete.11 Heimarbeiter wurden keine beschäftigt.12 Damit gehörte die Firma zu den sechs kleinsten „Schuhfabriken“ in der Stadt. Die beiden größten waren die Vereinigten Schuhfabriken (mit 410 Fabrikarbeitern und 165 Heimarbeitern) und die Schuhfabrik Heinrich Schürr (mit 71 Fabrikarbeitern und 15 Heimarbeitern). Mittlerweile waren bereits drei der Fabrikgründungen wieder in Konkurs gegangen und viele der 912 Arbeiter in der Schuhindustrie arbeitslos geworden. Fünf der übrigen 19 Schuhfabriken hatten zu diesem Zeitpunkt vorübergehend ganz die Arbeit eingestellt. Drei Betriebe mussten Arbeiter entlassen. Die Schuhfabrik Gebrüder Dassler gehörte zu jenen vier Unternehmen, die ihre Produktion, z. B. durch Kurzarbeit, nur „wesentlich eingeschränkt“ hatten. Doch auch an der jungen Firma der Dassler-Brüder ging die Krise Mitte der 20er Jahre nicht spurlos vorüber: Gegen Ende der damaligen Inflationszeit geriet der Absatz in eine Krise. Rohstoffe wurden knapp und teuer. Mit der Fertigung der bisherigen Produkte war kaum noch ein Geschäft zu machen. Die gesamte Produktion der Wintersaison musste schließlich billig an die wenig solide Firma Liebst & Co. in Nürnberg abgesetzt werden. Diese wurde zahlungsunfähig, sodass die Gebrüder Dassler Mühe hatten, dort ihre Außenstände einzutreiben.13
Das Unternehmen Gebrüder Dassler
In der frühen Zeit übernahm – gemäß späteren Angaben Adolf Dasslers – wie bereits erwähnt Karl Zech die Buchhaltung der Firma. Dieser trat im Juli 1921 wieder aus dem Unternehmen aus und erhielt einen Anteil von 5.875 Reichsmark, die Hälfte des damaligen Firmenkapitals, ausbezahlt.14 Stattdessen führte Adolf nun mit seinem Bruder Rudolf die Schuhfabrikation fort. Rudolf Dassler brachte bei seinem Eintritt verschiedene Fachkenntnisse in das junge Unternehmen ein. Während Adolf Dassler gelernter Bäcker und als Schuhmacher Autodidakt war, hatte Rudolf 1911 eine Lehre im Zweigbetrieb der Vereinigten Fränkischen Schuhfabriken in Herzogenaurach begonnen und besaß also, wie der Vater Christof und die Schwester Marie, technische Vorkenntnisse der Schuhherstellung. Nach seiner Demobilisierung als Soldat wurde Rudolf in die Gendarmerie übernommen und schied dort 1922 wieder aus. Daraufhin war er in der Ledergroßhandlung Karl Schmidt in Nürnberg als kaufmännischer Angestellter tätig. Während der Inflationszeit wurde seine Versorgung über dieses Angestelltengehalt jedoch zunehmend problematisch: Adolf gab später an, dass Rudolf „durch die Geldentwertung nicht einmal so viel verdiente, um sich ein Mittagessen kaufen zu können“.15 Ab Juli 1923 betrieben Adolf und er die kleine Schuhfabrikation unter dem elterlichen Dach gemeinsam weiter, die fortan als „Schuhfabrik Gebrüder Dassler“ firmierte. Die offizielle Eintragung im Handelsregister in Fürth fand einige Zeit später, am 1. Juli 1924 statt.16 Außerdem brachte Rudolf offenbar kaufmännische Verbindungen zu seinem alten Arbeitgeber Karl Schmidt in Nürnberg in das Unternehmen ein. Die Nürnberger Lederfirma half nicht nur bei der Erschließung von neuen Absatzmöglichkeiten für die Produkte, sondern sprang auch als Kreditgeber für das junge Unternehmen ein, zusammen mit der Sparkasse Herzogenaurach.17 Während Adolf Dassler vorher vor allem mit zwei Handzwickstöcken und einer selbst gebauten Fräse mit Fußantrieb produzierte, wurden nun einige Schuhmaschinen angeschafft: eine maschinelle Fräse, eine Stanze und eine Glätte für die Bodenarbeit, eine Durchnähmaschine zur Befestigung der Sohlen und eine Steppmaschine für die Maschinennähte am Schuhschaft. Vater, Mutter und Schwester Marie, die als Stepperin in der frühen Zeit auch den Zuschnitt der Schaftteile übernahm, arbeiteten bei der Schuhherstellung mit.18 Es war also ein ausgesprochener Familienbetrieb. Der Vertrieb der Produkte erfolgte über Hausierer. Ein wichtiger Abnehmer der ersten Turnschuhe war der Herzogenauracher Turnverein 1861.19 Durch Bekannte des Vaters bestand zudem eine Verbindung zum Verkauf nach Sachsen.20
2 Ursprüngliches Fabrikgebäude in der Kreuzgasse 2, das 1927 angemietet und im September 1930 käuflich erworben wurde (Aufnahme ca. 1927)
Als Gründungsdatum der Firma Gebrüder Dassler ist im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth vom 16. August 1935 der 1. Juli 1924 vermerkt.21 Diesem offiziellen Datum ging jedoch, wie bereits gezeigt, eine längere Firmengeschichte voraus. Diese ist vor allem in den Unterlagen dokumentiert, die der Treuhänder der Firma, Hans Ludwig Maier, im Januar 1946 mit Unterstützung Adolf Dasslers für die amerikanischen Militärbehörden anfertigte. Die Spruchkammerverfahren Adolf Dasslers 1946 waren der Anlass für einen ersten historischen Rückblick auf die Firmengeschichte.22 Hier wurden der Februar 1920 als ursprüngliches Datum des Beginns der Schuhproduktion durch Adolf Dassler und der Juli 1923 als Eintrittsdatum Rudolf Dasslers in die Firma angegeben. Den 1. Juli 1924 als Zeitpunkt der Gründung der Schuhfabrik Gebrüder Dassler nannte Adolf Dassler schließlich auch beim Antrag auf eine Gewerbeerlaubnis im September 1945: Er beantrage eine „Genehmigung zur Fortführung seiner seit 1. Juli 1924 handelsgerichtlich eingetragenen Firma“.23 Der 1. Juli 1924 erscheint somit als das plausibelste Gründungsdatum – es war der Zeitpunkt, als beide Brüder, nach einer etwa zwölfmonatigen Mitarbeit Rudolf Dasslers, gemeinsam begannen, die Firma aufzubauen, und es ist das Datum ihrer handelsgerichtlichen Eintragung. Damit wurde erstmals ein Name für die Firma und die Organisationsform als „offene Handelsgesellschaft“ amtlich dokumentiert.
3 Adolf Dassler mit Mutter Pauline (ca. 1930)
Als einzige, scheinbar zeitgenössische Quelle aus der unmittelbaren Gründungsphase des Unternehmens Gebrüder Dassler ist eine Gewerbekarte aus dem Gewerberegister der Stadt Herzogenaurach erhalten.24 Sie nennt als Gründungsdatum „Nov. 1919“. Doch muss dieses Dokument mit der nötigen quellenkritischen Distanz interpretiert werden –bei näherer Betrachtung stammt es vermutlich von 1948.25
4 Adolf Dassler beim Hochsprung im Rahmen des Betriebssports (ca. 1938/39)
Sportbegeisterung
Beide Brüder, sowohl Adolf als auch Rudolf, waren begeisterte Freizeitsportler. Auch hier knüpften sie an vielfältige lokale Traditionen des Turnerwesens und der Sportvereine in Herzogenaurach an. Das „Herzogenauracher Tagblatt“ berichtete ausführlich über die lokalen und regionalen Sportveranstaltungen sowie Vereinsaktivitäten der Zeit. Hier wird die große Bandbreite der Sportvereine deutlich, die Anfang der 20er Jahre die Freizeitgestaltung der Herzogenauracher prägten. Diese vielfältige Vereinskultur zeigt auch, welch wichtige Form der sozial segmentierten Vergemeinschaftung die Vereine für das Leben in der fränkischen Provinz darstellten. Meist gab es für einzelne Sportarten sogar mehrere Vereine. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein signalisierte dabei, wo sich das Mitglied politisch und gesellschaftlich verortete – ob es sich z. B. eher dem bürgerlichen Lager oder der Arbeiterbewegung zugehörig fühlte und welcher Religion bzw. Konfession es angehörte. Die Einwohner von Herzogenaurach folgten damit einem allgemeinen Trend hin zu sportlicher oder kontemplativer Betätigung an der frischen Luft, der überall im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg zu beobachten war – sei es in der Arbeitersportbewegung, in der bürgerlichen Turn- und Sportbewegung oder dem Wandervogel sowie später in der wachsenden Jugendbewegung. So gab es während der Weimarer Republik in Herzogenaurach neben einem Radfahrer-Verein mehrere Turnvereine und Fußballklubs – u. a. den „1. Fußball-Klub Herzogenaurach“, in dem Adolf Dassler seit etwa 1920 Mitglied war.26 Als sportliche Heimat des jungen Adolf Dassler muss aber vor allem die „Turnerschaft 1861“ angesehen werden.27 Seit 1912, bereits mit zwölf Jahren also, war er hier sportlich aktiv und nahm in der Leichtathletik und im Drei- bis Fünfkampf an „Jugend“-Wettbewerben teil.28 Im Juni 1921 wurde Adolf Dassler in der Lokalzeitung als Gewinner des zweiten Platzes im „Jugendwettturnen“ in Bruck erwähnt, als insgesamt bester Sportler aus Herzogenaurach. Zwei Wochen später errang er im Wettturnen in Zirndorf den fünften Platz.29 Im Juli wurde er unter den Gewinnern im „volkstümlichen Dreikampf“ auf dem Turnerfest in Forchheim hervorgehoben.30 An sportlichen Wettkämpfen in der Region nahm Adolf Dassler mindestens bis 1942 teil. Im Unternehmensarchiv sind Siegerurkunden von Juli 1925, August 1927, 1935 und Mai 1942 für Drei-, Vier- und Fünfkämpfe sowie Kugelstoßen und Speerwurf erhalten.31
5 Adolf Dassler beim 100-Meter-Lauf (ca. 1934)
Adolf Dassler schloss sich nicht den zahlreichen Arbeitersportvereinen an, die Teil der sozialdemokratischen und christlich-katholischen Arbeiterbewegung in Herzogenaurach waren, sondern den bürgerlichen Vereinen. Hierzu sind auch seine Mitgliedschaften von etwa 1920 bis 1928 im „Gesangverein Liederkranz“ von Herzogenaurach und von etwa 1921 bis 1922 im Schützenverein zu zählen. Im Schützenverein war auch Rudolf Dassler aktiv, offenbar mit einigem Erfolg. Die Mitglieder des Vereins beglückwünschten im Mai 1928 „unseren Schützenkönig Rudolf Daßler“ zur Vermählung mit seiner Frau Friedl.32
6 Urkunde Adolf Dasslers (1925)
2.2 Die „Ära Waitzer“: Sportliche Groβereignisse, die Entwicklung des Produkts Sportschuh und die Zusammenarbeit mit staatlichen Organisationen
Entwicklung der Produkte
Der zentrale Faktor des Firmenwachstums in den Anfangsjahren waren die innovativen Produkte des jungen Unternehmens. Ab 1920, als in der Nachkriegswirtschaft immer noch Materialknappheit herrschte, fertigte Adolf Dassler Segeltuchturnschuhe, Ledersandalen, „Kamelhaarschuhe“, d. h. Hausschuhe aus Wollfilz, und besetzte Winterschuhe. Er verwendete dazu sowohl neues als auch wiederverwertetes Material, z. B. aus alten Säcken der Armee, Brotbeuteln und Helmfuttern aus Leder.33 Dies waren jedoch noch eher konventionelle Produkte, die auch andere Herzogenauracher Schuhmacher herstellten.34 Als Rudolf Dassler in die Firma eintrat, wurden offenbar in größerem Ausmaß Lederschuhe robusterer Konstruktionen in das Sortiment aufgenommen. Diese Produkte wurden in einer Anzeige der Firma im Herzogenauracher Tagblatt vom 26. Juni 1924 wie folgt beschrieben: „zwiegenähte Damen- und Herren-Sportstiefel sowie Haferlschuhe – alles Handarbeit“.35
Aus dieser Beschreibung wird auch deutlich, was in der deutschen Schuhwirtschaft bis dahin gemeinhin unter der Bezeichnung „Sportschuhe“ verstanden wurde: Dies waren schwere Lederschuhe in sehr robusten Konstruktionen – rahmengenäht oder zwiegenäht.36 Sogenannte „Sportstiefel“ wurden erstens zum Wandern und Bergsteigen getragen und zweitens zum Skifahren.37 Beide Verwendungszwecke sahen eine – meist mehrlagige – Ledersohle vor, die stark und dick genug war, um an den Kanten Metallbeschläge zum Bergsteigen oder Befestigungen für die Skier tragen zu können. Entsprechend unflexibel und hart war die Sohle. Ein früher Mitarbeiter der Dasslers in dieser Zeit, Josef Erhard, berichtete später, dass für das schwere Schuhwerk der Skistiefel eigens Schuhmacher aus Bamberg eingestellt werden mussten, um die Sohlen zwiezunähen.38 Mitte der 20er Jahre begannen die Dassler-Brüder, unter „Sportschuhen“ etwas anderes zu verstehen: Sie entwickelten unter diesem Begriff besonders robustes oder leichtes Spezialschuhwerk aus Leder für einzelne Sportarten. Damit betraten sie in Deutschland weitgehend Neuland. Vorgänger und ähnliche Entwicklungen gab es vor allem in Großbritannien, den USA und den skandinavischen Ländern.
Vor allen anderen Sportnationen galt Großbritannien damals als wegweisend und technisch führend in der Sportschuhfertigung. Dort hatte die Firma Joseph William Foster in Bolton, Lancashire, bereits in den 1890er Jahren begonnen, Rennschuhe mit Metalldornen auf der Sohle für Leichtathleten herzustellen. Die Firma belieferte 1924 die britischen Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Paris.39 In den USA hatte sich dagegen der Sportartikelhersteller Spalding, der ursprünglich auf Baseball spezialisiert war, zum führenden Schuhhersteller entwickelt.40 Zudem stellten in Großbritannien Gummiverarbeiter bereits lederlose Schuhe mit einem Schaft aus Segeltuch und Sohlen aus vulkanisiertem Kautschuk für einzelne Sportarten wie Tennis oder Golf, Segeln oder als Badeschuhe her. Diese wurden allerdings eher von Freizeitsportlern getragen.41 Die Brüder Dassler gingen einen anderen Weg, indem sie begannen, den Lederschuh für verschiedene Sportarten zuzurichten. Von der Konstruktion her waren ihre Rennschuhe in der „durchgenähten Machart“ hergestellt, Fußballschuhe anfangs genagelt.42
7 Anzeige vermutlich der Gebrüder Dassler im Herzogenauracher Tagblatt vom 26. Juni 1924
Josef Waitzer und die Professionalisierung des deutschen Sports
In den Jahren nach 1925 erfolgte eine erste Spezialisierung auf Ledersportschuhe, auch wenn weiterhin, bis Mitte der 30er Jahre, noch verschiedene Straßenschuhmodelle hergestellt wurden. Ab 1927 kam es auf eine Initiative von Josef Waitzer hin zur gemeinsamen Entwicklung von leichten Sportschuhen. Hier soll zunächst kurz auf die Biografie Josef Waitzers (1884–1966) eingegangen werden, der in den kommenden Jahren einen immensen Einfluss auf die Produktentwicklung, den wirtschaftlichen Erfolg sowie die politische Einbindung des Unternehmens der Gebrüder Dassler in die Sportorganisationen im Nationalsozialismus haben sollte. Seine Biografie steht dabei auch exemplarisch für die Entstehung des Typus des „Sportfunktionärs“, für die Professionalisierung des deutschen Sports und für seine immer weitere Entfernung vom Amateurideal während der Zwischenkriegszeit.43 Diese Entwicklungen bildeten wichtige Voraussetzungen für die Spezialisierung des Unternehmens Gebrüder Dassler auf Sportschuhe. Es konnte mit seinen Produkten eine Marktnische mit Gütern beliefern, die zunehmend von Funktionärsautoritäten, Regulierungen und formalen Standardisierungen der „Meisterschaften“ und Wettbewerbe geprägt war. Produzenten wie die Dasslers verschafften sich Referenzen von Athleten und „Trainern“, wie die neuen Experten für die Praxis des Sports hießen. Damit stieg auch der Anspruch an die „Funktionalität“ und „Präzision“ ihrer Produkte.44 Gleichzeitig eröffnete die Kooperation mit Organisationen wie Sportverbänden stabile Absatzmöglichkeiten für die Hersteller von Sportartikeln. Diese verstanden die Brüder Dassler in wachsendem Ausmaß zu nutzen.
Josef Waitzer (1884–1966) wurde 1884 in München geboren.45 Als aktiver Leichtathlet gründete der gelernte Bankangestellte die sogenannte „Naturriege“, die Leichtathletikabteilung des TSV 1860 in München. Waitzer nahm 1912 als einer von fünf deutschen Leichtathleten an den Olympischen Spielen in Stockholm teil, errang jedoch keine Medaille. 1913 reiste er im Zuge der Vorbereitungen für die an Berlin vergebenen Olympischen Spiele von 1916 mit Carl Diem, Walter von Reichenau und Martin Berner als Delegation des Deutschen Reichsausschusses für die Olympischen Spiele in die USA. Ziel der Reise war es, die strukturellen Ursachen für die großen Erfolge der US-Athleten bei den Olympischen Spielen zu erkunden. Diese wurden von den deutschen Sportfunktionären als eine grundsätzliche Überlegenheit empfunden. Im Ergebnis hielt die Delegation den Sportstättenbau in den Städten, d. h. die Einrichtung von Zentren für die Sport- und Freizeitgestaltung, in denen auch erste Sportlehrer angestellt wurden, und die Sportförderung in den USA im Allgemeinen für die ausschlaggebenden Gründe.46 Carl Diem (1882–1962), der Generalsekretär des Deutschen Reichsbunds für Leibesübungen von 1917 bis 1933 und spätere Organisator der Olympischen Spiele 1936 in Berlin,47 versuchte daraufhin, in Deutschland ähnliche Strukturen zu schaffen. Er wurde ein Förderer Waitzers.48 Diem ließ den deutsch-amerikanische Leichtathleten Alwin Kraenzlein (1876–1928), einen vierfachen Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1900 in Paris, vom Deutschen Reichsausschuss für Olympische Spiele als Olympiatrainer und Trainerausbilder für die deutschen Leichtathleten einstellen. Waitzer wurde dessen Assistent.
Der Erste Weltkrieg unterbrach die Sportkarriere Waitzers. Nach seiner Rückkehr aus der französischen Kriegsgefangenschaft 1920 arbeitete er zunächst bei dem führenden Sportartikelhersteller Kaspar Berg in Nürnberg. Dieser stellte Sportgeräte aller Art, jedoch keine Schuhe her.49 Danach wurde Waitzer kurzzeitig Leichtathletiktrainer des Olympiateams der Schweiz und 1925 schließlich des Deutschen Reichs: Dort trat er die neu geschaffene Stelle eines „Reichssportlehrers“ im Dienst der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik an. In dieser Funktion veröffentlichte er zahlreiche Aufsätze und Lehrbücher über Trainingsmethoden in der Leichtathletik.50 1927 hielt Waitzer die ersten Olympiakurse im Frankfurter Stadion ab. In diesem Kontext kam es offenbar zur Entwicklung eines neuen Typs von Rennschuhen, die auf den Namen Waitzers als Gebrauchsmuster geschützt und, gemäß Angaben der Hersteller in ihrer Werbung, exklusiv von der Firma Gebrüder Dassler hergestellt wurde.51 Wie diese Zusammenarbeit entstanden war und wann genau sie begann, ist nicht mit Dokumenten belegbar. Die Olympia-Rennschuhe und die Gymnastikschuhe Modell „Waitzer“ wurden in mehreren Qualitäts- und Preisklassen hergestellt und im Dezember 1927 erstmals in der Zeitschrift Start und Ziel, der Monatszeitschrift der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik, durch die Firma Dassler beworben.52
8 Werbeanzeige der Firma Gebrüder Dassler in der Zeitschrift Start und Ziel (1927)
Im Olympiajahr 1928 erhielt die Firma Dassler nach eigener Aussage von der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik den Auftrag, die Hälfte der männlichen und sämtliche weiblichen Mitglieder der deutschen Leichtathletik-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Amsterdam mit Rennschuhen auszurüsten.53 Auch in seinem Spruchkammerverfahren im Zuge der sogenannten Entnazifierung 1946 gab Adolf Dassler an, dass „die von Deutschland zu den Olympiaden im Jahre 1928 und 1932 nach Amsterdam und Los Angeles entsandten Leichtathletik-Mannschaften […] mit Dassler-Schuhen ausgerüstet“ wurden. Dies sei ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg der Firma gewesen.54 Die Zusammenarbeit mit dem „Reichssportlehrer“ und die gemeinsame Produktentwicklung des Modell „Waitzer“ zahlte sich also bald aus. Sie bildeten die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der Firma in den folgenden Jahren. Rennschuhe des Modells „Waitzer“ waren in den 30er Jahren die meistverkauften Produkte der Gebrüder Dassler und wurden von der Firma bis zur Stilllegung der Schuhproduktion im Oktober 1943 hergestellt. Auch Anleitungen von Waitzer zur Methodik des Trainings in der Leichtathletik wurden in die Dassler-Kataloge aufgenommen. In die Trainingswinke, einer mit vielen Informationen angereicherten Werbebroschüre, hielten die charakteristischen Strichmännchen und Schemazeichnungen von Waitzer Einzug, die er auch in seinen Lehrbüchern verwendete.55 Im Dassler-Katalog von 1936 war zu erfahren, dass eine „Anleitung für systematische Trainingsarbeit[,] von „Reichssportlehrer“ J. Waitzer entworfen“, jedem Paar gelieferter „Rennschuhe in der besseren Ausführung“ beiliege.56 Aus einer Preisberechnung eines Paars Rennschuhe, Modell „Waitzer“, von Juli 1942 geht hervor, dass Waitzer bei einem Gestehungspreis von rund 30 bis 40 Reichsmark für jedes produzierte Paar 0,50 Reichsmark Lizenzgebühr von der Firma Dassler erhielt.57 So war die Zusammenarbeit auch für Waitzer ein einträgliches Geschäft.
9 Technische Kennzeichen des Modells „Waitzer“
Die technischen Kennzeichen der Rennschuhe des Modells „Waitzer“ waren: (1.) eine besonders passförmige und im Vorderfuß breite Leistenform; (2.) die Befestigung von Stahldornen auf einer eingenähten, biegsamen Stahlplatte, die ein Durchdrücken der Dornen nach innen verhinderte (durch Gebrauchsmuster geschützt), aber den Vorderfuß trotzdem biegsam machte; (3.) die Verstärkung des Schaftes am Ballen durch je zwei eingenähte „Spannbänder“ gegen die Ausdehnung des Leders nach außen, diese Spannbänder waren durch ihre Nähte nach außen als zwei Streifen am Schaft erkennbar und bildeten somit ein Erkennungszeichen der Dassler-Schuhe; (4.) ein Keil aus Crepe-Gummi an der Ferse zur Abfederung und zum Schutz des Oberleders. Der Schuh bot daher einen besonderen Schutz der Ferse. (5.) Eine Sohlenkonstruktion, in der die Halbsohle unter der Langsohle verlief. Somit war die Sohle nicht in zwei ungleich harte Hälften aus verschiedenen Materialien geteilt, sondern der Ballen und das Fersenteil waren elastisch verbunden.58
Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens (1923 bis 1933)
Über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens bis Anfang der 30er Jahre sind, bis auf eine Umsatzstatistik für die Jahre 1927 bis 1934, so gut wie keine zeitgenössischen Dokumente erhalten. Die wichtigsten Hinweise über diese Zeit sind den Unterlagen zu entnehmen, die anlässlich der Entnazifizierung in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst wurden. Diese entstanden in einem zeitlichen Abstand von bis zu über 20 Jahren zu den Ereignissen. Auch die Frage, welchen Einfluss die sportlichen Großereignisse jener Zeit auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens hatten, kann mangels zeitgenössischer Quellen nur mithilfe retrospektiver Dokumente beantwortet werden, die aus späterer Zeit stammen und größtenteils von Adolf Dassler verfasst wurden. Wichtige Anhaltspunkte bieten die Umsatz- und Gewinnzahlen, die Adolf Dassler für die Property Control der amerikanischen Militärregierung zusammenstellte (Tabelle 1).59 Aus den Angaben geht hervor, dass der Umsatz des Unternehmens Gebrüder Dassler ab 1927 kontinuierlich anstieg – also zu einer Zeit, als die übrige deutsche Schuhindustrie deutlich von den negativen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise erfasst wurde.
Die Jahre 1927 und 1928 markierten den Beginn einer tiefen Krise der Schuhindustrie, die bis 1933 andauern sollte und eng mit der weltweiten Rezession, der Weltwirtschaftskrise, verbunden war.60 Die Arbeitslosigkeit unter den Beschäftigten der Schuhindustrie erreichte in dieser Zeit einen Höhepunkt. Der Zentralverband der Schuhmacher zählte 1926 bereits 40 Prozent Arbeitslose. Diese Zahl war höher als in jedem anderen deutschen Gewerkschaftsverband. In Herzogenaurach stieg die Arbeitslosigkeit 1927/28 sogar auf 71 Prozent und war damit die höchste in ganz Bayern.61 Auch die Zahl der Kurzarbeiter in der Schuhindustrie lag bis in die frühen 30er Jahre hinein noch über dem allgemein hohen Durchschnitt in Deutschland.62 Gleichzeitig wurden im Jahr 1927 jedoch mehr Schuhe produziert als jemals zuvor im Deutschen Reich. In den folgenden Jahren verschlechterte sich die Lage dann drastisch. Die Produktion ging bis 1932, dem Jahr ihres Tiefststandes, kontinuierlich zurück und erreichte erst 1937 wieder den Umfang von 1927. Die Zahl der Insolvenzen von Schuhfabriken und Schuhgeschäften stieg auf Rekordhöhen.66 Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schuhen in Deutschland ging von 1,3 Paar im Jahr 1927 auf 0,9 Paar 1932 zurück. Der Umsatz des Einzelhandels mit Schuhwaren hatte im Jahr 1928 mit etwa 900 Mio. Reichsmark einen Höhepunkt erreicht. Danach sank er bis 1932 um mehr als ein Drittel ab.67
Tabelle 1: Umsatz und Reingewinn der Firma Gebrüder Dassler (1927 bis 1947)
Jahr
Umsatz (in RM)
darunter Export
Gewinn (in RM)
1927
102.000
k. A.
k. A.
1928
150.000
k. A.
17.000
1929
204.000
k. A.
38.000
1930
237.000
k. A.
35.000
1931
245.000
k. A.
35.000
1932
261.000
17.400
38.000
1933
188.000
8.000
13.500
1934
270.000
1.000
43.500
1935
367.000
3.174
40.000
1936
467.000
1.566
53.000
1937
571.000
1.500
71.000
1938
706.000
569
101.000
1939
861.000
0
126.000
1940
670.000
0
118.000
1941
619.000
0
108.000
1942
661.000
0
90.000
Umsatz mit Rüstungsgütern
Umsatz mit Schuhen
1943
0
558.000
0
62.000
1944
563.000
62.000
0
31.000
1945
208.000
19.600
0
–7.877
1946
63
274.192
k. A.
34.043
1947
64
(erstes Quartal)
59.638
k. A.
29.952
1948
65
(erstes Halbjahr)
k. A.
0
11.914
Quelle: Bericht an die Militärregierung Property Control über die Entwicklung der Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler in HA, Kreuzgasse 2, in: StABamberg, K 270/3431, Bl. 71—74; Trinkle, Report of Business Analysis: Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler, Herzogenaurach, 5.11.1946, in: ebd., Bl. 139; Georg Bauer für Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik, Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.–31.12.1946, in: ebd., Bl. 119; Georg Bauer für Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik, Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.–31.3.1947, in: ebd., Bl. 102; Umsatz (Jan. 1927—Juni 1934), 1934, in: aA, D-520
Tabelle 2: Einkommen Adolf Dassler laut Angaben für Military Government of Germany (1945)
Jahr
Einkommen Adolf Dassler (ca. Angaben in RM)
1931
15.000
1932
19.000
1933
6.000
1934
21.000
1935
20.000
1936
26.000
1937
36.000
1938
51.000
1939
63.000
1940
59.000
1941
54.000
1942
45.000
1943
31.000
1944
23.000
1945
k. A.
Quelle: Fragebogen Adolf Dassler, 17. 9. 1945, in: aA, D-716; Adolf Dassler: Meldebogen aufgrund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. 3. 1946, 7. 5. 1946, in: StA Coburg, Spruchkammer Höchstadt a.d. Aisch/D 6
In diesem Kontext war das kontinuierliche Wachstum des Umsatzes der Gebrüder Dassler in den Jahren 1927 bis 1933 außergewöhnlich. Da keine Dokumente über die Absatzzahlen einzelner Produkte oder über die wichtigsten Auftraggeber erhalten sind, können über die Gründe dieses Wachstums hier nur Vermutungen angestellt werden. Offenbar war die Strategie der beiden Inhaber erfolgreich, mit ihrer zunehmenden Spezialisierung auf Sportschuhe einen ganz neuen Markt zu erschließen. Diese Spezialfertigung machte den Absatz der Firma von den allgemeinen Entwicklungen des Schuhhandels in dieser Zeit in erheblichem Maße unabhängig. Zudem gehörten Sportschuhe nicht zum modischen Segment von Schuhen, das dem saisonalen Wandel der Modelle unterworfen war, sondern waren ein ausgesprochenes Standardprodukt: Sie konnten, vom Modellschnitt immer gleich, potenziell in großen Stückzahlen über eine lange Dauer hinweg abgesetzt werden. Somit hatten die Dassler-Brüder auch nicht mit dem Mode-Risiko zu kämpfen, das nach der Entstehung der Schuhmode in den 20er Jahren die Schuhindustrie zum Teil vor große Probleme stellte.68 Die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen der Schuhbranche in Deutschland zielten oft auf eine Massenproduktion, waren aber erstens wegen der geringen Stückzahlen, die der Einzelhandel als wichtigste Handelsform im Deutschen Reich bestellte, und zweitens wegen der großen Modellvielfalt ihrer Produkte sowie drittens wegen des Materials Leder, das sie hauptsächlich verarbeiteten, oft auf eine Kleinserienproduktion beschränkt. Dies setzte einer Rationalisierung der Produktion enge Grenzen.69 Mit ihrer Spezialfertigung von Standardprodukten, deren wenige Modelle sich über Jahre hinweg kaum veränderten, erreichten die Dasslers gewissermaßen in ihrer Nische ein ideales Produktionsformat – die Produktion in großen Serien. Ein solches Produktionsformat strebten viele deutsche Schuhhersteller ihrer Größenordnung in dieser Zeit an, konnten es aber in der Praxis aus den genannten Gründen nicht erreichen.
Der einzige Umsatzrückgang der Firma war im Jahr 1932/33 zu verzeichnen. Zu dieser Zeit hielt sich Adolf Dassler in Pirmasens auf. So war diese wirtschaftliche Entwicklung wohl eher auf den unternehmensinternen Faktor zurückzuführen, dass einer der Inhaber, in diesem Fall der technische Leiter, für längere Zeit nicht im Betrieb anwesend war. Damit fehlte auch der direkte Ansprechpartner für die Sportfunktionäre im Unternehmen, der die Spezialprodukte in der Konstruktion dem individuellen Bedarf der Vereine oder der Einzelsportler anpasste. Wie genau hier das Wechselverhältnis von in Serie produzierten Standardprodukten einerseits und individuell angepassten Einzelpaaren für Spitzensportler andererseits war, lässt sich aufgrund fehlender Dokumente nicht mehr rekonstruieren. Für die allgemeine Umsatzentwicklung war sicherlich die Herstellung der Serienprodukte weitaus wichtiger. Ein regelrechter Umsatzboom trat in den folgenden Jahren 1934 bis 1939 ein, die als eine Blütezeit der Firma bezeichnet werden können. Auf die Gründe hierfür wird weiter unten eingegangen.
10 Betriebsausflug 1937. Hintergrund: Firmengebäude nach Aufstockung des turmartigen Aufbaus auf einen Teil des Erdgeschosses (ca. 1937)
Räumliche Expansion und Beschäftigtenzahlen
Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung lassen außerdem die verschiedenen Phasen der räumlichen Expansion des Unternehmens zu. Nach den ersten Ursprüngen in der Waschküche des elterlichen Wohnhauses versuchten die Brüder Dassler offenbar schon im Juni 1924, ihre Produktion auszuweiten. Im Herzogenauracher Tagblatt erschien am 26. und am 28. Juni 1924 folgende Anzeige (Abb. 7): „Sport-Schuhfabrik[,] welche zwiegenähte Damen- und Herren-Sportstiefel sowie Haferlschuhe – alles Handarbeit – herstellt[,] wünscht Vereinigung mit mittlerer Schuhfabrik. Maschinen u. Rohmaterial vorhanden. Diskretion zugesichert. Offerten unter Nr. 200 an die Expedition dieses Blattes.“70 Obwohl die Anzeige anonym, ohne Autor- oder Firmennamen, veröffentlicht wurde, handelte es sich bei der „Sport-Schuhfabrik“ sehr wahrscheinlich um die Fabrik der Gebrüder Dassler. Andere Spezialfabriken für Sportschuhe waren in Herzogenaurach bis in die 30er Jahre nicht ansässig.71 Interessant ist erstens der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anzeige: Sie erschien wenige Tage vor der Eintragung der Firma ins Handelsregister am 1. Juli 1924. Zweitens gibt sie einen Hinweis darauf, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt feststand, dass es sich bei den Produkten hauptsächlich um Sportschuhe handeln sollte. Hier versuchten die Gebrüder Dassler, ihre Produktion in eine bereits bestehende Schuhfabrik, die leer stand, umzusiedeln, von denen es zur damaligen Zeit nur wenige gab. Eine solche Fusion versprach mehr Fläche für die Fertigung, aber wohl auch zusätzliche Ressourcen wie Schuhmaschinen, neue Absatzmöglichkeiten und Zugriff auf sonstige unternehmerische Wissensbestände und Netzwerke. Diese Initiative war 1924 jedoch offenbar nicht erfolgreich.
Erst 1927 konnte die Firma Dassler die ehemalige Schuhfabrik der Firma J. Weil aus Fürth in der Kreuzgasse 2 anmieten und siedelte künftig mit Produktion und Verwaltung dorthin um. Dieses Gebäude, 1899 von einer Schuhmacher-Genossenschaft erbaut, hatte den großen Vorzug, direkt am damaligen Bahnhof von Herzogenaurach zu liegen und über einen Eisenbahnanschluss zu verfügen. Nun konnten Rohstoffe direkt geliefert und Fertigprodukte direkt aufs Gleis gesetzt werden. Zudem war das Gelände im Zuge der Elektrifizierung der Stadt Herzogenaurach 1923 mit Stromanschlüssen versorgt worden.72 So konnte zwar noch nicht die erste, bald aber die nächste Generation von Schuhmaschinen bereits mit elektrischem Einzelantrieb versehen werden.73
Im September 1930 erwarb die Firma das Gebäude und das Grundstück käuflich zum Preis von 12.500 Reichsmark.74 Das Gebäudeensemble wurde 1932/33 um ein Wohnhaus für drei Familien erweitert (Abb. 12). 1934 ließen die Dasslers das eingeschossige Fabrikgebäude zunächst um einen turmartigen Aufbau auf einen Teil des Erdgeschosses über dem Haupteingang aufstocken (Abb. 10). 1938 kam der Aufbau eines zweiten Vollgeschosses auf dem übrigen Teil der erdgeschossigen Halle hinzu (Abb. 11). 1939 wurde schließlich eine weitere Schuhfabrik an der Würzburger Straße 13 angekauft.75 Dabei handelte es sich um das bereits länger leer stehende Gebäude der 1937 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegten Schuhfabrik Johann Lohmaier & Söhne. Die ehemaligen Eigentümer wohnten weiterhin in dem ebenfalls zum Grundstück gehörenden Wohngebäude.76
11 Fabrikgebäude in der Kreuzgasse 2 nach Aufstockung eines zweiten Vollgeschosses auf der erdgeschossigen Halle 1938 (Aufnahme ca. 1938)
12 Fabrikgebäude in der Kreuzgasse 2, nun „Betrieb I“, nach allen Umbauten 1938 — angrenzend das Dreifamilienhaus, errichtet 1932/33 (Aufnahme ca. 1939)
Auch an diesen räumlichen Expansionen ist ein stetiges und beträchtliches Wachstum der Firma und des Produktionsumfangs seit 1923 ersichtlich. Mitten in den Krisenjahren der deutschen Schuhindustrie, als zahlreiche andere Unternehmen in den Bankrott gingen, war es den Brüdern Dassler möglich, nicht nur das Fabrikgebäude in der Kreuzgasse käuflich zu erwerben, sondern kurz darauf auch noch einen neuen Wohnhausbau in Auftrag zu geben. Die Zahl der Beschäftigten stieg zudem von drei „Fabrikarbeitern“ (1925) auf 39 Beschäftigte in der Produktion und zwei Angestellte (1934) und schließlich auf rund 100 Beschäftigte (1939) (Tabelle 3).77
Ein nicht unwesentlicher Faktor dieser rasanten wirtschaftlichen Expansion und des Erfolges war für die Firma Gebrüder Dassler der Export. Die Dassler-Produkte wurden, vermutlich mithilfe der Vermittlung Josef Waitzers, bald auch in anderen europäischen Ländern nachgefragt: 1928 und 1929 erfolgten Ausfuhren nach Holland sowie in die Schweiz – also in jenes Land, zu dem Josef Waitzer seit Jahren berufliche Beziehungen unterhielt. 1930 exportierte die Firma Dassler in die Schweiz, Holland, Österreich, Tschechoslowakei, England und Griechenland.78 Jedoch sind erst ab 1932 Umsatzzahlen über den Export erhalten (Tab. 1). Wie hieraus ersichtlich ist, schwankten die Exportzahlen stark und gingen ab 1934, als die NS-Regierung mit ihrer Autarkiepolitik begann, immer mehr zurück. Von 1939 bis 1945 war die Ausfuhr nur noch in die deutsch besetzten Gebiete und verbündete Staaten möglich. Im August 1940 bemühte sich die Firma um einen Export ihrer Produkte nach Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen und im März 1943 nach Rumänien, wo mittlerweile Josef Waitzer arbeitete. Doch beide Anträge wurden von der staatlichen Prüfungsstelle für Lederwirtschaft abgelehnt.79 Erst im Juni 1946 reichte Adolf Dassler wieder Modellschuhe bei der Landesstelle für Leder des Bayerischen Landeswirtschaftsamts ein, um an der Bayerischen Exportschau im Haus der Kunst in München teilnehmen zu können.80
Tabelle 3: Beschäftigtenzahl der Firma Gebrüder Dassler
Jahr
Anzahl
1925
3
1934
39
1938
80
1939
80–100
März 1943
56
September 1943
43
September 1945
36
Februar 1946
43
März 1946
44
Juni 1948 (Gründung adidas)
47
Quelle: