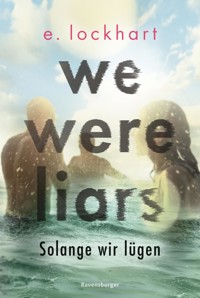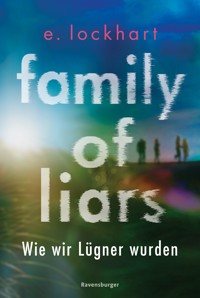
Family of Liars. Wie wir Lügner wurden. Lügner-Reihe 2 (Auf TikTok gefeierter New-York-Times-Bestseller!) E-Book
E. Lockhart
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Lügner-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die heiß ersehnte Vorgeschichte des New-York-Times-Bestseller WE WERE LIARS! Caroline – Carrie – Lennox Taft Sinclair ist die älteste der drei wohlhabenden Sinclair-Töchter. Die Sommerzeit verbringt sie stets mit ihren Eltern und Schwestern auf einer Privatinsel. Dort gibt es strenge Traditionen, glühende Sonnenuntergänge – und unzählige Geheimnisse, denn in dieser Familie werden die schlimmsten Dinge totgeschwiegen. Carrie ist allein mit ihrer Trauer, nur bei dem faszinierenden Sommergast Pfeff kommen ihre Gedanken zur Ruhe. Bis auch sie selbst eine Lüge erzählt. »Unglaublich spannend, atemberaubend schön und hochintelligent. We Were Liars ist absolut unvergesslich.« John Green, Autor von »Das Schicksal ist ein mieser Verräter« ***Ein Zitat aus "Family of Liars"*** "Unsere Familie liebt Märchen. Sie beinhalten immer etwas Bedrohliches, aber auch etwas Wahres. Sie tun weh, sie sind seltsam, aber wir können nicht aufhören, sie zu lesen, immer und immer wieder. Ich möchte euch Rosemarys Lieblingsmärchen erzählen. Meine eigene Version davon. Ich möchte sie erzählen, denn das Märchen ist für mich ein Weg, die Geschichte meiner Familie und die des Sommers, in dem ich siebzehn war, zu erzählen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das, was passiert ist, auf irgendeine andere Art erklären soll."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Sammlungen
Ähnliche
Achtung! Dieses E-Book beinhaltet Spoiler für »We Were Liars« von E. Lockhart.
TriggerwarnungDieses Buch enthält Themen, die potenziell triggern können. Hinten befindet sich ein Hinweis zu den Themen.ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.Deutsche ErstausgabeAls Ravensburger E-Book erschienen 2022Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 RavensburgDie Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Family of Liars« bei Delacorte Press, New YorkText copyright © 2022 by E. LockhartPublished in the United States by Delacorte Press, an imprint of Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC, New York. Delacorte Press is a registered trademark and the colophon is a trademark of Penguin Random House LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.This edition published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC.Übersetzung: Tamara Reisinger(www.tamara-reisinger.de)Lektorat: Nina SchnackenbeckUmschlaggestaltung unter Verwendung von Fotos von Getty Images (© Tina Terras & Michael Walter) und Shutterstock (© Maria Jacobs, Roselynne, Monkey Business Images und mitchFOTO)Das verwendete Zitat von Robert Frost stammt aus: Paul Celan, Gesammelte Werke in fünf Bänden. Fünfter Band: Übertragungen II © der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1980. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.Das verwendete Zitat stammt aus: Claude Lévi-Strauss, Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1971. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.Das an dieser, dieser, dieser und dieser Stelle verwendete Zitat stammt aus: Robert Frost, Promises to Keep. Poems. Gedichte. Übersetzung und Nachwort von Lars Vollert. © 2011 C.H.BECK oHG, MünchenDas verwendete Zitat stammt aus: William Shakespeare, Hamlet. Übersetzt von August W. Schlegel. © Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, StuttgartDas verwendete Zitat stammt aus: William Shakespeare, Der Sturm. Übersetzt von Christoph Martin Wieland. © Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, StuttgartDas an dieser und dieser Stelle verwendete Zitat stammt aus: William Shakespeare, Die lustigen Weiber von Windsor. Übersetzt von Wolf Graf von Baudissin. © Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, StuttgartAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-51155-6ravensburger.com
Für Hazel
Liebe Leser*innen,dieses Buch enthält Spoiler zu »We Were Liars. Solange Wir Lügen«.Ich liebe euch, und ich habe diese Geschichte für euch geschrieben – mit Ehrgeiz und starkem Kaffee.xoE
TEIL EINS
Eine Geschichte für Johnny
1
MEIN SOHN JOHNNY ist tot.
Jonathan Sinclair Dennis, das war sein Name. Er starb im Alter von fünfzehn Jahren.
Es gab ein Feuer und ich liebe ihn und ich habe ihm Unrecht getan und ich vermisse ihn. Er wird niemals erwachsen werden, niemals eine Partnerin finden, niemals für einen weiteren Wettlauf trainieren, niemals nach Italien gehen, wie er es gewollt hatte, niemals die Art von Achterbahn fahren, die einen kopfüber kippt. Niemals, niemals, niemals. Niemals irgendetwas.
Dennoch, er besucht mich ziemlich oft in der Küche auf Beechwood Island.
Ich sehe ihn spätnachts, wenn ich nicht schlafen kann und auf ein Glas Whiskey herunterkomme. Er sieht genauso aus wie mit fünfzehn. Seine blonden Haare stehen wild ab. Er hat einen Sonnenbrand auf der Nase. Seine Fingernägel sind heruntergekaut, und er trägt meistens eine Badehose und einen Hoodie. Manchmal trägt er eine blau-karierte Windjacke, denn im Haus ist es kalt.
Ich erlaube ihm, Whiskey zu trinken, da er sowieso schon tot ist. Wie soll es ihm schaden? Aber oft will er stattdessen heiße Schokolade. Johnnys Geist sitzt gern auf der Anrichte, klopft mit den nackten Füßen gegen die unteren Küchenschränke. Er holt die alten Scrabble-Spielsteine hervor und bildet gedankenverloren Sätze auf der Arbeitsplatte, während wir reden. Iss nie etwas, das größer ist als dein Arsch. Akzeptiere kein Nein als Antwort. Sei immer ein bisschen freundlicher als nötig. Solche Sachen.
Er bittet mich oft um Geschichten über unsere Familie. »Erzähl von damals, als ihr Teenager wart«, sagt er heute Nacht. »Du und Tante Penny und Tante Bess.«
Ich rede nicht gern über diese Zeit. »Was möchtest du wissen?«
»Egal. Was ihr so angestellt habt. Eure Eskapaden. Hier auf der Insel.«
»Dasselbe, was ihr gemacht habt. Wir sind mit den Booten rausgefahren. Wir waren schwimmen. Tennis und Eiscreme und Abendessen, das auf dem Grill zubereitet wurde.«
»Habt ihr euch damals gut verstanden?« Er meint mich und meine Schwestern, Penny und Bess.
»Bis zu einem gewissen Grad.«
»Habt ihr je Ärger gekriegt?«
»Nein«, sage ich. Dann: »Ja.«
»Weswegen?«
Ich schüttle den Kopf.
»Erzähl es mir«, drängt er. »Was war das Schlimmste, was ihr getan habt? Komm schon, spuck’s aus.«
»Nein!« Ich lache.
»Doch! Bitte, bitte! Das absolut Schlimmste, was ihr getan habt, damals. Erzähl deinem armen toten Sohn all die schmutzigen Details.«
»Johnny.«
»Oh, es kann nicht sooo schlimm gewesen sein«, sagt er. »Du hast keine Ahnung von den Dingen, die ich im Fernsehen gesehen habe. Viel schlimmer als alles, was ihr in den 1980ern getan haben könntet.«
Johnny sucht mich heim, weil er keine Ruhe findet ohne Antworten, glaube ich. Er fragt immer wieder nach unserer Familie, der Sinclair-Familie, denn er versucht, diese Insel zu verstehen, die Menschen hier, und warum wir so handeln, wie wir handeln. Unsere Familiengeschichte.
Er will wissen, warum er gestorben ist.
Ich schulde ihm diese Geschichte.
»Gut«, sage ich. »Ich erzähle es dir.«
MEIN VOLLSTÄNDIGER NAME ist Caroline Lennox Taft Sinclair, aber alle nennen mich Carrie. Ich wurde 1970 geboren. Das ist die Geschichte meines siebzehnten Sommers.
Es war das Jahr, in dem die Jungs nach Beechwood Island kamen. Und das Jahr, in dem ich das erste Mal einen Geist sah.
Ich habe diese eine Geschichte noch nie jemandem erzählt, aber ich glaube, es ist die, die Johnny hören muss.
Habt ihr je Ärger gekriegt?, fragt er. Erzähl es mir. Was war das Schlimmste, was ihr getan habt? Komm schon, spuck’s aus … Das absolut Schlimmste, was ihr getan habt, damals.
Diese Geschichte zu erzählen, wird schmerzhaft werden. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich sie wahrheitsgemäß erzählen kann, aber ich versuche es.
Ich war mein ganzes Leben lang eine Lügnerin, müsst ihr wissen.
Das ist in unserer Familie nichts Ungewöhnliches.
TEIL ZWEI
Vier Schwestern
2
MEINE KINDHEIT BESTEHT aus unzähligen, verschwommenen winterlichen Morgen in Boston, an denen meine Schwestern und ich in Stiefeln und kratzigen Wollmützen steckten. Schultagen in Uniformen aus dicken navyfarbenen Cardigans und Faltenröcken. Nachmittagen in unserem großen Backsteinhaus in der Stadt, wo wir unsere Hausaufgaben vor dem Kamin machten. Wenn ich die Augen schließe, schmecke ich immer noch den Vanille-Rührkuchen und spüre meine klebrigen Finger. Das Leben bestand aus Märchen vor dem Schlafengehen, Flanellpyjamas, Golden Retrievern.
Wir waren vier Mädchen. Den Sommer verbrachten wir jedes Jahr auf Beechwood Island. Ich erinnere mich daran, wie ich mit Penny und Bess in den wilden Wellen des Ozeans schwamm, während unsere Mutter und Baby Rosemary am Ufer saßen. Wir fingen Quallen und Krabben und hielten sie in einem blauen Eimer. Wind und Sonnenlicht, kleine Streitereien, Meerjungfrauenspiele und Steinsammlungen.
Tipper, unsere Mutter, schmiss wundervolle Partys. Sie tat es, weil sie einsam war. Auf Beechwood zumindest. Wir hatten natürlich Gäste, und einige Jahre lang waren Dean, der Bruder meines Vaters, und seine Kinder mit uns dort, doch meine Mutter blühte erst bei Wohltätigkeits-Diners auf oder bei langen Mittagessen mit engen Freunden. Sie liebte Menschen, und sie war gut darin, sie zu lieben. Da nicht viele auf der Insel waren, sorgte sie selbst für Unterhaltung, schmiss Partys, auch wenn wir niemanden zu Besuch hatten.
Als wir vier klein waren, fuhren meine Eltern jeden vierten Juli mit uns nach Edgartown. Edgartown ist ein Fischerdorf auf der Insel Martha’s Vineyard, überall, wohin man schaut, sieht man weiße Lattenzäune. Wir bekamen frittierte Muscheln mit Tartarsoße in Pappbehältern und Limonade von einem Stand vor der Old Whaling Church. Wir stellten Gartenstühle auf, auf denen wir saßen und aßen, während wir auf die Parade warteten. Jedes heimische Unternehmen fuhr mit seinem geschmückten Festzugswagen vor. Oldtimersammler begleiteten den Zug und hupten stolz. Die Feuerwehren der Insel zeigten ihre ältesten Löschfahrzeuge. Eine Veteranenband spielte den amerikanischen Nationalmarsch von John Philip Sousa, »Stars and Stripes Forever«, und meine Mutter sang jedes Mal mit, allerdings die Parodieversion: »Be kind to your fine feathered friends / For a duck could be somebody’s mother.«
Wir blieben nie bis zum Feuerwerk. Stattdessen tuckerten wir zurück nach Beechwood und rannten vom Familiensteg hinauf zur richtigen Party.
Die Veranda von Clairmont, unserem Haus, war mit Lichterketten behangen, und der große Gartentisch auf dem Rasen war in Blau und Weiß gedeckt. Wir aßen Maiskolben, Hamburger, Wassermelone. Es gab einen Kuchen, der aussah wie die amerikanische Flagge, mit Blaubeeren und Himbeeren darauf. Meine Mutter hatte ihn gemacht. Derselbe Kuchen, jedes Jahr.
Nach dem Abendessen gab sie jeder von uns eine Wunderkerze. Wir stolzierten über die Bohlenwege der Insel – die, die von Haus zu Haus führten – und sangen aus voller Brust. »America the Beautiful«, »This Land Is Your Land«, »Be Kind to Your Fine Feathered Friends«.
Im Dunkeln liefen wir zum großen Strand. Der Inselverwalter, Demetrios zu dieser Zeit, zündete das Feuerwerk. Die ganze Familie saß auf Baumwolldecken, die Erwachsenen hielten Gläser mit klirrenden Eiswürfeln.
Nun ja. Es ist schwer zu glauben, dass ich jemals so blind patriotisch war und dass meine hochgebildeten Eltern es waren. Dennoch, die Erinnerungen haften immer noch.
ES WAR MIR nie in den Sinn gekommen, dass etwas falsch daran sein könnte, wie ich mich in meine Familie einfügte, bis zu diesem einen Nachmittag, als ich vierzehn war. Es war im August 1984.
Wir waren seit Juni auf der Insel, wohnten in Clairmont. Das Haus war nach der Schule benannt, die Harris, unser Vater, als Junge besucht hatte. Onkel Dean und seine Kinder wohnten in Pevensie, benannt nach der Familie in den Narnia-Büchern. Ein Kindermädchen war den Sommer über in Goose Cottage untergebracht. Die Angestelltenunterkunft war für die Haushälterin, den Verwalter und sonstige gelegentliche Angestellte, aber nur die Haushälterin schlief regelmäßig dort. Die anderen hatten ihr Zuhause auf dem Festland.
Ich war den ganzen Vormittag mit meinen Schwestern und meiner Cousine Yardley schwimmen gewesen. Wir hatten Thunfischsandwiches und Sellerie aus der Kühlbox gegessen, die neben den Füßen meiner Mutter stand. Müde vom Essen und der Bewegung legte ich den Kopf auf die Decke und eine Hand auf meine achtjährige Schwester Rosemary. Sie schlief neben mir, ihre Arme waren von Insektenbissen übersät, ihre Beine voller Sand. Rosemary war blond wie der Rest von uns, mit ineinander verhedderten Locken. Ihre Wangen waren weich und pfirsichfarben, ihre Gliedmaßen dünn und ungelenkig. Sommersprossen, einen Hang zum Schielen, albernes Lachen. Unsere Rosemary. Sie war Erdbeermarmelade, schorfige Knie und eine kleine Hand in meiner.
Ich döste eine Weile, während meine Eltern sich unterhielten. Sie saßen in einiger Entfernung in Gartenstühlen unter einem weißen Sonnenschirm. Ich wachte auf, als Rosemary sich auf die Seite drehte, und ich blieb mit geschlossenen Augen liegen, spürte, wie sie unter meinem Arm atmete.
»Das ist es nicht wert«, sagte meine Mutter. »Das ist es einfach nicht wert.«
»Sie sollte es nicht schwer haben, wenn wir es ändern können«, antwortete mein Vater.
»Schönheit ist eine Sache – aber sie ist nicht alles. Du tust so, als wäre sie alles.«
»Wir reden nicht über Schönheit. Wir reden darüber, einer Person zu helfen, die schwach aussieht. Sie sieht dümmlich aus.«
»Warum bist du so harsch? Es gibt keinen Grund, das zu sagen.«
»Ich bin pragmatisch.«
»Du machst dir Gedanken darüber, was die Leute denken. Wir sollten uns keine Gedanken darüber machen.«
»Es ist ein routinemäßiger Eingriff. Der Chirurg ist sehr erfahren.«
Ich hörte, wie sich meine Mutter eine Zigarette anzündete. Sie alle rauchten, damals. »Du vergisst die Zeit, die sie im Krankenhaus liegen wird«, wandte Tipper ein. »Flüssigkost, die Schwellungen, all das. Die Schmerzen, die sie erleiden wird.«
Über wen sprachen sie?
Welcher Eingriff? Flüssigkost?
»Sie kaut nicht normal«, sagte Harris. »Das ist einfach ein Fakt. Es gibt ›nur den Ausweg mittendurch‹.«
»Komm mir jetzt nicht mit einem Zitat von Robert Frost.«
»Wir müssen an das Ziel denken. Uns nicht darüber Gedanken machen, wie sie dorthin kommt. Und es kann nicht schaden, wenn sie mehr aussieht …«
Er hielt einen Moment inne, und Tipper wandte ein: »Du denkst über Schmerzen, als wären sie ein Training oder etwas in der Art. Als wäre es nur eine Anstrengung. Ein Kraftaufwand.«
»Wenn du dich anstrengst, hast du auch etwas davon.«
Ein Ziehen an der Zigarette. Ihr aschiger Geruch vermischte sich mit dem Salz in der Luft. »Nicht alle Schmerzen lohnen sich«, sagte Tipper. »Manche Schmerzen sind einfach nur Schmerzen.« Eine Pause. »Sollen wir Rosemary mit Sonnenschutz eincremen? Sie wird rosa.«
»Weck sie nicht auf.«
Eine weitere Pause. Dann: »Carrie ist hübsch so, wie sie ist«, sagte Tipper. »Und sie müssen durch den Knochen schneiden, Harris. Durch den Knochen schneiden.«
Ich erstarrte.
Sie redeten über mich.
Bevor wir auf die Insel gekommen waren, war ich bei einem Kieferorthopäden gewesen, und danach bei einem Kieferchirurgen. Ich hatte nichts dagegen gehabt. Ich hatte kaum zugehört. Die Hälfte der Kinder in der Schule hatten Zahnspangen.
»Sie sollte sich selbst nicht ins Aus schießen«, sagte Harris. »Mit ihrem Gesicht, so wie es jetzt ist, schießt sie sich selbst ins Aus. Sie verdient es, wie eine Sinclair auszusehen: nach außen hin stark, denn sie ist auch im Innern stark. Und wenn wir das für sie tun müssen, dann müssen wir das für sie tun.«
Mir wurde klar, dass sie mir meinen Kiefer brechen würden.
3
ALS WIR SCHLIESSLICH darüber redeten, sagte ich meinen Eltern Nein. Ich sagte ihnen, ich könne ganz normal kauen (obwohl der Kieferchirurg anderer Meinung war). Ich sagte, ich sei glücklich, so wie ich war. Sie sollten mich in Ruhe lassen.
Harris widersprach. Vehement. Er erklärte mir die Autorität von Chirurgen und warum sie es besser wussten.
Tipper sagte, ich sei hübsch, wunderschön, anmutig. Sie sagte, sie vergöttere mich. Sie war ein netter Mensch, engstirnig, aber kreativ, großzügig und lebensfroh. Sie sagte all ihren Töchtern, sie seien wunderschön. Aber trotzdem fand sie, ich sollte den Eingriff in Erwägung ziehen. Warum ließen wir die Frage nicht vorerst ruhen? Entschieden später? Es bestehe kein Grund zur Eile.
Ich sagte wieder Nein, aber in meinem Innern hatte ich angefangen, mich falsch zu fühlen. Mein Gesicht war falsch. Mein Kiefer war schwach. Ich sah dümmlich aus. Aufgrund eines genetischen Zufalls würden andere Menschen vorschnell über meinen Charakter urteilen. Ich bemerkte bereits jetzt, wie sie vorschnell über meinen Charakter urteilten, und das regelmäßig. Da war diese leichte Herablassung in ihrer Stimme. Verstand ich den Witz?
Ich begann, langsamer zu kauen, vergewisserte mich, dass mein Mund fest geschlossen war. Ich war unsicher wegen meiner Zähne, unsicher, ob sie Nahrung genauso zermahlten, wie die Zähne anderer Menschen es taten. Die Art, wie sie zusammenpassten, fühlte sich auf einmal seltsam an.
Ich wusste bereits, dass Jungs mich nicht hübsch fanden. Auch wenn ich beliebt war, auf Partys ging und sogar als Schülervertreterin für die neunte Klasse ins Schulkomitee gewählt worden war, wurde ich immer als eine der Letzten auf Bälle eingeladen. Damals fragten noch die Jungs die Mädchen.
Auf den Bällen dann hielten meine Partner nie meine Hand. Sie küssten mich nicht oder drückten sich auf der dunklen Tanzfläche an mich. Sie fragten nicht, ob sie mich wiedersehen oder mit mir ins Kino gehen könnten, so wie sie es bei meinen Freundinnen taten.
Ich beobachtete meine Schwester Penny, die sich keine Gedanken über ihren markanten Kiefer machte, wie sie Essen in sich hineinschaufelte, während sie sprach. Sie lachte, den Mund weit geöffnet, streckte die Zunge heraus und zeigte den Menschen jeden einzelnen ihrer strahlend weißen Backenzähne.
Ich beobachtete Bess, deren Lippen voller und süßer waren als meine und deren Kiefer kräftig und feminin geschwungen war, wie sie sich über die sechs Monate feste Zahnspange und die darauffolgende lose beschwerte. Sie klappte die blaue Zahnspangendose mit einem lauten Seufzen auf, als Tipper sie daran erinnerte, sie nach den Mahlzeiten wieder einzusetzen.
Und Rosemary. Ihr markantes Gesicht ähnelte dem von Penny, nur mit Sommersprossen und Grimassen.
Sie alle waren meine Schwestern, und ihre Knochen waren wunderschön.
4
DEN SOMMER, IN dem ich sechzehn war, verbrachten wir auf Beechwood, wie immer. Kajaks, Maiskolben, Segelboote und Schnorcheln (auch wenn wir nicht viel sahen außer einer gelegentlichen Krabbe). Wir hatten die übliche Vierter-Juli-Party mit Wunderkerzen und Liedern. Unser jährliches Freudenfeuer, unsere Zitronenjagd, unsere Mittsommer-Eiscreme-Party.
Nur dieses Jahr – ertrank Rosemary.
Sie war zehn Jahre alt. Die Jüngste von uns vieren.
Es passierte Ende August. Rosemary schwamm am Strand vor Goose Cottage. Wir nennen ihn den kleinen Strand. Sie trug einen grünen Badeanzug mit kleinen Taschen aus Jeansstoff darauf. Lächerlichen Taschen. Man konnte nichts hineintun. Es war ihr Lieblingsbadeanzug.
Ich war nicht dabei. Niemand aus unserer Familie war dabei. Sie war mit dem Kindermädchen, das dieses Jahr mit uns auf der Insel war, am Strand, einer zweiundzwanzigjährigen Frau aus Polen. Agata.
Rosemary wollte immer später als alle anderen schwimmen gehen. Lange nachdem wir anderen uns die Füße mit dem Wasserschlauch an der Windfangtür von Clairmont gewaschen hatten, ging Rosemary schwimmen, wenn sie durfte. Es war nichts Ungewöhnliches, dass sie mit Agata an den einen oder anderen Strand ging.
Aber an diesem Tag zogen sich die Wolken am Himmel zu.
An diesem Tag ging Agata nach drinnen, um für sie beide Pullover zu holen.
An diesem Tag musste Rosemary, immer eine gute Schwimmerin, von einer Welle niedergedrückt und vom Sog erfasst worden sein.
Als Agata wieder herauskam, war Rosemary bereits weit draußen und strampelte. Sie war weit hinter den gefährlichen schwarzen Felsen, die die Bucht abgrenzen.
Agata war keine Rettungsschwimmerin.
Sie konnte keine Herz-Lungen-Reanimation.
Sie war als Schwimmerin nicht einmal schnell genug, um Rosemary noch rechtzeitig zu erreichen.
5
DANACH GINGEN WIR zurück aufs Internat, Penny und ich. Und Bess fing dort an.
Wir verließen unsere Eltern, nur zwei Wochen nachdem Rosemary gestorben war, um am wunderschönen Campus der North Forest Academy zu lernen. Als unsere Mutter uns hinbrachte, umarmte sie uns fest und küsste uns auf die Wange. Sie sagte, dass sie uns liebe. Und dann war sie weg.
Es lag an mir, mich um Bess zu kümmern. Ich war in diesem Jahr in der Elften. Sie kam in die Neunte. Ich half ihr, ihr Zimmer zu dekorieren, stellte sie Leuten vor, brachte ihr Schokoriegel aus dem Verpflegungsladen. Ich hinterließ alberne, fröhliche Nachrichten in ihrem Postfach.
Bei Penny war weniger zu tun. Sie hatte Freundinnen hier, und bereits in der zweiten Woche ging sie mit einem neuen Jungen. Aber ich ließ mich trotzdem bei ihr blicken. Ich suchte sie in der Cafeteria auf, schaute in ihrem Zimmer vorbei, saß auf ihrem Bett und hörte zu, während sie von ihrem neuen Schwarm erzählte.
Ich war für meine Schwestern da, aber wir gingen mit unseren Gefühlen wegen Rosemary allein um. Wir sind die Sinclair-Familie, wir bewahren Haltung. Wir machen das Beste daraus. Wir blicken in die Zukunft. Das sind Harris’ Mottos, und es sind auch Tippers Mottos.
Uns Mädchen wurde nie beigebracht, wie man trauert, tobt oder gar seine Gedanken teilt. Stattdessen wurden wir sehr gut im Schweigen, im Kleine-freundliche-Gesten-Machen, im Segeln, im Sandwich-Zubereiten. Wir reden sehr gern über Literatur und sorgen dafür, dass jeder Gast sich wohlfühlt. Wir sprechen nie über Krankheiten. Wir zeigen unsere Liebe nicht durch Ehrlichkeit oder Zuneigung, sondern durch Loyalität.
Seid ein Gewinn für unsere Familie. Das ist eines von vielen Mottos, die unser Vater am Esstisch wiederholte. Was er meinte, war: Präsentiert uns in einem guten Licht. Tut es nicht um euer selbst willen, sondern weil das Ansehen der Sinclair-Familie Respekt verlangt. Wie die Menschen euch wahrnehmen – so nehmen sie uns alle wahr.
Er sagte es so oft, dass es unter uns zu einem Witz wurde. An der North Forest erinnerten wir uns ständig gegenseitig daran. Wenn ich an Penny vorbeikam, die gegen irgendeinen Kerl gepresst im Flur herumknutschte, sagte ich, ohne die beiden zu unterbrechen: »Sei ein Gewinn für unsere Familie.«
Wenn Bess mich dabei erwischte, wie ich eine Packung Butterkekse in den Schlafsaal schmuggelte – dasselbe.
Wenn Penny sah, dass Bess ihr Shirt mit Tomatensoße bekleckert hatte – dasselbe.
Beim Zubereiten einer Kanne Tee. »Sei ein Gewinn für unsere Familie.«
Oder wenn wir groß mussten. »Sei ein Gewinn für unsere Familie.«
Es brachte uns zum Lachen, aber Harris nahm dieses Motto todernst. Er pochte darauf, er glaubte daran, und auch wenn wir darüber lachten, glaubten wir ebenfalls daran.
Daher ließen wir uns nichts anmerken, als Rosemary starb. Wir hielten unseren Notenschnitt. Wir strengten uns in der Schule an und wir strengten uns beim Sport an. Wir strengten uns bei unserem Aussehen an und wir strengten uns bei unserer Kleidung an, dabei vergewisserten wir uns jedoch immer, dass man die Anstrengung nicht sah.
An dem Tag, an dem Rosemarys elfter Geburtstag gewesen wäre, am fünften Oktober, war Herbstfest an der Schule. Der Hof war gefüllt mit Buden und albernen Spielen. Schüler und Schülerinnen ließen sich das Gesicht anmalen. Es gab eine Zuckerwattemaschine. Spin Art. Ein falsches Kürbisfeld. Einige Schulbands.
Ich stand mit dem Rücken an mein Wohnheim gelehnt und trank einen Becher mit heißem Apfelcider. Meine Freundinnen aus der Softball-Mannschaft standen an einer Bude, wo man einen der Mathelehrer mit Bällen bewerfen konnte. Meine Zimmergenossin und ihr Freund beugten sich über ein Notenblatt und gingen den Auftritt ihrer Band durch. Ein Junge, den ich mochte, mied mich eindeutig.
An anderen fünften Oktobern, damals, als ich noch zu Hause wohnte, hatte meine Mutter immer einen Kuchen gebacken, Schokoladenkuchen mit Vanilleglasur. Sie servierte ihn nach dem Abendessen, dekoriert mit was immer Rosemary wollte. In einem Jahr tummelten sich kleine Löwen und Geparden aus Kunststoff darauf. In einem anderen Jahr war er bedeckt mit Veilchen aus Zuckerguss. Wieder in einem anderen Jahr lag ein Bild von Snoopy darauf. Und es gab eine Party, am darauffolgenden Wochenende. Überall wuselten Rosemarys kleine Freundinnen in Partykleidern und Mary-Jane-Spangenschuhen herum; sie hatten sich für einen Geburtstag extra feierlich gekleidet – etwas, was heutzutage keiner mehr macht.
Nun war Rosemary tot, und es schien, als hätten meine Schwestern sie vollkommen vergessen.
Ich lehnte an dem Backsteinwohnheim, am Rande des Festes, und hielt meinen Cider. Tränen rannen über mein Gesicht.
Ich versuchte, mir einzureden, dass Rosemary nicht wissen würde, ob wir an ihren Geburtstag dachten oder nicht.
Sie konnte keinen Kuchen wollen. Es war egal. Sie war fort.
Aber es war nicht egal.
Ich entdeckte Bess, die inmitten einer Gruppe Neuntklässler stand. Sie alle malten Gesichter auf orangefarbene Luftballons. Sie lächelte wie eine Schönheitskönigin.
Und da war Penny, die hellen Haare unter einer gestrickten Mütze verborgen; sie zog ihren Freund an der Hand hinter sich her, während sie zu ihrer besten Freundin Erin Riegert lief. Penny nahm eine Handvoll von Erins blauer Zuckerwatte und stopfte sie sich in den Mund.
Dann sah sie zu mir. Und hielt inne. Sie kam zu mir herüber. »Komm schon«, sagte sie. »Denk nicht daran.«
Aber ich wollte daran denken.
»Komm, schau dem Typ beim Zuckerwatte-Machen zu«, sagte Penny. »Es ist irgendwie süß, wie er es macht.«
»Sie wäre elf geworden«, sagte ich. »Sie hätte einen Schokoladenkuchen bekommen. Aber ich weiß nicht, wie er dieses Jahr dekoriert gewesen wäre.«
»Carrie. Du musst aus diesem Loch rauskommen. Es ist ein deprimierendes Loch, und es wird dir nicht guttun. Komm, tu etwas, was Spaß macht, und dann fühlst du dich bald besser.«
»Sie hat mir erzählt, dass sie über einen Simple-Minds-Kuchen nachgedacht hatte«, sagte ich. Simple Minds war eine Band. »Aber ich glaube, Tipper hätte sie davon abgebracht. Der Kuchen wäre zu kompliziert gewesen, und er hätte vermutlich zu billig ausgesehen.«
Jetzt kam auch Bess zu uns herüber. »Alles okay?«, fragte sie mich.
»Nicht wirklich.«
»Ich plädiere für Zuckerwatte«, sagte Penny. »Sie muss etwas Normales machen.«
Bess sah zu ihren neuen Freunden und zu den älteren Schülern, die sie noch nicht kannte, hinüber. »Das Timing ist gerade schlecht«, sagte sie, als hätte ich sie um etwas gebeten. Als hätte ich sie gebeten, zu uns herüberzukommen. »Die anderen warten auf mich«, fügte sie hinzu.
Meine Schwestern hatten Rosemary geliebt. Ich wusste, dass sie sie geliebt hatten. Und sie mussten um sie getrauert haben. Aber ich wusste nicht, wie ich mit ihnen darüber reden sollte. Wenn ich es versuchte, so wie jetzt, wechselten sie das Thema.
Sie waren nicht zu mir gekommen, um herauszufinden, wie ich mich fühlte.
Sie waren gekommen, um mir zu sagen, dass ich aufhören sollte, mich so zu fühlen.
ICH VERLIESS DAS Fest.
Ich stieg in meinem Wohnhaus bis ganz nach oben und trat hinaus auf den Steg, der um das Dach herumführte.
Ich holte einen Filzstift aus meiner Tasche und schrieb auf das verwitterte hölzerne Geländer.
ROSEMARY LEIGH TAFT SINCLAIR.
SIE LIEBTE
SNOOPY UND SCHOKOLADENKUCHEN,
KARTOFFELCHIPS UND GROSSE KATZEN
UND DIE BAND SIMPLE MINDS.
SIE LIEBTE
IHREN GRÜNEN BADEANZUG UND DAS SCHWIMMEN IM WILDEN MEER.
SIE LIEBTE
IHRE SCHWESTERN,
AUCH WENN SIE ES NICHT VERDIENT HABEN.
SIE WÄRE HEUTE ELF JAHRE ALT GEWORDEN.
UND ICH HABE SIE GELIEBT.
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG, ROSEMARY, JETZT UND FÜR IMMER.
ALS WIR ZU Thanksgiving nach Hause fuhren, setzte Tipper ein fröhliches Gesicht auf. Sie half uns, unsere Koffer auszupacken. Sie backte herrliche Torten und lud Verwandte zum traditionellen Essen ein. Harris war gut gelaunt und dominant, er wollte Schach spielen und über Bücher und Filme diskutieren.
Unsere Eltern mieden es, Rosemary zu erwähnen, am ehesten taten sie es noch, als sie sagten, dass das Haus so schön laut und lebendig wirke, nun, da wir zu Hause seien. Es sei ein ruhiger Herbst gewesen.
Ich weiß, meine Eltern benahmen sich so, weil sie es für das Beste hielten – für uns und für sie. Es tat weh, an einen Verlust erinnert zu werden, warum also sollten wir uns gegenseitig daran erinnern?
6
IN DEN WINTERFERIEN desselben Jahres kam Harris wieder auf die Kieferoperation zu sprechen, diesmal mit neuer Dringlichkeit. Er bestand darauf, dass es medizinisch notwendig sei. Die Entscheidung aufzuschieben, wie wir es getan hatten, seit ich vierzehn war, sei Zeitverschwendung. Wir sollten uns um die Dinge kümmern, wenn sich darum gekümmert werden musste.
Ich versuchte, Nein zu sagen, aber er erinnerte mich daran, dass Akzeptiert kein Nein als Antwort eine seiner Lebensphilosophien war.
Ich war gezwungen, nachzugeben.
Nun, da ich erwachsen bin, denke ich, Akzeptiert kein Nein als Antwort ist eine Lektion, die wir Jungs lehren, denen man besser Nein heißt Nein beibringen sollte. Ich erkenne heute auch, dass es meinem Vater mehr darum ging, dass ich wie er aussehe, und nicht darum, dass ich hübsch bin. Aber damals war ein Teil von mir sogar erleichtert. Harris hatte das Sagen, und mir war eingetrichtert worden, dass er wusste, was das Beste war.
Ich wurde im Februar für zwei Wochen von der Schule beurlaubt – zumindest hätten es nur zwei Wochen sein sollen. Die Chirurgen trennten meinen Kiefer und setzten einen Keil hinein. Sie bauten den Knochen auf, schoben ihn nach vorn und in die richtige Position. Dann fixierten sie alles mit Drähten und Platten, damit es wieder zusammenwachsen konnte.
Sie gaben mir Codein, ein narkotisierendes Schmerzmittel. Ich sollte es erst alle vier Stunden nehmen, dann nach Bedarf. Die Tabletten lösten ein seltsames Gefühl in mir aus – es war kein Taubheitsgefühl, ich nahm die Schmerzen wahr, allerdings so, als würden sie zu jemand anderem gehören.
Mein Kiefer. Der Verlust von Rosemary.
Nichts davon tat weh, wenn ich das Medikament alle vier Stunden nahm.
Die Flüssigkost schmeckte gar nicht so schlecht. Tipper versorgte mich mit Frozen Yogurt. Und Luda, unsere Haushälterin – inzwischen hatten wir kein Kindermädchen mehr –, war ebenfalls außergewöhnlich liebenswürdig. Sie war aus Belarus, dünn wie eine Bohnenstange, mit gebleichten Haaren und Augen-Make-up, das meine Mutter geschmacklos fand. Luda machte mir fast flüssigen Pudding, schmolz mir Schokolade und bereitete mir Buttertoffees zu. »Damit du genug Proteine bekommst«, sagte sie. »So nahrhaft.«
Die Familienhunde machten es sich zur Gewohnheit, untertags in meinem Zimmer zu schlafen. McCartney und Albert, beides Golden-Retriever-Rüden, und Wharton, eine Irish-Setter-Hündin. Wharton sah adlig aus – und war dumm. Ich mochte sie am liebsten.
Die Entzündung kam eines Nachts ohne Vorwarnung. Ich spürte, wie sie ausbrach, durch den Nebel meines medikamentösen Schlafs. Ein anhaltendes Pulsieren, ein pochender roter Ball des Schmerzes auf der rechten Seite des Kiefers.
Ich wachte auf und nahm noch eine Codein-Tablette.
Ich holte mir einen Kühlbeutel. Hielt ihn an mein Gesicht.
Es vergingen fünf Tage, bevor ich meine Eltern bat, mich zum Arzt zu fahren. Harris war der Überzeugung, sich zu beschweren sei kein angemessenes Verhalten für eine willensstarke Person. »Es trägt nichts zur Gesellschaft bei, in der man sich bewegt«, sagte er oft. »›Beschwert euch nie, erklärt euch nie.‹ Benjamin Disraeli hat das gesagt. Ehemals Premierminister von England.«
Als ich die Schmerzen erwähnte, Luda und Tipper gegenüber, gab ich mich gelassen. »Ach, nur die eine Seite macht mir ein bisschen Probleme«, sagte ich. »Vielleicht sollten wir sie zur Sicherheit einmal ansehen lassen.« Harris erzählte ich nichts von den Schmerzen.
Als der Arzt mich untersuchte, war die Entzündung akut.
Harris sagte, ich sei ein Dummkopf, weil ich ein offensichtliches Problem so lange ignoriert hatte. »Kümmere dich um die Dinge, wenn sich um sie gekümmert werden muss«, erinnerte er mich. »Warte nicht ab. Das sind Worte, nach denen man leben sollte.«
Die Entzündung tobte weitere acht Wochen durch meinen Körper. Antibiotika, andere Antibiotika, ein zweiter Arzt, ein dritter, eine zweite Operation, Schmerzmittel und noch mehr Schmerzmittel. Eis. Handtücher. Buttertoffees und Pudding.
Dann war es vorbei. Mein Kiefer war verheilt. Die Schwellung war zurückgegangen. Die Drähte wurden entfernt. Ich bekam eine feste Zahnspange eingesetzt.
Das Gesicht im Spiegel war mir fremd. Ich war blasser, als ich es jemals gewesen war. Dünner als sonst. Aber hauptsächlich war es mein Kinn. Es stand weiter vorn, wodurch es zusammen mit meinem Kiefer eine markante Linie bis zu meinen Ohren bildete. Meine Zähne trafen an ungewohnten Stellen aufeinander, noch zu empfindlich für Nüsse oder Gurken, zu schwach, um ein Schweinskotelett zu kauen, aber sie standen gerade.
Ich drehte mich im Profil zum Spiegel und berührte mein Gesicht, fragte mich, welche Zukunft mir dieses Stück künstlicher Kieferknochen erkauft hatte. Würde ein hübscher Junge mich berühren wollen? Würde er mir zuhören? Mich verstehen wollen? Ich hungerte danach, als einzigartig und würdig angesehen zu werden. Ich wollte es auf diese verzweifelte Art, wie es jemand wollte, der noch nie geküsst worden war …
unpräzise, aber leidenschaftlich,
beflügelt von Fantasien von Küssen, die ich in Filmen gesehen hatte,
gemischt mit Geschichten meiner Mutter von Bällen und Ansteckblumen und Vaters wiederholten Anträgen.
Ich sehnte mich nach Liebe,
und ich hatte ein ziemlich dringendes Interesse an Sex,
aber ich wollte auch gesehen
und gehört
und anerkannt werden,
wahrhaftig, von einer anderen Person.
Das war mein Standpunkt, als ich Pfeff kennenlernte. Ich glaube, er hat das in mir gesehen.
IM MAI WAR ich zurück an der Schule und beendete das Semester, so gut ich konnte. Ich trat wieder in die Softball-Mannschaft ein, wo ich immer eine starke Schlagfrau und ein Gewinn für unsere Familie gewesen war. Wir gewannen die Meisterschaft in dieser Saison. Ich kehrte zurück in meinen Freundeskreis. Ich musste mich sehr in Mathematik und Chemie anstrengen und verbrachte zusätzliche Stunden in der Bibliothek, um den Lehrstoff aufzuholen.
Aber mir ging es nicht gut. Ich ertappte mich dabei, wie ich zwanghaft über Berichte nachdachte, die ich in den Zeitungen gelesen hatte – Berichte über Männer, die an Aids starben; diese neue Gesundheitskrise. Und Überschwemmungen in Brownsville, Texas; Familien, deren Häuser unter Wasser standen. Über Fotos in den Zeitungen: ein Mann in einem Bett, nur noch Haut und Knochen. Demonstranten auf den kopfsteingepflasterten Straßen von New York City. Eine Familie in einem Schlauchboot, mit zwei Hunden. Eine Frau hüfttief im Wasser in ihrer eigenen Küche.
Ich dachte an diese Fotos –
sterbende Menschen, eine ertrinkende Stadt –,
anstatt an Rosemary zu denken, sterbend, ertrinkend.
Diese Geschichten ließen mich leiden, ohne mein eigenes Leben zu betrachten. Wenn ich nicht über sie nachgedacht hätte, hätte ich nie aufgehört, an Rosemary zu denken.
Die Codein-Tabletten halfen, diese zwanghaften Gedanken zu betäuben. Sie wurden mir von verschiedenen Ärzten verschrieben, deshalb hatte ich einen endlosen Vorrat an kleinen braunen Pillendöschen in meiner Schublade. Die Schulkrankenschwester gab mir mehr, mit Erlaubnis meiner Eltern, wenn ich sagte, meine Zähne würden schmerzen.
Nachts nahm ich die Tabletten, um zu schlafen. Und manchmal kam die Nacht früh.
Zum Beispiel vor dem Abendessen.
Zum Beispiel vor dem Mittagessen.
TEIL DREI
Die schwarzen Perlen
7
UNSERE INSEL IST ein ganzes Stück von der Küste Massachusetts’ entfernt. Das Wasser ist ein tiefes, dunkles Blau. Manchmal schwimmen Weiße Haie vor der Küste. Dünenrosen gedeihen hier unglaublich gut. Die Insel ist übersät von ihnen. Und obwohl die Küste felsig ist, haben wir zwei süße Buchten mit weißen Sandstränden.
Zuerst gehörte das Land den Ureinwohnern. Es wurde ihnen von Siedlern aus Europa weggenommen. Niemand weiß, wann, aber so muss es gewesen sein.
1926 kaufte mein Urgroßvater die Insel und baute ein Haus an der Südküste. Sein Sohn erbte es – und als der 1972 starb, erbten es mein Vater und sein Bruder Dean. Und sie hatten Pläne.
Die Sinclair-Brüder rissen das Haus ab, das ihr Großvater gebaut hatte. Wo es nötig war, ebneten sie das Land. Sie schafften Sand heran für die Strände der Insel. Sie beratschlagten sich mit Architekten und bauten drei Häuser – eins für jeden Bruder und ein Gästehaus. Die Häuser waren im traditionellen Cape-Cod-Stil gehalten: mäßig-steile Dächer, Holzschindeln, Rollläden an den Fenstern, große Verandas.
Ein Teil des Geldes für diese Projekte stammte aus dem Treuhandfonds meiner Mutter. Tippers Familienvermögen kam (zu einem Teil, der mehrere Generationen zurückreichte) aus einer Zuckerplantage in der Nähe von Charleston, South Carolina. Auf der Plantage arbeiteten Sklaven. Es ist also schmutziges Geld.
Ein anderer Teil des Geldes stammte von der Familie meines Vaters. Die Sinclairs besaßen ein seit langer Zeit bestehendes Verlagshaus in Boston. Und noch mehr Geld steuerte mein Vater bei. Früh in seiner Karriere hatte Harris ein kleines Unternehmen gekauft, das eine Reihe von Literatur- und Nachrichtenmagazinen veröffentlichte.
Das ist ebenfalls schmutziges Geld. Nur auf andere Weise. Die Geschichte dort beinhaltet ausgebeutete Arbeitnehmer, gebrochene Verträge und Kinderarbeit in Übersee – in Kombination mit journalistischer Integrität und dem Glauben an Pressefreiheit.
Als die Sinclair-Brüder mit ihren Bauvorhaben fertig waren, gab es noch zwei Anlegestellen, ein Bootshaus und eine Unterkunft für die Angestellten. Die Insel war durchzogen von hölzernen Bohlenwegen und bepflanzt mit Flieder und Lavendel.
Ich habe, seit ich fünf war, jeden Sommer hier verbracht.
WIR HABEN INZWISCHEN Juni 1987. Der Sommer, in dem die Jungs kommen. Der Sommer mit Pfeff.
Wir fahren von Boston zum Cape Cod. Gerrard, der damalige Verwalter der Insel, erwartet uns in der Stadt Woods Hole. Er ist mit dem großen Motorboot da. Gerrard ist ungefähr sechzig Jahre alt, klein und lächelt viel. Er redet sehr wenig, außer mit meiner Mutter. Sie stellt ihm enthusiastisch Fragen zu dem Rhododendron und dem Flieder, zu verschiedenen kleineren Renovierungsarbeiten, die notwendig sind, zum Einbau eines neuen Trockners. In ein paar Tagen kommt Luda mit einem Mietwagen und mehr von unseren Sachen aus dem Haus in Boston nach.
Sobald das Boot beladen ist, tuckern wir zwei Stunden bis zur Insel, mit Gerrard am Steuer. Penny, Bess und ich sitzen zusammen, unsere Haare flattern um uns herum.
Es ist dieselbe Fahrt wie jedes Jahr, nur ohne Rosemary in ihrer orangefarbenen Schwimmweste.
Ohne sie.
CLAIRMONT SIEHT AUS wie immer – drei Stockwerke und ein Türmchen auf dem Dach. Die hölzernen Schindeln sind grau vom Salz. Eine breite Veranda zieht sich um zwei Seiten. An einem Ende der Veranda befindet sich eine Hängematte, am anderen eine Sammlung gemütlicher Sessel. Auf dem Rasen steht ein übergroßer, maßgefertigter Gartentisch. An den meisten Abenden essen wir dort. Am Ende des Gartens ragt ein Ahornbaum in die Höhe. Unsere Reifenschaukel hängt an einem dicken Seil von einem niedrigen Ast.
Als Penny vom Steg heraufkommt, lässt sie ihre Taschen auf den Rasen fallen und läuft zur Schaukel. Sie springt auf und dreht sich wie wild herum. »Carrie, komm her. Du musst der Schaukel Hallo sagen!«, ruft sie.
Okay, na gut. Ich fühle mich melancholisch, da ich an Rosemary denke – aber ich gehe trotzdem zu ihr. Ich nehme Anlauf und klettere so auf den Reifen, dass ich mit den Füßen zu beiden Seiten von Pennys Beinen stehe. Das Rauschen der Luft in meinen Ohren, das Schwindelgefühl – einen Moment lang vergesse ich alles andere.
»Es ist endlich Sommer!«, jubelt Penny.
Als Bess vom Steg heraufkommt, lässt sie ebenfalls ihre Taschen fallen und kommt zu uns. Wir sind zu groß, und es ist nicht so einfach, dass wir alle auf den Reifen passen, aber wir schaukeln dennoch zusammen, bis uns herrlich schwindelig ist, wie damals, als wir Kinder waren.
Im Innern von Clairmont sind die Teppiche abgenutzt, aber das Holz ist frisch geölt. Der runde Küchentisch weist die Flecken und Kratzer auf, die bei einer großen Familie unvermeidbar sind. Der Salon enthält nur eine Anzahl an Ölgemälden und einen Servierwagen mit funkelnden Flaschen, das Wohnzimmer ist da schon gemütlicher. Es platzt vor Büchern und Patchworkdecken, karierten Flanell-Hundebetten und Zeitungsstapeln fast aus allen Nähten. Es gibt noch ein Arbeitszimmer für meinen Vater, es ist voller eingerahmter Karikaturen aus dem New Yorker und fetter Ledermöbel; und ein Nähzimmer für meine Mutter, voll mit Stoffen und Wolle für ihre Decken und Gläser mit Knöpfen, Kalligrafiefedern und Schachteln mit hübschem Briefpapier.
DAS ZIMMER MEINER Eltern ist im dritten Stockwerk, fernab von dem Lärm, den wir Mädchen machen. Als ich den Raum betrete, etwa eine halbe Stunde nach unserer Ankunft, packt Tipper gerade aus und legt Hemden in eine Schublade. Ihr beigefarbenes Leinenkleid ist von der Reise zerknittert.
Wharton (unsere Irish-Setter-Hündin) streckt sich am Fuße des Bettes aus. Ich lege mich neben sie. »Mach Platz, du dumme Königin von einem Hund.«
»Oh, sag das nicht«, schimpft Tipper. »Sie wird sich schlecht fühlen.«
»Dumm-Sein gehört zu ihrem Charme.« Ich streichle Whartons weiche Ohren. »Sie frisst Harris’ Socke.«
Meine Mutter kommt herüber und nimmt die Socke aus Whartons Maul. »Das ist nichts zu fressen«, sagt sie zu der Hündin.
Wharton blickt voller Gefühl auf, dann fängt sie an, die Bettdecke abzuschlecken.
Tipper läuft von der Kommode zum Schminktisch, in den begehbaren Schrank und wieder heraus, und zwischen ihren Koffern hin und her. Als ich krank war, waren wir oft nur zu zweit, doch seit Ferien sind, sehe ich meine Mutter nur noch, wenn auch meine Schwestern dabei sind.
Sie zieht sich um und kämmt sich die Haare am Schminktisch. »Komm her.« Sie öffnet eine breite, tiefe Schmucklade, die mit schwarzem Filz ausgekleidet ist. »Ich habe die Sachen das ganze Jahr hier«, sagt sie, während sie die Stücke mit den Fingern berührt. »Dadurch ist es, als würde ich jedes Mal Geschenke bekommen, wenn ich diese Lade öffne. Ich vergesse, was ich bereits habe, und dann ist es wie: Oh, hallo! Welch hübsches Schmuckstück du doch bist!«
So ein Spiel ist typisch für Tipper. Sie sucht nach Möglichkeiten, auch noch den allerletzten Tropfen Vergnügen aus einer Situation herauszupressen, Freude und Überraschung zu schaffen, wann immer sie nur kann.
»Das hier war der Ring meiner Großmutter«, sagt sie und hält einen viereckig geschliffenen Diamanten hoch. Sie redet weiter, zeigt mir Schmuckstücke, antike Jade und neuere Saphire. Sie legt die Schätze behutsam auf den Tisch, damit ich sie anprobieren kann. Jeder davon ist Teil unserer weiblichen Familiengeschichte, die durch ihre und Harris’ Erblinie weit zurückreicht.
Einer dieser Schätze ist ihr Verlobungsring, ein Smaragd, eingerahmt von Diamanten. Meine Eltern lernten sich in Harvard Radcliffe kennen, wo Harris Tipper viermal einen Antrag gemacht hatte, bevor sie schließlich Ja sagte. »Ich habe sie mürbe gemacht«, sagt er immer. »Sie hat Ja gesagt, damit ich endlich Ruhe gebe.«
Meine Mutter lacht, wenn er diese Geschichte erzählt. »Beim vierten Mal hast du daran gedacht, einen Ring zu kaufen«, erinnert sie ihn dann.
Jetzt holt sie einen Doppelstrang mit dunklen, funkelnden Perlen hervor, ein tiefes Grau, in dem Galaxien herumwirbeln. »Dein Vater hat mir diese zu unserem zweiten Hochzeitstag gekauft, als ich mit dir schwanger war.« Sie erlaubt mir, sie zu halten. Die Perlenkette ist glatt, fast rutschig und schwerer, als ich erwartet habe. Meine Mutter nimmt sie zurück und legt sie sich um den Hals, wo die Perlen vor dem Blau ihres neuen Kleides funkeln. »Es war ein sehr bedeutungsvolles Geschenk«, sagt sie. »Wir hatten es damals nicht leicht.«
»Warum nicht?«
»Ich kann mich kaum noch erinnern.« Sie streichelt meine Wange. »Aber ich möchte, dass sie eines Tages dir gehören.«
»Okay.«
»Die schwarzen Perlen«, sagt sie, während sie an den Perlen an ihrem Hals herumspielt, »gehören dir, Carrie.«
Unter dem Schubladenbezug lugt ein Foto hervor, weiß umrandet, in einem ausgeblichenen Orange. Ich kann nur die rechte untere Ecke sehen. »Was ist das für ein Foto?«, frage ich, während ich danach greife.
Sie hält meine Hand zurück. »Das ist nichts.«
»Ist es Rosemary?«
Ein seltsamer Ausdruck huscht über ihr Gesicht. Trauer. »Nein.«
Ich verschränke die Arme hinter dem Rücken. »Ich hätte es sehen wollen, wenn es Rosemary gewesen wäre.«
Meine Mutter sieht mich an, und einen Moment lang glaube ich, dass sie zu weinen anfängt – in Tränen ausbricht, wegen ihres verlorenen Kindes. Oder vielleicht sagt sie mir stattdessen, dass es okay sei, Rosemary zu vermissen. Die ganze Zeit an sie zu denken, so wie ich es tue.
Aber sie fängt sich wieder. »Weißt du was?«, sagt sie. »Ich denke, du solltest sie heute Abend tragen.«
Sie löst die Kette und legt mir die schwarzen Perlen um den Hals.
8
LASST MICH EUCH mehr über Penny und Bess erzählen. Die Menschen sagen oft, wir seien wie Prinzessinnen in einem (westlichen) Märchen. Drei gertenschlanke, große Blondinen. Kopien unserer Mutter. Wir sind dadurch reizvoll für andere Menschen. Sie mögen unsere ernsten Augen und unser fröhliches Lachen. Die Menschen glauben, wir würden vermutlich darauf warten, gerettet zu werden. Wir seien weiße Baumwolle und sandige Füße, altes Geld und Flieder, jede von uns.
Aber wir sind leicht auseinanderzuhalten.
Bess (Elizabeth Jane Taft Sinclair) ist vierzehn, und sie strengt sich immer an, um mit mir und Penny mitzuhalten. Sie ist die Hart-Arbeitende, die Leuten-alles-recht-Machende, die Märtyrerin. Sie kocht mit unserer Mutter in der Küche, rührt Eiscreme und backt Torten. Sie sortiert ihre Lipglosse nach Farbtönen und reiht sie auf einem hübschen Tablett auf ihrer Kommode auf. Sie stapelt ihre T-Shirts und Sweater ebenfalls nach Farben.
Bess hat Akne auf der Stirn. Sie kann sie nicht in Ruhe lassen – sie schmiert Salben darauf, Toniken, Alkohol, Abdeckcreme. Sie will die Akne behandeln, sie besiegen. Sie ist in dieser Hinsicht wie unser Vater. Sie hat seine Arbeitsmoral und seinen Stolz auf diese Moral aufgesogen, aber auch seine Entrüstung, wenn die Anstrengung nicht deutlich belohnt wird. Bess ist adretter und floraler Liberty-Stoff, ein Becher mit gespitzten Bleistiften, ein Kalender, beschrieben in schöner Handschrift. Sie ist nicht immer nett – absolut nicht. Aber sie ist immer gut.
Penny (Penelope Mirren Taft Sinclair) hat die erstaunliche Fähigkeit, andere Menschen dazu zu bringen, sie zu mögen, obwohl sie egoistisch ist. Sie wollen sie berühren. Sie ist die Schönheit der Familie, die, die auf einem Foto hervorsticht. Als Großmutter M noch lebte, kommentierte sie das immer – die magnetische Anziehungskraft, die Pennys bloße Anwesenheit auslöste. »Was für eine Schönheit«, sagte sie oft, während sie Penny beiseitenahm und ihr ein Buttertoffee gab.
Sie bezeichnete mich als »ein braves Mädchen« und Bess als »Helferlein«.