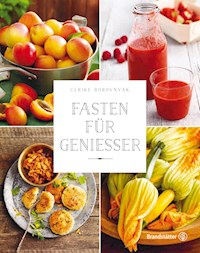
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
In Windeseile legen wir tausende Kilometer zurück und sind gleichzeitig oft weit vom Gefühl entfernt, wie gut es tut, einen moosigen Waldboden mit bloßen Füßen zu betreten. Fasten bedeutet, den Körper von überflüssigem Ballast zu befreien. Der Kopf kommt zur Ruhe, Energie wird frei. Es ist eine Auszeit vom Alltag, für kurze Zeit, freiwillig und selbstbestimmt. Lange genug sollte sie sein - etwa eine Woche -, um unserem Immunsystem neue Kraft zu verleihen. Fasten für Genießer zeigt, wie man aus dem gewohnten Alltag aussteigen kann, um sich ganz auf sich selbst zu besinnen. Kurz: Was gesund ist und dem Körper wohl tut. Und das hat nicht unbedingt mit Verzicht zu tun. Richtiges Fasten besteht keineswegs aus langweiligen Brühen und trockenem Knäckebrot. Es ist vielmehr ein Eintauchen in eine Atmosphäre der Entspannung. Die Fasten- und Gesundheitsexpertin verrät, wie man das neu gewonnene Wohlbefinden bewahren und den entschleunigten Rhythmus halten kann. Leckere Rezepte, die einfach nachzu-kochen sind, lassen nach der Fastenwoche noch lange einen nachhaltigen Energieboost in unserem Körper zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
„Fasten für Genießer“ zeigt,wie man aus dem gewohnten Alltagaussteigen kann, urn sich ganz auf sichselbst zu besinnen; was gesund ist und demKörper wohl tut. Und das hat nichtunbedingt mit Verzicht zu tun. RichtigesFasten bedeutet Eintauchen in eineAtmosphäre der Entspannung. Dieses Buchverrät, wie man das neu gewonneneWohlbefinden bewahren und denentschleunigten Rhythmus halten kann.Leckere Rezepte, die einfach nachzukochensind, lassen nach der Fastenwoche nochlange einen nachhaltigen Energieboostin unserem Körper zurück.
ULRIKE BOROVNYAK
FASTENFÜRGENIESSER
ZEITSCHLEIFE
DAS AUF UND AB IM JETZTBEWUSST ERLEBEN.DIE SINNESKRAFT NACH VORNE RICHTEN,IN DIE ZUKUNFT STREBEN.
ERINNERUNGEN AN GEWESENESIM GEIST ENTLASTEN.ENTWICKLUNG MÖGLICH MACHEN.RÄUME SCHAFFEN.FASTEN.
ES ZIEHT DIE ZEITSPIRALENFÖRMIG IHRE SCHLEIFEN,IN IHREM SOGSIND RAUM UND ZEITZU REIFEN.
aus dem Gedichtband SPUREN,Eigenverlag, 2001, von Gerold Schodterer
INHALT
GESCHICHTEDES FASTENS
DIE VERSCHIEDENENFASTENTYPEN
FASTENWOCHEFÜR GENIESSER
NACHDEM FASTEN
FASTENREZEPTEFÜR GENIESSER
Fasten stillt den Hunger unserer Zeit!
Als moderne Menschen legen wir in Windeseile tausende Kilometer zurück und sind gleichzeitig meilenweit vom Gefühl entfernt, wie gut es tut, einen moosigen Waldboden mit bloßen Füßen zu betreten. Nahrungsergänzung und Convenience Food sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und entfremden uns vom Wissen über Kraft und Wirkungsweise der Pflanzen in unserer Umgebung (Kräuter, Samen, Beeren) und damit vom Vertrauen in die starken Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Wir nehmen Farb- und Geschmacksstoffe zu uns und vergessen allzu leicht, dass der Zauber eines gemeinsamen Essens nicht mit der Fertigpackung mitgeliefert werden kann. Was also macht wahren Genuss aus? Wann ist ein Lunch oder Dinner so geschmacksintensiv, dass es noch Jahre in unserer Erinnerung fortlebt? Und was – bitte – hat Fasten dazu beizutragen?
Fasten ist eine Auszeit vom Alltag. Für kurze Zeit, freiwillig und selbstbestimmt. Lang genug sollte sie sein – etwa eine Woche –, um unserem Immunsystem neue Kraft zu verleihen und ausreichend Freiraum zu schaffen, der anschließend mit neuem Genuss gefüllt werden kann. Fasten ist ein richtiger Boost für Genuss- und Glücksgefühle. Jeder, der wie ich schon jahrelang zumindest einmal pro Jahr fastet, wird das bestätigen. Nicht nur körperliche Entgiftung und seelische Reinigung werden spürbar, auch die Geschmacks- und Gefühlsnerven werden regelrecht beflügelt.
Laut aktuellem Stand der Wissenschaft gilt als bestätigt, dass der Körper während einer Fastenwoche Glückshormone wie Serotonin ausschüttet. Doch damit allein kann der Höhenflug nach dem Fasten wohl nicht bewiesen werden. Es gehören einige weitere Zutaten dazu, genau wie bei einem gelungenen Lunch oder Dinner. Und dazu dient dieses Buch: Zuerst werden die richtigen Kniffe verraten, um sich bei einer Fastenwoche so rundum wohl zu fühlen und sich seine richtige Wohlfühl-Auszeit zu schaffen. Und dann begleiten wir Sie auf dem Weg in die Welt der wahren Genießer und Genießerinnen und verraten unsere „Geheimrezepte“, um dieses Hochgefühl nach dem Fasten noch lange aufrechtzuerhalten.
VORWORT
FASTEN FÜR GENIESSER
Der Großteil der Fastenrezepte dieses Buches wurde in den „Fasten für Genießer®-Hoteliers“ kreiert. Fasten für Genießer®-Hotels sind die einzigen zertifizierten Fastenhotels mit Gütesiegel und bieten eine Oase für Körper, Geist und Seele. Ich liebe das herzliche Ambiente, die menschlichen Aufmerksamkeiten und das Gefühl der Geborgenheit in jedem von ihnen.
„LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN“
Ein erinnerungswürdiges Essen besteht nicht allein aus den Zutaten. Auch das noch so sagenhafte, vielleicht preisgekrönte Können der Hauben- und Sterne-Köche und -köchinnen reicht nicht aus. Denken Sie an die Speisen, an die Sie sich seit Ihrer Kindheit erinnern. Es sind die besonderen Momente, die zählen. Die Magie, die wunderbare Mahlzeiten umgibt, beginnt mit der Liebe bei der Zubereitung und endet in der Liebe der Menschen zueinander, die diese Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Die Großmutter und ihre Enkel gehören genauso dazu wie ein Liebespaar oder eine fröhliche Runde von Arbeitskollegen oder die zwei besten Freundinnen. Zeit, Ruhe, Rhythmus und Achtsamkeit füreinander sind weitere wichtige Zutaten, ebenso wie das gewissenhafte Auswählen und Zubereiten von köstlichen, qualitativ hochwertigen Zutaten. Und nicht zu vergessen der liebevoll gedeckte Tisch.
Was dann getafelt und begossen wird, steigert unsere Inspiration und gipfelt in den Gesprächen miteinander. Früher waren es die Damen der Salons, die zu den Zusammenkünften der Gesellschaft neben den lukullischen Köstlichkeiten für den zündenden Gesprächsstoff, die Poesie und Kunst sorgen. Vielleicht sollten wir uns daher – in Zeiten von Social Media und Co. – ganz bewusst neu um die Kunst des „gepflegten Gesprächs“ bemühen. Keine schnellen Meldungen via SMS, What´s App oder Twitter, sondern etwas Tiefgründigeres, wie ein nachhaltiger Abgang bei einem guten Tropfen Wein oder die Crema, die etwas länger den Espresso ziert. Möge Ihnen dieses Buch einige Anregungen für den Gesprächsstoff bei Ihren Essenseinladungen geben. Damit Nachhaltigkeit und der Blick auf das Wesentliche nicht zu kurz kommen – genau wie beim Fasten!
EINLEITUNG
Fasten und genießen?
Auf den ersten Blick betrachtet scheint das ein Widerspruch zu sein. Der Genießer isst und trinkt, wonach ihm der Sinn steht, wer hingegen fastet, verbietet sich selbst jeglichen Genuss. Falsch! Wer fastet, verzichtet freiwillig auf Genussmittel und – für einen begrenzten Zeitraum – auf feste Nahrung. Da bleibt aber noch ein ganzes Universum an Dingen übrig, die man genießen kann! Fasten öffnet die Sinne. Wissen Sie noch, wie ein Glas frisches, kühles Quellwasser schmeckt? Oder wie der Frühling riecht? Wer fastet, beschäftigt sich bewusst mit seinem Körper und beginnt, den Blick nach innen zu richten. Ein Blick zurück in die Geschichte des Fastens und quer durch die verschiedenen Kulturen macht deutlich, wie das Fasten seit jeher eingesetzt wird, um das Bewusstsein zu erweitern und spirituelle Erfahrungen zu machen.
Während sich die großen spirituellen Väter zum Fasten noch in die Wüste zurückgezogen hatten, will dieses Buch Anleitung geben, wie man das Fasten in den Alltag integrieren kann.
GESCHICHTEDESFASTENS
Was haben die Geschichte der Reformation in der Schweiz und der Erscheinungstermin eines Buches mit den kirchlichen Fastengeboten zu tun? Viel, denn: Als ein Buchdrucker in der Schweiz seinen Gesellen, die härter als sonst arbeiten mussten, weil ein Buch zu einem bestimmten Termin erscheinen sollte, in der Fastenzeit Würste servierte und der Reformator Zwingli an diesem Mahl teilnahm, hagelte es Kritik von Seiten der Amtskirche. Zwingli verteidigte die Wurstesser: Gott sei es egal, ob der Mensch Fleisch oder Graupen esse. Der Streit setzte sich fort und führte schließlich dazu, dass 1525 der Rat der Stadt Zürich die Reformation einführte.
DIE GESCHICHTEZEIGT, DASS FASTENNICHT IMMER REINESPRIVATVERGNÜGENWAR, JA, DASS ESSOGAR (RELIGIONS-)POLITISCHE FOLGENNACH SICHZIEHEN KONNTE.
Die Geschichte zeigt, dass Fasten nicht immer reines Privatvergnügen war, ja, dass es sogar (religions-)politische Folgen nach sich ziehen konnte. Alle Religionen hatten und haben ihre Fastengeschichte, ihre Fastenregeln und Gebote. Zumeist waren es die Religionsgründer selbst, die der Überlieferung zufolge ihre spirituellen Erfahrungen aus intensiven Fastenzeiten bezogen. Jesus fastete in der Wüste 40 Tage und 40 Nächte, Mohammed zog sich zum Fasten in die Einsamkeit der Berge zurück, Gautama Buddha schreibt über seine Fastenerfahrungen: „Und wenn ich die Haut meines Bauches berühren wollte, so erfasste ich mein Rückgrat.“ Keine Religion kommt ohne Fastenzeiten aus. Juden fasten an Jom Kippur, einen Tag lang nur, dafür aber vollständig. Moslems dürfen im Ramadan einen ganzen Monat lang nichts essen und nichts trinken, allerdings nur tagsüber. Zahlreiche Fastentage kennen die Hindus, ein Anlass ist zum Beispiel der Tod eines Angehörigen. Praktizierende Christen fasteten jeden Freitag und in den 40 Tagen vor Ostern. In dieser Zeit war Fleisch verboten. Zählt man noch die drei Bettage vor Christi Himmelfahrt und die Vorabende vor wichtigen Heiligenfesten sowie die Mittwoche und Samstage, die in manchen Regionen auch als Fastentage galten, kam der mittelalterliche Mensch auf ungefähr 150 vorgeschriebene fleischlose Tage im Jahr. Neben Gemüse war auch der Verzehr von Fisch erlaubt, in einigen Gebieten waren auch Eier, Milch und Milchprodukte in der Fastenzeit verboten. Mandeln und Feigen hingegen galten als exklusive Fastenspeisen.
MANDELMILCH-REZEPT
Mandelmilch war ein grundlegendes Lebensmittel der mittelalterlichen Küche, denn sie war Ersatz für Kuh- oder Schafsmilch an Fastentagen.
Zu 7 Deciliter frischen Wassers nimmt man ungefähr 20 Stück ausgesuchte, gewaschene und mit einem Tuche abgetrocknete oder abgezogene Mandeln, stoßt sie fein und gibt dabei einige Tropfen Wasser dazu, damit sie nicht ölig werden. Wenn sie fein sind, verreibt man im Mörser nach und nach Wasser dazu, bis es wie Milch aussieht und drückt diese durch eine Serviette in ein Glas oder dgl. Die zurückbleibenden Mandeln werden wieder so gestoßen und, mit Wasser gemischt, ausgedrückt, was man wiederholt, solange das Wasser milchig wird. Beim Gebrauche zuckert man die Mandelmilch nach Geschmack, doch nicht in der Flasche, wenn man sie stehen lässt. Wenn sie lauwarm gegeben wird, füllt man für einmaligen Gebrauch in ein Glas und stellt dieses in warmes Wasser.
(aus: Katharina Prato: Die süddeutsche Küche. Graz 1894)
Warum Biber, Fischotter und Schildkröten zu den Fischen zählten
VON DER FISCHOTTER – DE LA LOUTRE DER GRÖßTE WERTH DIESER THIERE, WELCHE IN UND AUßER DEM WASSER LEBEN, BESTEHT IN DEM FELLE DERSELBEN, WELCHES ALS GUTES PELZWERK BEKANNT IST. IHR FLEISCH IST JEDOCH AUCH GENIEßBAR, GLEICHT AN FARBE DEM FLEISCHE DES ROTHWILDS UND WIRD ZUR ZEIT STRENGER FASTEN OFT SEHR THEUER BEZAHLT. ES BEHÄLT ABER IMMER EINEN STRENGEN GESCHMACK UND GEWÄHRT BEI DER KOSTSPIELIGSTEN ZUBEREITUNG DOCH NUR EINE SEHR MITTELMÄßIGE SPEISE, DIE NUR FÜR LÜSTERNE MENSCHEN SEIN KANN.
(aus: Neue vollständige theoretisch-praktische Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche von J. Rottenhöfer, Königl. Haushofmeister und vorher erstem Mundkoche weil. Sr. Maj. Des Königs Maximilian II. von Bayern. München um 1860)
DER MITTELALTERLICHE FASTEN-SPEISEPLAN
Findige Mönche und Kirchenväter fanden Mittel und Wege, die allzu strengen Verbote in der Fastenzeit listig zu umgehen. So hatte man zum Beispiel schon den Fisch als „uraltes Christuszeichen“ entdeckt, was ihn für die Fastentafel legitimierte. Im 15. und 16. Jahrhundert soll die klösterliche Karpfenzucht in Mitteleuropa so ausgedehnt gewesen sein, dass in der Regierungszeit Rudolfs II. Ende des 16. Jahrhunderts die Neuanlage von Karpfenteichen verboten wurde, weil nicht noch mehr Ackerland verloren gehen sollte.
Ganz ohne das Fleisch von Säugetieren hielten es die Mönche jedoch nicht aus. Im Mittelalter gelangten etwa die Embryonen von Wildkaninchen auf ihre Fastenspeisepläne, und weil sich Biber und Fischotter vorwiegend im Wasser aufhielten, wurden sie kurzerhand zu „Fischen“ erklärt – und waren somit frei zum Verzehr.
Ein ähnliches Schicksal erlitten die Sumpfschildkröten. Auch sie galten der katholischen Kirche als Fische und waren somit als Fastenspeise erlaubt. Selbst der Fluss- oder Edelkrebs, in Mitteleuropa noch vor 200 Jahren einer der häufigsten Bewohner unserer Flüsse und Bäche, war im Mittelalter als hervorragende Fastenspeise geschätzt. Ende des 19. Jahrhunderts war es jedoch mit einem Schlag vorbei: Die aus Nordamerika durch die dort vorkommenden Krebsarten eingeschleppte Krebspest vernichtete die Krebsbestände in den europäischen Gewässern fast vollständig.
DIE STEILE KARRIERE SO MANCHER FASTENSPEISE
So manches Gericht, das heute in den Restaurants der Weltklasseköche auf der Menükarte steht, hat eine steile Karriere hinter sich. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich das Prestige einer Speise nicht so sehr nach ihrem Wohlgeschmack bemaß, sondern oft mit ihrem Seltenheitswert zu tun hatte. Der Lachs etwa war lange Zeit eher ein Arme-Leute-Essen. In London protestierten Mitte des 19. Jahrhunderts die Lehrjungen, weil sie zu oft Lachs essen mussten. Zur Delikatesse wurde dieser Fisch erst im 20. Jahrhundert, als die Gewässer verschmutzt und die Bestände überfischt waren und der Lachs selten wurde. Ähnliches gilt für Hummer und Austern. In den „Pickwick-Papers“ von Charles Dickens steht noch zu lesen: „Es ist bemerkenswert, dass Armut und Austern immer zusammengehören. Hier gibt es auf jedes halbe Dutzend Häuser eine Austernbude. Und ich meine, bei Gott, wenn jemand sehr arm ist, dann geht er aus dem Haus und isst Austern in echter Verzweiflung.“ Im antiken Griechenland und in Rom galt die Auster allerdings immer schon als Delikatesse.
Und während Vollkornbrot heute um teures Geld im Naturkostladen eingekauft wird, war es über die Jahrhunderte das Brot für die Armen, die es sich nicht leisten konnten, Spelzen und Kleie auszusieben und nur das weiße Mehl zu verbacken. Das „Gesindebrod“, wie das Diaeteticon von 1682 es nannte, „nehret weniger / aber es gehet geschwinder unten ab“.
Flüssiges bricht das Fasten nicht
FASTEN MIT BIER UND SCHOKOLADE
Nach dem alten Grundsatz „Liquidum non frangit jejunum“, demzufolge „Flüssiges das Fasten nicht bricht“, stand in den Klöstern in der Fastenzeit vor allem Starkbier auf dem Speiseplan, angeblich infolge eines frommen Betruges: Da in der Vergangenheit noch sorgfältig geprüft wurde, was als Fastenspeise erlaubt war und was nicht, machte sich angeblich ein Mönch aus Bayern mit einem Fässchen Bier auf die Reise nach Rom. Als er nach Wochen dort angelangt war, war das Bier natürlich verdorben und der Papst sah darin keine sündige Verlockung mehr. Er konnte es getrost als Fastenspeise anerkennen.
Einem Papst war es auch zu verdanken, dass die Schokolade als Fastenspeise durchging. 1569 erklärte Papst Pius V.: „Dieses Getränk bricht das Fasten nicht!“. Er selbst fand es ohnedies abscheulich. Nicht so jedoch viele andere Kleriker. Die hohe Geistlichkeit in Rom liebte Kakao und Schokolade so sehr, dass 1662 ein neues, differenzierteres Kakao-Urteil nötig wurde. Kardinal Brancaccio erlaubte zwar weiterhin Flüssigschokolade, mit dem Verzehr von Ess-Schokolade musste man jedoch bis nach Ostern warten.
Wer seriös fasten wollte, war aber immer schon dem Wasser verpflichtet. Wasser war jedoch nicht zu allen Zeiten und an allen Orten in überzeugender Qualität vorhanden, und ist es – außer in den verhältnismäßig kleinen Wohlstandsgebieten Europas und Nordamerikas – bis heute nicht. Vor diesem Hintergrund sind die Warnungen antiker und mittelalterlicher Ärzte vor den Gefahren des Wassertrinkens zu sehen. Avicenna etwa, dessen lateinische Schriften vom 12. Jahrhundert an in Umlauf waren, empfahl den Kranken, statt Wasser doch besser Wein zu trinken …
CHOCOLADENSUPPE – SOUPE AU CHOCOLAT 280 GRAMM ZERRIEBENE GUTE CHOCOLADE LÄSST MAN MIT 21/10 LITER GUTER MILCH, 280 GRAMM ZUCKER UND EINEM HALBEN STÄNGELCHEN VANILLE NEBST EINER PRISE SALZ EINE HALBE STUNDE KOCHEN UND NIMMT WÄHREND DIESER ZEIT DIE HAUT ÖFTERS AB. BEIM ANRICHTEN WIRD SIE MIT EINER LIAISON VON FÜNF EIGELB LEGIRT UND ÜBER MIT ZUCKER GLACIERTEN BRODKRUSTEN ANGERICHTET.
(aus: Neue vollständige theoretisch-praktische Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche von J. Rottenhöfer, Königl. Haushofmeister und vorher erstem Mundkoche weil. Sr. Maj. Des Königs Maximilian II. von Bayern. München um 1860)
VOM GESCHÄFT MIT DEM FASTEN
„Gastwirte, Traiteurs und Garköche sind verpflichtet, an Fastentagen in der Regel Fastenspeisen zuzubereiten“, hieß es in einer Polizeiverordnung von 1829. Verstöße wurden gar mit „Gewerbesperre“ geahndet. Wer dennoch Fleisch essen wollte, zum Beispiel, weil er keinen Fisch vertrug („Allergien“ sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts!), der musste beim päpstlichen Nuntius um Erlaubnis ansuchen. Gegen entsprechende Gebühr wurde selbstverständlich die Genehmigung erteilt. In den wohlhabenden Schichten der großen Städte bedeutete die Fastenzeit häufig ohnedies, dass die Wirte und Köche einander mit „erlaubten“ Delikatessen überboten. Es gab eigene Kochbücher voll mit Rezepten von Austern-, Krebs-, Muschel- und Fischgerichten, nicht zu vergessen die Pilzgerichte und Süßspeisen! Ein Kochbuch von 1581 kennt bereits 63 Fastensuppen, 1719 verzeichnet Hagger 136 „vorschriftsgerechte“ Suppen.





























