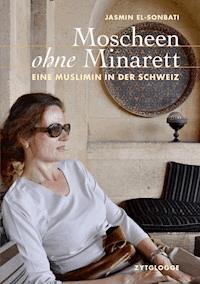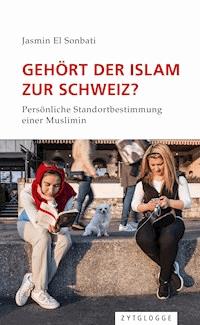
23,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Impulse für einen zeitgemässen Islam -Standortbestimmung einer Muslimin zum islamischen Leben in der Schweiz -Absage an falsch verstandene Toleranz auf der einen und Einfordern von Sonderrechten auf der anderen Seite -Auslegung des Koran in Übereinstimmung mit der demokratischen Verfassung Die erschütternden Vorkommnisse islamisch motivierter Gewalt und die Zweifel an der Kompatibilität des islamischen Glaubens mit den Werten einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung führen in weiten Teilen der westlichen Welt zu hitzigen Debatten. In der Schweiz bekennen sich laut Statistik etwa 5% der Bevölkerung zum Islam, das entspricht rund 450 000 Personen. Die Frage ist nicht, ob das viel oder wenig ist, und auch nicht, wie viel ‹Islam› die Schweiz ‹verträgt›. Es geht nicht um das ‹Wieviel› und auch nicht um das ‹Ob›, sondern um das ‹Wie›. Religiöse Toleranz bedarf nicht nur einer toleranten Gesellschaft und ebenso toleranter Religionen, sondern auch klarer Regeln für das Miteinander. Und was ist überhaupt ‹der Islam›? Dieses Buch ist kein Sachbuch über den Islam in der Schweiz. Es ist der Versuch, sich den vielfältigen Facetten, der Bandbreite an Religionszugehörigkeiten und Lebensentwürfen des Islam in der Schweiz zu nähern – aus Sicht einer Muslimin, die sich zu ihrem Glauben bekennt und sich kritisch mit diesem auseinandersetzt. Im Mittelpunkt stehen muslimische Menschen aus der Mitte der Schweizer Gesellschaft. Die Autorin betrachtet sie besonnen, ohne Verharmlosung oder Pauschalverdächtigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Ähnliche
Jasmin El Sonbati
Gehört der Islam zur Schweiz?
Jasmin El Sonbati
GEHÖRT DER ISLAM ZUR SCHWEIZ?
Persönliche Standortbestimmung einer Muslimin
© 2016 Zytglogge Verlag AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Edward Badeen
Coverbild: Martin Riggenbach
Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std
Gesamtherstellung: Schwabe AG, Muttenz/Basel
ISBN (epub): 978-3-7296-2133-6
ISBN (mobi): 978-3-7296-2134-3
www.zytglogge.ch
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Islam oder Islame?
Islamische Lebenswelten in der Schweiz
Das Tuch am Kopf, der Schleier am Körper – Hijab oder Niqab (oder keins von beiden)?
Was für eine Muslimin willst du sein, was für eine Muslimin bist du?
Der starke muslimische Mann – die schwache muslimische Frau – was ist dran am Stereotyp?
Zwei Muslime – und zwischen ihnen liegt das Meer …
Muslimisch-männlich-schwul
Welcher Islam ist eine Herausforderung für die Schule?
Imame und (keine) Imaminnen
2015, das (islamische) ‹annus horribilis›
Radikaler Islam ‹made in Switzerland›
Impulse für einen zeitgemässen Islam
Stand der Reformansätze im Islam
Der Koran, Gottes ‹Menschenwort›?
Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich
Free Raif Badawi – 1000 Peitschenhiebe für einen Blog
Die Frauen sind den Männern untertan
Zweifler, Skeptiker, Tabubrecher, Ketzer
Schlusswort
Danksagung
Über das Buch
Über die Autorin
Vorwort
Ein Serviceclub lädt Anfang Februar 2016 in Basel zu einer Abendveranstaltung zum Thema ‹Islam› ein. Ich werde gebeten, eine Einschätzung zu aktuellen geopolitischen Entwicklungen in der arabischen Welt und deren Auswirkungen auf Europa zu geben. Das Gespräch findet mit einem Moderator in sehr gepflegtem Ambiente statt.
Als ich den Veranstaltungsort erreiche, treffe ich Eltern ehemaliger Schüler, Studienkolleginnen, Personen aus Verwaltung, Privatwirtschaft, Kultur. Menschen, die mir im Laufe meines Basler Lebens begegnet sind. «Erinnerst du dich?», «Wie geht’s, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen?», «Sind Sie immer noch Lehrerin?», «In Ägypten sieht es gar nicht gut aus, was meinen Sie, sollen wir trotzdem auf Urlaub hinfahren?» Die Plaudereien kreisen beim Aperitif schon um das Thema der anschliessenden Diskussion. Die Anwesenden sind interessiert, sie bemühen sich, Ereignisse, die ihnen unverständlich sind, einigermassen einzuordnen.
Syrien, der IS, die Schweizer Dschihadisten, die Flüchtlingsströme, der Fremdenhass bei uns als Antwort auf die ‹Willkommenskultur›, die Kölner Silvesternacht, die muslimischen Machos und ihr Blick auf die westliche Frau. Es ist so viel, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ohne selbst in dieser hochkarätigen Runde zu klaren Ergebnissen zu gelangen. Es rückt alles näher zusammen, die böse Welt ist in der Schweiz angekommen, möchte man meinen. Krieg, Flucht, Extremismus, Gewalt, Ereignisse, die wir aus der ‹Tagesschau› kennen, bekommen nun ein konkretes Gesicht: der syrische Flüchtling in der Asylunterkunft im Quartier, die Freunde, die im November 2015 zum Fussballmatch nach Paris gereist und wie durch ein Wunder mit dem Leben davongekommen sind, der russische Arbeitskollege, dessen Cousin beim Flugabsturz der russischen ‹Aeroflot› im November 2015 in Sharm El Scheikh ums Leben gekommen ist. Die Geschichten sind ganz plötzlich nah. Und eines treibt die Anwesenden alle um: die Angst vor dem Islam.
Ob ich sie da beruhigen kann? Ich verzweifle ja selbst an alldem. Wobei ich keine Angst vor dem, sondern um den Islam habe.
Einleitung
«Der Islam gehört zu Deutschland.» Dieser Satz stammt aus der Grundsatzrede des ehemaligen deutschen CDU-Bundespräsidenten Christian Wulff anlässlich des 20. Jahrestages der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2010. In seiner Rede lobte Wulff die Vielfalt Deutschlands, zu der seiner Ansicht nach auch der Islam zu gehören schien. Zu dieser Zeit erregte sich Deutschland über die Thesen Thilo Sarrazins, der Migranten, vor allem den muslimischen, ein Minderwertigkeitsgen attestiert und eine hitzige Debatte um Leitkultur und abendländisch-christliche Werte losgetreten hatte. Wulff trat wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs am 17. Februar 2012 zurück; er verschwand von der politischen Bühne. Sein Satz lebte weiter.
Fünf Jahre später, nach den tödlichen Anschlägen auf das Satiremagazin ‹Charlie Hebdo› und den jüdischen Supermarkt ‹Hyper Cacher› vom 12. Januar 2015 in Paris, bekräftigte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grundaussage ihres Parteigenossen Wulff, wonach in Deutschland alle willkommen seien, unabhängig von ihrer Religion, solange sie sich zu den deutschen Gesetzen bekennen würden. In Deutschland leben 3,8 bis 4,3 Millionen Muslime. Das sind etwa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung.
Und wie ist es in der Schweiz mit Wulffs berühmtem Satz bestellt? Gehört der Islam auch zur Schweiz? Die Statistik weist ebenfalls etwa fünf Prozent der Bevölkerung als sich zum Islam Bekennende aus, rund 430 000 Personen. Die grösste Gruppe davon bilden Menschen aus dem Balkan, gefolgt von der Türkei und Nahost. Die Zugehörigkeit des Islams zur Schweiz ist jedoch nicht mit statistischen Erhebungen negativ oder positiv zu beantworten. Es geht um mehr: um die Frage des friedlichen Zusammenlebens der Menschen in einer demokratischen Gesellschaft mit liberaler Grundhaltung, wo Gleichberechtigung herrscht, wo Menschenrechte und Verfassung die Regeln bestimmen. Die Frage, ob der Islam zu Deutschland oder der Schweiz gehört, meint genau das.
Und genau daran bestehen zunehmend Zweifel.
Die Liste der Vorkommnisse islamisch motivierter Gewalt, die die Zweifel an der Kompatibilität des Islams und der Muslime mit dem Leben in einer freien Gesellschaft nähren, ist lang: 9/11 in New York (2001), Terror in Madrid und London (2004), Angriffe auf eine Synagoge in Frankreich (2012). Dann das Schreckensjahr 2015: die oben erwähnten Anschläge in Paris im Januar und im November des gleichen Jahres, wieder in Paris, mitten in der Stadt grossflächige Selbstmordattentate auf Unschuldige, begangen von IS-Heimkehrern. Im März 2016 zündeten wiederum belgische, vom IS rekrutierte Männer mehrere Bomben am Brüsseler Flughafen Zaventem und der Metrostation Maelbeek. Auch in Beirut, Nairobi, Nigeria, Tunis, Sharm El Sheikh brachten islamistisch verblendete Terroristen Menschen um. Die Gräueltaten des ‹Islamischen Staates› in Syrien und dem Irak übertreffen bisher Dagewesenes.
Die Anschläge von Nizza am ‹quatorze juillet›, der Axtangriff eines jugendlichen afghanischen Asylbewerbers in einem Regionalzug der Deutschen Bahn, der Bombenangriff eines Syrers anlässlich eines Musikfestivals im fränkischen Ansbach sowie die hinterhältige Ermordung des 86-jährigen Abbé Jacques Hamel in seiner Kirche im nordfranzösischen Saint-Etienne-du-Rouvray während der Morgenmesse durch zwei IS-Anhänger verbreiteten im Juli des Jahres 2016 Angst, Wut und ein Gefühl der Ohnmacht.
Der ‹Einzeltäter› – ohne Logistik, unerwartet, mit ‹Objekten aus Küche und Garten› schlägt er zu, jederzeit und überall. Diese neue Strategie der Terroristen zielt darauf ab, unsere offene, freie Zivilgesellschaft in eine Angstgesellschaft zu verwandeln.
Das ist längst nicht alles:
Der Islam verträgt keine Satire, Bücher, Zeichnungen, die den Koran oder den Propheten auf die Schippe nehmen oder kritisieren. Die muslimischen Reaktionen darauf, die sich immer nach dem gleichen medienwirksamen Muster abspielen, bestätigen das Problem, das viele Muslime damit haben, stets aufs Neue: wutentbrannte Menschen, vorwiegend Männer, vorwiegend jung, mehrheitlich bärtig, «Allahu Akbar» schreiend, Dschihad-Fahnen schwingend. Feuer, viel Feuer. Brennende Fahnen mit Füssen getreten. Erhobene Fäuste. Bürgerkriegsähnliche Szenarien vor westlichen Botschaften und die Ermordung Unschuldiger.
Bilder, die Angst und Unverständnis erzeugen, auch in der Schweiz.
Die Ereignisse der Silvesternacht vom 31. Dezember 2015 in Köln, wo Männer aus Nordafrika, darunter Flüchtlinge, junge Frauen sexuell belästigt und bestohlen haben, stellen die Frage, ob das nun der Dank dafür sei, dass Deutschland so grosszügig seine Türen und Tore geöffnet habe; und man lancierte eine berechtigte Debatte über das Frauenbild von Männern muslimischen Glaubens und die Integrationsfähigkeit der vor allem männlichen Flüchtlinge in Europa ganz allgemein.
Ablehnung, Angst, Wut dem Islam gegenüber sind die Folgen.
In der Schweiz manifestierte sich diese Angst vor dem Islam konkret im Spätherbst des Jahres 2009: Die Stimmberechtigten nahmen die Minarettverbotsinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) an, wonach es in der Schweiz verboten sein sollte, Moscheen mit Minaretten zu errichten. Die Initiative wurde angenommen, obwohl sich Bundesrat, Parteien, kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen gegen die Initiative ausgesprochen hatten. Die zu Raketen transformierten Minarette, die von voll verschleierten Frauen flankiert wurden, auf den SVP-Wahlplakaten überzeugten mehr als die Voten derjenigen, die von der Friedfertigkeit des Islams in der Schweiz überzeugt waren.
Ich weilte damals für einen längeren Aufenthalt in Kairo, den Abstimmungskampf habe ich aus der Ferne mitverfolgt. Die Tatsache, dass die Schweizer Bundesverfassung in Artikel 72 (‹Kirche und Staat›), Absatz 3, den Bau von Minaretten von nun an verbietet, bewog mich dazu, ‹Moscheen ohne Minarett. Eine Muslimin in der Schweiz› zu schreiben. Die Minarettverbotsinitiative weckte in mir das Bedürfnis, den Istzustand des Islams in der Schweiz und meine eigene Migrationserfahrung kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Seit dem Volksentscheid sind einige Jahre vergangen. In der Schweiz ist viel passiert. In der islamischen Welt auch. Der Traum vom ‹Arabischen Frühling› scheint vorläufig – ausgeträumt. Der Nahe Osten präsentiert sich als Minenfeld und Pulverfass zugleich. Der Jemen verstrickt sich in Stammesfehden. In Saudi-Arabien, der Festung des sunnitischen Islam, gärt es beständig. Für eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts fehlt der politische Wille. In Ägypten ist es noch schlimmer geworden als unter Mubarak, das Ancien Régime rehabilitiert sich bestens, Meinungsvielfalt wird mit Füssen getreten. Lybien ist zerfallen, und der IS baut dort eine neue Basis auf. Und dann die syrische Katastrophe: eine halbe Million Tote, ein Land in Ruinen.
Die Schweiz ist keine Insel. Auch ohne Minarette bleibt sie von den geopolitischen Entwicklungen in islamischen Ländern nicht verschont. Zum einen sind es die syrischen und irakischen Flüchtlinge, in der überwiegenden Mehrheit muslimischen Glaubens, die nach Europa strömen, auch in die Schweiz. Zum anderen muslimische Männer und Frauen, die mitten unter uns radikalisiert worden und in das Gebiet des ‹Islamischen Staates› ausgereist sind. Der Bundesnachrichtendienst beziffert die Schweizer Dschihadreisenden mit ungefähr 70 (Stand 2015). Last but not least, eine kleine, aber sichtbare muslimische Community, die einer fundamentalistischen Lesart des Islam folgt und die Mehrheitsgesellschaft oft vor den Kopf stösst.
Die Wahrheit, auch die Wahrheit über den Islam in der Schweiz, liegt bekanntlich in der Mitte. Es gibt diejenigen, denen man es gar nicht ‹ansieht›, dass sie muslimischen Glaubens sind, die sich zwar als muslimisch bezeichnen, nicht aber manifest als solche auftreten. Sie leben den Glauben unauffällig für sich. Sie beten, fasten, gehen entweder regelmässig, ab und zu oder gar nicht in eine Moschee. Manche sind aktive Mitglieder eines Moscheevereins, andere sind nur Feiertagmuslime. Auch Moscheemeider gibt es. Den Statistiken entsprechend sind sie die Hauptgruppe in unserem Land. Und dann natürlich diejenigen, die sich von der Religion des Islam entfernt haben und sich nur noch als Kulturmuslime bezeichnen.
Angst und Vorbehalte gegenüber dem Islam nehmen trotzdem nicht ab, im Gegenteil. Ein Anlass also, sich dem Islam in der Schweiz im Lichte dieser Vorbehalte zu nähern.
Muslime sind keine besonderen Menschen. Sie stehen früh auf, lernen für eine Prüfung, werden von der oder dem Liebsten verlassen, haben Übergewicht, konsumieren im Überfluss oder bescheiden, gehen Samstagnachmittag in die Innenstadt shoppen, am Sonntag ins Fussballstadion. Sie feiern Geburtstag, fahren in Urlaub, trauern, wenn jemand stirbt. Trotz der ‹Normalität› der meisten bestehen Tendenzen, Muslime in der Schweiz unter den Generalverdacht der Rückständigkeit, Gewaltbereitschaft und Demokratiefeindlichkeit zu stellen. Diese Einschätzung kann auch zutreffen. Manche sind tatsächlich kriminell, engstirnig, verbohrt, geben Frauen nicht die Hand, sperren ihre Töchter ein und halten den Islam für die beste Sache, die Allah der Menschheit beschert hat.
Der Schweizer Islam ist weder vor Unzulänglichkeiten gefeit noch fehlt es ihm an spirituellen Impulsen für ein friedliches Zusammenleben. Das Phänomen der Radikalisierung hat auch die Schweiz ergriffen, es hilft nicht, das kleinreden zu wollen. Salafisten, die in Parallelwelten leben und sich in einem Kokon aus koranischen Regeln abschotten, sind unter uns. Selbst wenn sie eine Minderheit sind, wie statistisch belegt, müssen wir darüber sprechen, welches Gedankengut, welcher Islam von ihnen ausgeht. Ein unguter, wie ich vorausschicken möchte.
Pauschalisierungen, ob gut oder schlecht meinende, sind einer demokratischen Gesellschaft unwürdig. Die schlechten spielen rechtspopulistischen Parteien in die Hände, die sie instrumentalisieren, um Nichtmuslime gegen Muslime aufzustacheln. Extreme Positionen finden einen fruchtbaren Nährboden, stiften Unruhe und gefährden den sozialen und religiösen Frieden. Es entsteht das, was man gemeinhin als ‹Islamophobie› bezeichnet – in der Schweiz natürlich ungleich weniger präsent als in Frankreich, unserem von Terroranschlägen gebeutelten Nachbarland.
Gleichzeitig nützt es nichts, geblendet vom ‹Islam des ewig Guten›, Probleme, die sich aus dem Zusammenleben ergeben, einfach auszublenden. Wegschauen und falsch verstandene Toleranz, wenn die muslimische Seite Sonderrechte für sich einfordert oder im Namen der Religionsfreiheit ‹Carte blanche› für unzeitgemässe Werthaltungen verankern will, schadet dem Miteinander ebenso. Dies betrifft vor allem schulische Institutionen, den öffentlichen Raum und das Verbreiten von verfassungswidrigen Botschaften in der Moschee oder anderswo.
Ich bin der Auffassung, dass wir in der Schweiz über die Bücher müssen.
Erstens sei die politische Rechte daran erinnert, dass nicht sie die Riege der Fortschrittlichkeitsgläubigen in diesem Land anführte. Seit den Überfremdungsintitiativen der Siebzigerjahre – damals waren es die Ausländer aus Italien und Spanien – trägt sie einen Diskurs der Unterlegenheit des Fremden gegenüber der Überlegenheit des Schweizerischen vor sich her. Fakt ist, dass das Frauenstimmrecht (1971) und das Familienrecht (1988 revidiert) in der Schweiz erst sehr spät eingeführt wurden – und dies nicht auf Initiative der Rechten. Es gereicht diesem Land nicht zur Ehre, wenn sich Positionen derart verhärten, dass politische Hetze gegen Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens betrieben wird und Gedankengut wie das der ‹Pegida› (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) in der Schweiz Einzug hält, wie es in Deutschland bereits der Fall ist.
Zweitens dürfen die Institutionen des Staates und der Zivilgesellschaft nie vergessen, dass die Grundrechte hart erkämpft wurden. Sie stellen keine Exklusivrechte der nichtmuslimischen Bevölkerung dar, und man kann denen, die das ‹ein wenig anders sehen›, nicht einfach Zwischenlösungen anbieten. Musliminnen und Muslime müssen nicht mit relativierenden Sondergenehmigungen behandelt werden, sie dürfen diese auch nicht beanspruchen. Wir sind weder Opfer noch manövrierbare Masse. Wir brauchen kein Gutmenschentum. ‹Wir› Musliminnen und Muslime leben in einem Staat mit Rechten wie politische Partizipation, Religions- und Meinungsfreiheit, die wir geniessen. Genauso wie alle anderen nichtmuslimischen Menschen haben wir Pflichten, wie z. B. uns an die Rechtsordnung zu halten, unsere Steuern zu zahlen und die Normen der hiesigen Gesellschaft zu akzeptieren. Jeder Muslim, jede Muslimin soll, wenn er oder sie es wünscht, ihre Religion praktizieren, aber auf eine Weise, dass sie sich dabei nicht ins Abseits manövrieren und sich dadurch selbst aus der Gesellschaft ausschliessen. Das ist dem Zusammenleben abträglich.
Drittens sind die Imame, Religionsgelehrten und muslimischen Landesverbände der Schweiz gefordert, die Botschaft des Islam in Übereinstimmung mit der Schweizerischen Verfassung zu interpretieren und nicht umgekehrt. Sie müssen sich ohne Wenn und Aber vom Gewaltpotenzial des Islam verabschieden. Sie sollen sich für eine zeitgemässe Lesart des Korans einsetzen und so einen konstruktiven Beitrag zur innerislamischen Debatte leisten. Wir müssen uns entstauben!
Viertens sind die muslimischen Gemeinschaften und Moscheevereine aufgerufen, sich darum zu bemühen, aus der Moschee einen offenen Ort des Spirituellen und der Diskussion zu machen; dabei sollen alle willkommen sein, auch die bisher Ausgeschlossenen: die muslimischen Atheisten, Freidenker, Skeptiker, Mitglieder der ‹LGBT›-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) und nicht zuletzt auch Frauen als Imaminnen.
Seit der Veröffentlichung meines ersten Buches bin ich eine Islamreisende durch die Schweiz. In den Gesprächen, Begegnungen, Debatten mit religiösen, politischen, zivilgesellschaftlichen Kreisen, die ich in den vergangenen Jahren führte, habe ich eine stark heterogene, sich im Wandel befindliche Community wahrgenommen, deren Teil ich bin und der ich kritisch gegenüberstehe.
Das vorliegende Buch ist der Versuch, sich den vielfältigen Facetten, der Bandbreite an Religionszugehörigkeiten und Lebensentwürfen des Islam der Schweiz zu nähern und diese zu beschreiben, ohne Verharmlosung, mit Besonnenheit und kritischem Menschenverstand.
Dieses Buch ist kein Sachbuch über den Islam in der Schweiz.
Im Mittelpunkt stehen muslimische Menschen aus der Mitte der Schweizer Gesellschaft. Mich interessieren ihre individuellen Lebensstile, Glaubensprofile, Auffassungen, aktuellen Lebenssituationen. Ich will erfahren, wie sie denken. Bereiten sie, bereiten wir wirklich so viele Probleme im Alltag, wie in den Medien und in der Politik behauptet wird?
Der Zugang über das Private ist bewusst gewählt: Ich bin der Überzeugung, dass eine Annäherung an die Frage ‹Gehört der Islam zur Schweiz?› nur über den Blick auf den Einzelfall geschehen kann. Die Menschen, die im Mittelpunkt stehen, erheben nicht den Anspruch, das muslimische Spektrum der Schweiz vollständig zu repräsentieren, aber es sind Menschen, die unsere Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde sind oder sein könnten.
Im ersten Teil, ‹Islamische Lebenswelten in der Schweiz›, beschäftige ich mich mit Themen im Zusammenhang mit dem Islam, wie sie in der Schweizer Öffentlichkeit präsent sind, wie weibliche Bedeckungsformen, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, Islam und Schule, Islam und Homosexualität, die Imame und ihre Moscheen, der islamische Radikalismus.
Im zweiten Teil, ‹Impulse für einen zeitgemässen Islam›, geht es mir um eine innerislamische Reflexion, in der ich versuche, bestehende Ansätze einer zeitgemässen islamischen Lehre weiterzudenken.
Ich hoffe, abschliessend eine schlüssige Antwort auf die Frage zu finden, ob der Islam zur Schweiz gehört. Und wenn ja, in welcher Form?
Islam oder Islame?
Der Islam, die Muslime – beide Begriffe, die Religion und ihre Angehörigen bedürfen einer näheren Betrachtungsweise, denn die herkömmliche sprachliche Benennung greift längst nicht mehr, um dem Thema gerecht zu werden.
‹Den› Islam, ‹die› Muslime gibt es nicht.
Es sind Menschen, die je nach nationalem, bildungsbiografischem, sozialem, individuellem, lebenssituativem Hintergrund entschieden haben, gewisse Traditionen und Praktiken des Islam in ihrem Alltag umzusetzen oder nicht. Letztlich entscheidet jeder Muslim, jede Muslimin, inwieweit muslimisch zugehörig er oder sie sich (noch) fühlt.
Der Einfachheit halber bezeichne ich diejenigen, die sich als Muslime ausweisen, als solche. Sie gehören der Religion des Islam an.
In der Schweiz leben circa 430 000 Menschen muslimischen Glaubens, das sind im Grunde genommen viele islamische Richtungen. Die Gemeinschaft ist sehr heterogen. Dies geht auf die Etablierung der Gemeinschaften durch die erste Migrantengeneration zurück. Ich selbst war Mitte der Siebzigerjahre in der Gründungssitzung eines der ersten Islamzentren des Kantons Zürich dabei. Heute gibt es in jeder grösseren Schweizer Stadt Islamvereine, die von mazedonischen, bosnischen, albanischen, türkischen, arabischen Muslimen zum Freitagsgebet und zu religiösen Feiern aufgesucht werden. In manchen Islamvereinen wird Religions- und Arabischunterricht erteilt.
Worin besteht nun das, was Musliminnen und Muslime jenseits nationaler Zugehörigkeiten und Traditionen, persönlicher Nähe oder Ferne zur Religion verbindet? Wovon haben wir alle Kenntnis bezüglich der Religion des Islam, eingedenk unserer unterschiedlichen Glaubenspraxis oder deren Absenz in unserem Leben?
Erstens: die fünf Säulen. Das Glaubensbekenntnis, d. h. der Glaube an einen Gott und an seinen Propheten Mohammed, das tägliche Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Armensteuer des Wohlhabenden an den Bedürftigen und die Wallfahrt nach Mekka sind das Herzstück des Islam. Es sind Kultushandlungen, die den Gläubigen den Weg zu einem gottgefälligen, frommen Leben weisen sollen. Die fünf Glaubenspfeiler beziehen sich auf zwei Ebenen der Lebensführung: zum einen auf die individuell-spirituelle Beziehung des Menschen zu Gott und zum anderen auf die Einbindung des Einzelnen in die Gemeinschaft.
Moses und Jesus sind aus islamischer Perspektive Propheten wie Mohammed selbst. Juden und Christen sind ‹ahl al kitâb›, (arab. ‹Buchreligionen›) und haben mit Abraham den gleichen Stammvater.
Zweitens: die Grundlagen bzw. Schriftquellen, auf die der Islam gründet. Da ist zunächst der Koran, das heilige Buch des Islam, bestehend aus 114 Kapiteln (arab. ‹Suren›), das dem Propheten Mohammed offenbart wurde. Seine Entstehungsgeschichte bezeichnet der Berner Islamwissenschaftler Reinhard Schulze aus historischer Perspektive als einen «Prozess des Sammelns». Der jetzige Text ist keine «Mitschrift» der Offenbarungen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass der Koran keineswegs schon die Gebote an sich beinhaltet. Er muss noch erschlossen werden. Das Erschliessen der Verse, ihre Deutung geschieht durch den ‹Idschtihad›, eine persönliche, intellektuelle Rechtsfindung. In der islamischen Tradition haben sich Rechtsschulen etabliert, die diese Rechtsfindung vorantreiben. Die Rechtsschulen differieren danach, wie eng oder wie weit der Interpretationsspielraum gesteckt wird. Die hanbalitische Rechtsschule, die auf der Arabischen Halbinsel vorherrschend ist, ist die strengste und konservativste. Auf ihr gründet das Islamverständnis der saudischen Wahhabiten. Mit dem Kommentar (arab. ‹tafsîr›) der koranischen Verse, d. h. deren sprachlicher, sinngemässer Bedeutung befassen sich Kommentatoren.
Der Koran ist die Hauptquelle des Islam, aber nicht die einzige. Die zweite Entfaltungs- bzw. Deutungsquelle ist die ‹Sunna› des Propheten; darunter versteht man seine Weisungen und seinen Brauch, die in ‹Hadithen›, d. h. mehr oder weniger vertrauenswürdigen Aussprüchen zusammengefasst sind.
Aus diesen beiden Quellen, nämlich dem Koran und den Hadithen wird Recht erschlossen, die ‹Sharia›. Sie fusst auf Gesetzesversen des Korans und der Hadithe, also den Aussprüchen des Propheten und von Menschen, die zu seinem Umfeld gehört haben. ‹Sharia› bedeutet Weg, Heilsweg, den Gott dem Menschen durch sein Gesetz weist.
Innerhalb der Religion des Islam gibt es zwei Hauptgruppierungen, die Sunniten und die Schiiten. Die Spaltung zwischen ihnen entstand aus einer kriegerischen Auseinandersetzung um die politische Nachfolgeregelung des Propheten nach dessen Tod. Die Gruppe um Ali, den Vetter des Propheten, vertrat die Meinung, dass die Nachfolge des Propheten aus dem eigenen Hause bestellt werden müsse. Sie nennen sich ‹Shiat Ali› (arab. ‹Anhängerschaft von Ali›). Zum Kalifen (arab. ‹Nachfolger›) wurde schliess-lich einer der Gefährten Mohammeds, Abu Bakr, gewählt. Die Mehrheit der Muslime befand nämlich, dass nur dem Besten unter den Gefährten Mohammeds das Recht zustehe, die Gemeinde zu leiten. Sie nennen sich ‹Sunniten›, d. h. diejenigen, die der ‹Sunna› (arab. ‹Brauch, Sitte›) Folge leisten.
In der Schweiz leben in der überwiegenden Mehrheit Sunniten.
Im Zusammenhang mit der Radikalisierung innerhalb des Islam treten Salafisten in Erscheinung. Es handelt sich um Muslime, die dem Koran, dem Leben des Propheten und seiner Gefährten folgen. Der Begriff ‹Salafist› leitet sich vom arabischen Wort ‹Salaf›, (arab. ‹Vorfahre›) ab. Salafisten predigen die Rückkehr zum ‹Ur-Islam›, sie propagieren eine buchstabentreue Auslegung des Islam und sie orientieren sich an dem, was der Prophet vorgelebt haben soll. Genau das wollen sie imitieren.
In der gesamten islamischen Welt haben sich vorislamische Traditionen mit islamischen vermischt: im Maghreb die Kultur der Berber, in Ägypten der Totenkult des Alten Ägypten. Der Islam in Afrika trägt Züge der afrikanischen Kulturen. Es entfaltet sich eine vielfältige Religionslandkarte.
In diesem Sinne gibt es den Islam und die Muslime nicht.
Wir, Musliminnen und Muslime, vertreten eine Diversität an islamischen Traditionen, Anschauungen, Prägungen, die sich im kleinsten gemeinsamen Nenner trifft und unter ‹Islam› subsumiert wird.
Von uns ist im Folgenden die Rede.
Islamische Lebenswelten in der Schweiz
Das Tuch am Kopf, der Schleier am Körper – Hijab oder Niqab (oder keins von beiden)?
Meine Reise durch die Islamwelten der Schweiz setzt im Spätsommer des Jahres 2010 ein. Ich kam gerade von einem einjährigen Aufenthalt aus Ägypten zurück. In diesem Jahr erlebte ich den ‹Vormärz› der ägyptischen Revolution, die sich am 25. Januar 2011 auf dem Tahrir-Platz im Herzen der Stadt Kairo entlud. Ich tauchte ein ins heutige Ägypten, suchte Orte der Kindheit und Jugend sowie Familienmitglieder auf, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Ich wollte miterleben, wie sich das Land und die Menschen, in dem und mit denen ich aufgewachsen war, verändert hatten. Rückzug aus der Schweiz, Spurensuche in Ägypten. Daraus entwickelte sich in mir das Bedürfnis, die Migrationsgeschichte meiner Eltern und meine eigene aufzuarbeiten. Mein Buch ‹Moscheen ohne Minarett. Eine Muslimin in der Schweiz› war das Resultat dieser Reflexionen.
Als ich in die Schweiz zurückkehrte, befand sich das Land gerade in Aufruhr über den ‹Niqab›, die Vollverschleierung muslimischer Frauen. Angelehnt an das Niqab-Verbot in Frankreich (September 2010) wurde auch in der Schweiz eine Debatte über Sinn bzw. Sinnlosigkeit dieses vermeintlich islamischen Frauengewandes geführt. In der Schweiz hat sich das Verbot, einen Vollkörperschleier zu tragen, im Kanton Tessin (September 2013) durchgesetzt. Der Niqab ist ein Phänomen, das in der Schweiz praktisch inexistent ist, abgesehen von den reichen saudischen Touristinnen, die ihren Sommerurlaub in der Stadt Genf verbringen. In dieser multikulturellen Stadt gehören sie zum sommerlichen Strassenbild. Übrigens verbergen längst nicht alle Golfaraberinnen im Ausland ihr Gesicht, vor allem die jüngeren geniessen es, wenn sie die modischen Outfits, die sie nur aus dem Fernsehen kennen, endlich in ‹Echtzeit› anziehen können.
In Ägypten gehört der Niqab mittlerweile zum Alltag, trotzdem ist er wie in der Schweiz Gegenstand heftiger Grabenkämpfe. Die Befürworter, streng praktizierende islamische Kreise, zitieren Sure 33, Vers 59: «Prophet! Sag deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen (wenn sie hinaustreten) sich etwas von ihrem Gewand (über den Kopf) herunterziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie (als ehrbare Frauen) erkannt und daraufhin nicht belästigt werden. Allah aber ist barmherzig und bereit zu vergeben.» (Übersetzung: Rudi Paret). Diese Verse werden von einigen so verstanden, dass sie für alle Frauen gelten. In Ägypten hat man sich an die von Kopf bis Fuss schwarz bekleideten Frauen gewöhnt, ein Verbot wie in Frankreich, Belgien oder dem Tessin steht nicht zur Diskussion. Der Niqab hat sich als Variante frommen Lebensstils durchgesetzt. Die Niqab-Unterstützer berufen sich auf die Religionsfreiheit, die tatsächlich in der ägyptischen Verfassung verankert ist.
Die theologischen Gegenargumente, sogar von der renommierten Lehrstätte des sunnitischen Islam, Al Azhar, vertreten, verweisen darauf, dass die zitierten Verse an die Ehefrauen des Propheten Mohammed gerichtet und somit nicht für die Gesamtheit der Frauen bindend seien. Moderat praktizierende Muslime aller Schichten, Vertreter des verwestlichten Bürgertums, Intellektuelle, Frauenrechtlerinnen halten ebenfalls mit harten Bandagen dagegen. Der Niqab wird als Rückschritt und Import aus dem wahhabitischen Saudi-Arabien gebrandmarkt. Ägypten war die Wiege der Frauenemanzipation in der arabischen Welt: Die ägyptische Frauenrechtlerin Huda Sha’arawi (1879–1947) hatte nach ihrer Rückkehr vom Internationalen Frauenkongress in Rom im Jahre 1923 ihren weissen Gesichtsschleier öffentlich abgelegt und damit die Epoche des Kampfes für Gleichberechtigung in Ägypten eingeläutet.
Eine weitere Gruppe schliesslich hat, jenseits der ideologischen Perspektive, sicherheitstechnische Bedenken. Wie könne man sicher sein, dass sich wirklich eine Frau unter dem Schleier verberge und nicht ein Mann? Was die ‹Sicherheitsbefürchtungsthese› erhärtet, ist die Tatsache, dass an Abschlussprüfungen ägyptischer Universitäten manchmal verschleierte Männer entdeckt werden: männliche Verwandte von Studentinnen oder sogar bezahlte ‹Prüfungsschreiber›, die aufgrund besserer Kenntnisse der Materie anstelle einer Studentin das schriftliche Examen ablegen. Solche vorgaukelten Identitäten werden ab und zu enttarnt, was man dann in den ‹Vermischte-Meldungen-Rubriken› der Zeitungen nachlesen kann. Karikaturisten und Witzeerzähler, beflügelt durch diese Maskeraden, nehmen diese Vorfälle auf die Schippe. Der Niqab gilt paradoxerweise auch als Gefahr für den Moralzerfall bei der ägyptischen Jugend. So kommt es zuweilen vor, dass sich junge Männer des Niqab bedienen, um sich Zugang zu ihren Freundinnen in Studentenheimen zu verschaffen. In einer wertkonservativen Gesellschaft wie der ägyptischen ist unkontrollierter Kontakt zwischen unverheirateten Männern und Frauen nicht gestattet. Während der Regierungszeit der Muslimbrüder in Ägypten (2012–2013) wurde der Niqab zum Negativsymbol der Islamisten schlechthin. Die Vorbehalte dagegen haben seither zugenommen, er ist trotzdem verbreitet, und nicht nur bei der ärmeren Bevölkerungsschicht.
Dazu eine Episode aus den Familienannalen:
Die engeren Familienmitglieder waren zu einer Verlobung, einer ‹Quira’at el Fatha›, dem Rezitieren der ‹Fatiha› (arab. ‹erste Sure des Korans›), geladen, wo die Eltern von Braut und Bräutigam die Verbindung ihrer Kinder verkünden. Diese Zeremonien bekräftigen, unter Einbezug der Schwiegerfamilie, die ‹ernsten› Absichten des Mannes gegenüber der Frau. Dieser bekundet sein Eheversprechen vor versammeltem Clan. Es gibt ein ägyptisches Sprichwort, das besagt, ‹jemand (also der Mann) kommt durch die Tür und nicht durchs Fenster herein›. ‹Durchs Fenster hereinkommen› ist Synonym für ‹Beziehung mit unehrlichen Absichten›, eine Beziehung, die eben nicht zur Ehe führt.
Man geht davon aus, dass die Präsenz des engsten Kreises das Pflichtgefühl des Mannes verstärkt. In konservativen Familien bekommen die jungen Leute erst nach der Verlobung die Erlaubnis, alleine miteinander auszugehen.
An einer solchen ‹Chutuba› (arab. ‹Verlobung›) in einer eleganten Vorstadt am Rande Kairos empfingen uns die Brauteltern in ihrem gepflegten Einfamilienhaus mit Garten. Die Familie war gut situiert. Die Dame des Hauses, das sickerte im Voraus durch, sollte eine ‹Munaqqaba›, eine Vollverschleierte, sein. Wir wunderten uns, wie das wohl zusammenpassen würde: Eleganz, Wohlstand plus Vollverschleierung? Meine Cousine und ich waren furchtbar neugierig darauf. Wir kamen also in der Einfamilienhaus-Siedlung europäischen Zuschnitts an. Diese Vorstadt im Hollywoodstil hat nichts mit Ägypten zu tun. Kein Lärm, keine Armut, nur schöne Häuser und Menschen. Der Hausherr begrüsste uns und bat uns in den reich dekorierten Garten. Überall hingen bunte Lämpchen in Regenbogenfarben, westliche Instrumentalmusik im Hintergrund. Die ersten Gäste waren schon angekommen, die Mehrheit der Frauen hatte den Kopf bedeckt, passend assortiert zu den glitzernden Abendroben. Die jüngeren trugen Partykleider aus Taft und Organza mit und ohne Kopftuch. Die Gäste sassen an runden Tischen und unterhielten sich angeregt, alle genossen den lauen Kairoer Herbstabend. Endlich erschien die Gastgeberin, eine Dame mittleren Alters, mir reichte sie die Hand, meinem Vater nickte sie zu. Ihr Niqab war wirklich speziell, nicht ein übergestülptes Gewand, nein, ein kunstvoll um den Kopf gebundener Turban, aus dem sich ein wertvolles Stück Seide mit der Aufschrift des italienischen Modelabels ‹Dolce & Gabbana› um den unteren Gesichtsteil schmiegte. Sie trug ein elegantes langes Soiree-Kleid. Sie sah wirklich gut aus. Meine Cousine Suheir, selbst Kopftuchträgerin, nie um einen Seitenhieb verlegen, mokierte sich über den «Designer-Niqab», wie sie ihn nannte. Die Brautmutter zeigte uns eine kreative Schickimicki-Variante dessen, was wir beide einhellig ablehnten. Sicher, der Designer-Niqab war ästhetisch, überzeugt hat er mich trotzdem nicht.
Es gibt auch einige Musliminnen in der Schweiz, die sich für den Niqab entschieden haben. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Gesehen habe ich auf Schweizer Strassen in den letzten zehn Jahren vielleicht eine oder zwei. Gibt es womöglich eine Dunkelziffer? Trauen sich die Frauen aus Angst vor Übergriffen nicht aus dem Haus? Oder wird hier ein Problem konstruiert, das gar keines ist?
Eine, die sich dafür entschieden hat, ist Nora Illi, Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats Schweiz, IZRS, der Vereinigung, die nach der Minarettverbotsinitiative gegründet wurde. Bis anhin hatte ich den Werdegang dieser Gruppe in den Medien eher halbherzig verfolgt, sie zugegebenermassen ein wenig belächelt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass in der Schweiz die strenge Lesart des Islam wahhabitischer Ausrichtung Anhänger finden würde. Nun also kam sie in einem ‹Zischtigsclub› (11.5.2011) zu Wort, wo sie u. a. mit Musliminnen wie Amira Hafner-Aljabaji, Präsidentin des interreligiösen Think Tank, und Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam, in den Ring trat. Nora fühle sich frei unter dem Schleier, sie entziehe sich dem Schönheitswahn, zeige, dass es ihr um innere Werte gehe. Die Schweizer Verfassung gestehe ihr schliesslich zu, ihre Religion so zu leben, wie sie es für richtig halte.
Diese ‹Freiheit unter dem Schleier› ist mir nicht fremd. Mein Niqab-Selbstversuch in der Innenstadt Kairos, erprobt am eigenen Leib, um nachzuvollziehen, wie es sich anfühlt, vollständig verhüllt zu sein, vermittelte mir tatsächlich einen Hauch von Freiheit. Ich bewegte mich wie eine Königin in Kairos überfüllten Strassen, man wich zur Seite, machte mir Platz. Die schwarze ‹Freiheit› bescherte mir jedoch eine solche Atemnot, dass ich mich auf der Damentoilette eines Hotels des Umhangs entledigte (ausführliche Beschreibung in ‹Moscheen ohne Minarett›). Um kein Gebot der Welt wäre ich bereit, mich unter den Niqab zu begeben! Nicht so Nora Illi. Sie sah darin eine spirituelle Dimension, die sie Gott näherbringe. Einem Gott, dem sie dienen wolle.
Die Emotionen kochten hoch in dieser Diskussion rund um die Gesinnung von Nora Illi. Die anderen Diskussionsteilnehmerinnen waren aufgebracht. Saïda Keller-Messahli, Gegnerin des Niqab, warf Nora Illi «Exotismus» vor. Die Art, wie sie sich anziehe, sei eine Zumutung, sie trage etwas, das mit dem Islam unvereinbar sei. Der Niqab mache den weiblichen Körper zu einer amorphen Form, um die Frau von der Aussenwelt abzuschotten. Amira Hafner-Aljabaji, Islamwissenschaftlerin, vertrat eine andere Position. Sie verwarf den Niqab persönlich wie religiös, die Vollverschleierung lasse sich nicht mit dem Koran rechtfertigen. Sie zeigte hingegen Verständnis dafür, dass eine Frau das Recht habe, sich aus freien Stücken so zu kleiden, wie es ihr beliebe. Sie pochte auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau, für das Feministinnen gekämpft hätten. Dieses Recht könne man nicht rückgängig machen, nur weil es für eine Gesinnung stehe, die dem Feminismus und der Mehrheit der Gesellschaft nicht in den Kram passe.
Die Basler Zeitung betitelte die TV-Kritik zur Sendung mit ‹Das sprechende Tuch›. Nora Illi machte auf mich einen sehr einsamen Eindruck. Sie tat mir ein wenig leid. Im Fauteuil des Fernsehstudios sass eine allein gelassene Frau, die ringend für ihre Sache warb.
Das Abstimmungsresultat im Tessin hat gezeigt, dass der Niqab in der Öffentlichkeit nicht gewünscht wird. Die Argumente, die gemeinhin gegen den Niqab ins Feld geführt werden, sind Sicherheit im öffentlichen Raum, Degradierung der Frau zum Objekt, der Zwang, den Niqab zu tragen, und die Sichtbarkeit des Gesichts für den sozialen Austausch. In einigen Punkten unterscheiden sich Niqab-Gegner in Ägypten, Tunesien nicht von den Schweizern, die Bedenken äussern. Politik, Zivilgesellschaft, konfessionelle Institutionen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen haben Erklärungsnotstand zum Thema ‹Muslimische Gesichts- und Kopfbedeckung der Frau›. Die Schweiz ringt in der Frage der religiösen Symbole, als solches gilt ja die Bedeckung, um eine faire Antwort. Dass der Islam einen besonderen ‹Status› einnimmt, hängt mit der geopolitischen Weltsituation seit dem 11. September 2001 zusammen, die den Islam und alles, was damit in Verbindung steht, zu einer Religion der Gewalt abgestempelt hat. Und je manifester sich diese Gewalt artikuliert, umso deutlicher wird die Ablehnung ihr gegenüber. Der Schweizer Staat hat einerseits die Aufgabe, sich religionsneutral zu verhalten und die Werte der Minderheiten zu schützen, andererseits sind Unverständnis und Angst eines Teils der Bevölkerung ebenfalls Realitäten, mit denen sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss. Eine sachliche Debatte würde rechtspopulistischen Kreisen den Wind aus den Segeln nehmen, den religiösen und gesellschaftlichen Frieden wahren. Allerdings stelle ich mir schon die Frage, ob einem so heissen Eisen wie dem Niqab tatsächlich mit Entschleunigung beizukommen ist. Ich finde, man sollte es zumindest versuchen.
Die dem Islam zugeschriebenen Bedeckungsformen des weiblichen Gesichts und/oder des Körpers trifft das Verhältnis von Religion und Staat in seinem Kern. Ein Verhältnis, das wir gesamtgesellschaftlich diskutieren müssen. Es geht letztlich darum, herauszufinden, wie viel Religion wir in der Schweiz im Alltag sichtbar machen wollen.
Ich nehme mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Islam in der Schweiz in seinen unterschiedlichsten Ausrichtungen existieren kann. Gleichzeitig befremdet es mich, wenn eine Nebensache wie die Bedeckung so viel Aufmerksamkeit bekommt und von einer Minderheit exklusiv zur religiösen Norm erhoben wird. Natürlich muss ich mich dieser Norm nicht anpassen, aber ich muss den gesellschaftlichen Diskurs darüber aushalten bzw. mittragen.
Dabei komme ich in die Zwickmühle: Nachdem ich in Ägypten hatte beobachten können, wie Hijab und Niqab der Islamisierung geschuldet sind, tue ich mich schwer damit, dass dies nun auch in der Schweiz ankommt.
Zwischen der Art und Weise, wie Nora Illi ihren Islam lebt, und mir überwiegt das Trennende. Gleichwohl leben wir zusammen, in einem Land, in einer Gesellschaft. Der Niqab wird uns wohl weiter beschäftigen.
Eine in der Schweiz geborene und freiheitlich erzogene Frau vertritt Ideen, die ich selbst in meiner Kindheit und Jugend gar nie als ‹islamisch› kennengelernt habe, wohl wissend, dass sich die islamische Welt gesamthaft unter dem Einfluss von Saudi-Arabien dem Wahhabismus, einem so genannten unverfälschten ‹Ur-Islam›, zugewandt hat. Ich habe Gewissensnotstand, ich gebe es offen zu. Abzulehnen, was angesichts des gar nicht mehrheitsfähigen Themas Niqab unschwer wäre, ist mir zu simpel. Mein Verständnis von Minderheitenrechten, denn niqabtragende Frauen in der Schweiz sind eine Minderheit, drängt mich, die Wahl der anderen, der ‹anderen Muslimin›, anzuerkennen. Ganz einfach: Das gebietet die Toleranz, die gerade ich dem konservativen und ultrakonservativen Flügel meiner Religion abverlange, wenn ich für Erneuerung eintrete. Wie oft war ich schon ‹Nora Illi›! Nicht nur, wenn es um religiöse Inhalte ging, auch in der Politik. «Wie kannst du nur so denken?», «Weisst du nicht, dass das nicht geht?», «Hier bei uns ist das inakzeptabel!» Emotionen kochen hoch. Ein konstruktives Gespräch ist nicht möglich. Wie kann man konstruktiv über den gelebten Islam diskutieren, wenn die Ansichten darüber so verschieden sind?
Bei Voltaire finde ich dazu eine anregende Geschichte: In seinem ‹Traktat über die Toleranz› (‹Traité sur la tolérance›, 1763) lässt dieser einen ranghohen Chinesen, der den Ideendisput zwischen einem Jesuiten, einem Dänen und einem Holländer schlichten soll – die drei stehen für unterschiedliche Auslegungen der christlichen Lehre und wollen jeder auf seine Art das Christentum nach China bringen –, Folgendes sagen: «Wenn Sie wollen, dass man hier [in China] Ihre Lehre [das Christentum] toleriert, seien Sie weder intolerant noch unzumutbar.» Voltaire mahnt dazu, der eigenen Überzeugung und derjenigen des anderen mit Ausgewogenheit zu begegnen. Eine in der Tat weise Ermahnung, die jedoch gerade beim Thema ‹Niqab› nicht so einfach umzusetzen ist.