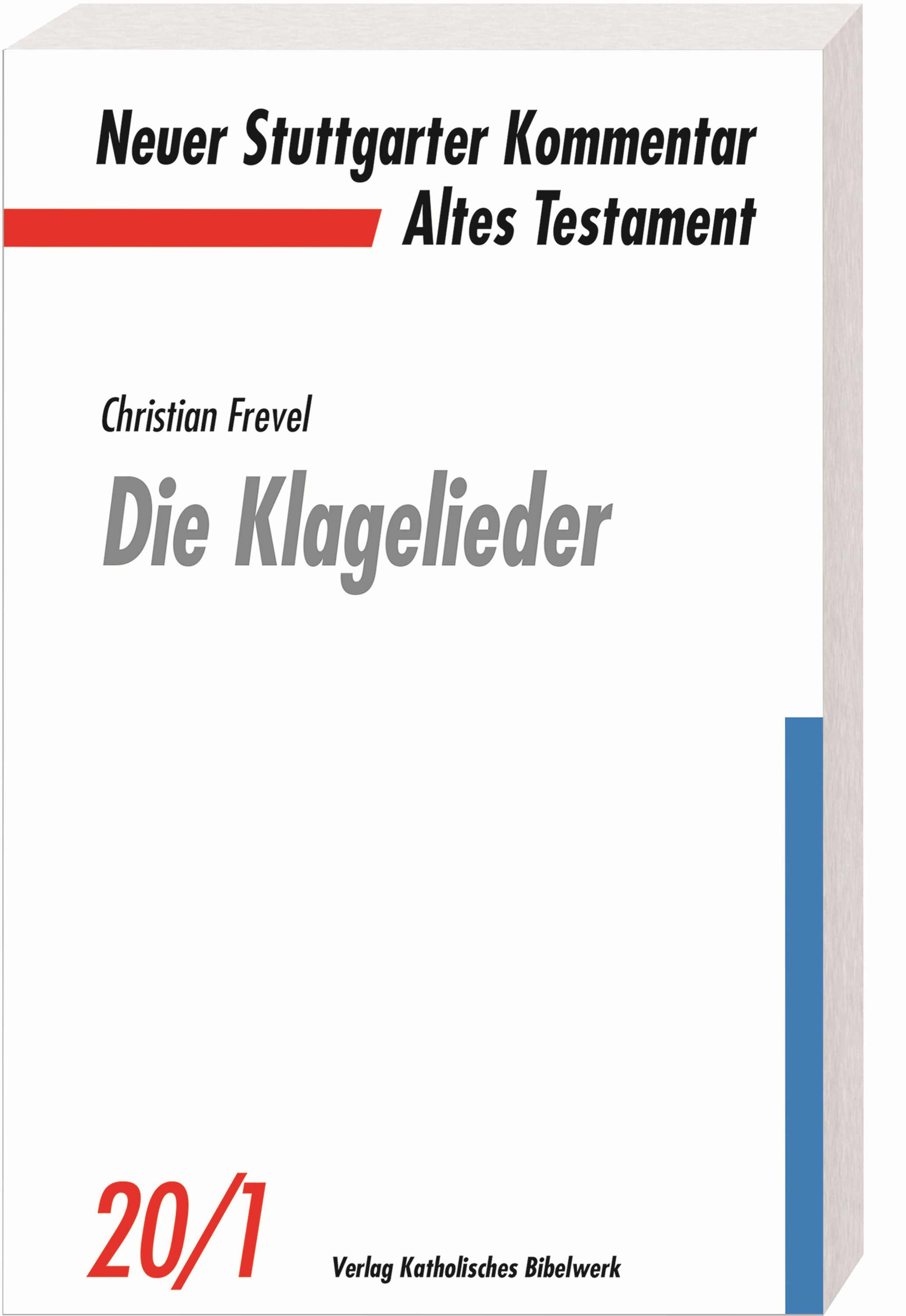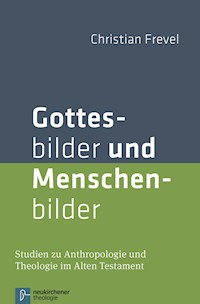Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
This textbook illustrates the "history of Israel" from the beginnings until the Bar-Kochba insurgence 132-135 AD. The knowledge, which is indispensable for exegesis and theology studies, is passed on by the author as a matter of course and in light of current research. He uses all available sources for his illustrations: next to the bible, archaeological findings, inscriptions and artwork have been considered; it is shown by means of example how the sources are to be interpreted and where the boundaries of reconstructing history lie. For this purposes, he introduces the latest findings of archaeological and historic research and links the results to biblical interpretations in a critical manner. This produces an impression of the history of ancient Israel in the context of the Southern Levant, which is often familiar, but also fresh and unexpected.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1091
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kohlhammer Studienbücher Theologie
Herausgegeben von
Christian FrevelGisela MuschiolDorothea SattlerHans-Ulrich Weidemann
Christian Frevel
Geschichte Israels
zweite, erweiterte und überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Prof. Dr. Christian Frevel ist Professor für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und Extraordinary Professor am Department of Old Testament Studies der University of Pretoria, South Africa.
2. Auflage 2018
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-035420-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-035421-0
epub: ISBN 978-3-17-035422-7
mobi: ISBN 978-3-17-035423-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Dieses Studienbuch stellt die 'Geschichte Israels' von den Anfängen bis zum Bar-Kochba-Aufstand 132-135 n. Chr. dar. Das für Exegese und Theologiestudium unverzichtbare Wissen vermittelt der Autor verständlich und vor dem Hintergrund der aktuellen Forschung. Er zieht für seine Darstellung alle verfügbaren Quellen heran. Exemplarisch wird aufgezeigt, wie diese Quellen zu interpretieren sind und wo die Grenzen der Rekonstruktion von Geschichte liegen. Dazu führt er in den Stand der archäologischen und historischen Forschung ein und bezieht die Ergebnisse kritisch auf die biblische Darstellung. So entsteht ein Bild der Geschichte des antiken Israel im Kontext der südlichen Levante, das manches Mal vertraut, oft aber auch frisch und unerwartet daherkommt.
Für die Neuauflage wurden zahlreiche Abschnitte überarbeitet und neueste Literatur ergänzt. Der Charakter als Studienbuch wurde noch einmal methodisch reflektiert und verstärkt.
Prof. Dr. Christian Frevel lehrt Altes Testament an der Ruhr-Universität Bochum.
Inhalt
Vorwort
I. Vorbemerkungen zur Historik
1. Geschichtsschreibung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
2. Geschichte als deutende und sinnstiftende Selektion und Konstruktion
3. Minimalisten, Maximalisten und die Quellen der Geschichte Israels
4. Quellen einer »Geschichte Israels«
5. Wann beginnt eine »Geschichte Israels«?
6. Was bezeichnet Israel in der »Geschichte Israels«?
7. Der Raum der »Geschichte Israels« und die Bezeichnungen des Landes
8. Biblische Zahlen und Chronologien
9. Archäologische Chronologie und die Geschichte Israels
10. »Geschichte Israels« und ihr Verhältnis zu anderen Geschichten
II. Vorgeschichte Israels
1. Zur Historizität der Erzeltern
1.1 Die Vatergotthypothese Albrecht Alts
1.2 Abraham als historische und fiktive Person
1.3 Völkerwanderungen in der Erzelternzeit
2. Die spätbronzezeitliche Stadtstaatenkultur in Palästina
2.1 Entstehung und Entwicklung der Stadtstaaten im 2. Jt. v. Chr.
2.2 Religion und Gesellschaft in den spätbronzezeitlichen Städten
2.3 Ausbildung der ägyptischen Oberherrschaft im Neuen Reich
2.4 Die sog. Seevölker
2.5 »Israel« als Teil der ägyptischen Provinz Kanaan
2.6 Die Amarna-Korrespondenz und die ʿApiru/Ḫapiru
2.7 Beispiele für die regionale Entwicklung der Stadtkultur
2.8 Die -Bauern als Teil der spätbronzezeitlichen Gesellschaft
3. Die älteste Bezeugung des Namens »Israel«
4. Exodus
4.1 Der Exodus in der biblischen Darstellung
4.2 Der Exodus aus historischer Sicht
4.3 Zur Lage des Sinai
4.4 Zur Plausibilität eines historischen Exodusereignisses
4.5 Exodus und Monotheismus
III. Frühgeschichte Israels – Entstehung in Palästina
1. Vorbemerkung
2. Migration als Ursache der Landnahme?
3. Der Untergang der kanaanäischen Stadtkultur
3.1 Ein komplexer Vorgang
3.2 Gründe für den Untergang
4. Die sog. Landnahme
4.1 Die biblische Darstellung der Landnahme
4.2 Landnahmemodelle
4.3 Zusammenfassende Auswertung
5. Die Entstehung der neuen Dorfkultur im Bergland
5.1 Kontinuität und Diskontinuität zur Stadtstaatenkultur
5.2 Die Ethnizitätsdebatte
5.3 Beispiele für die regionale Entwicklung der Dorfkultur
5.4 Israel entsteht in und aus Kanaan – Zusammenfassung
6. Die sog. Landnahme im Ostjordanland
6.1 Zur Situation vor der Landnahme im Ostjordanland
6.2 Von der Spätbronzezeit zur frühen Eisenzeit im Ostjordanland
6.3 Die Siedlungsentwicklung im Ostjordanland
7. Die sog. Richterzeit
7.1 Der Gegensatz Israel ↔ Kanaan
7.2 Sozialstruktur der früheisenzeitlichen Dörfer
7.3 »Israel« und die früheisenzeitliche Dorfkultur
8. Das System der zwölf Stämme Israels
IV. Die Entstehung des Königtums
1. Vorbemerkungen – Herrschaftsformen
1.1 Ri 9 und der Widerstand gegen das Königtum
1.2 Zur Verwendung soziologischer Modelle
1.3 Schriftlichkeit als Kriterium der Staatlichkeit
1.4 Der gleitende Übergang Israels zur Staatlichkeit
1.5 Staatliche Formationsprozesse im 1. Jt. v. Chr.
1.6 Die frühen »chiefdoms« in den Kupferbergbaugebieten
2. Die Nachbarn Israels und ihre Entwicklung im 12.–9. Jh. v. Chr.
2.1. Die phönizischen Stadtstaaten und die Phönizier
2.2 Die Philister in der Küstenebene
2.3 Die Entwicklung Israels und die Aramäer
2.4 Die Ammoniter und das frühe israelitische »Königtum«
2.5 Die Moabiter
2.6 Die Edomiter
3. Zur Situation Palästinas vor der Entstehung des Königtums
4. Saul
4.1 Das Herrschaftsgebiet Sauls
4.2 Organisation der charismatischen Herrschaft Sauls
4.3 Die Erhebung Sauls zum König
4.4 Saul und die Konflikte mit den Philistern
4.5 Versuch der Errichtung einer dynastischen Herrschaft nach dem Tode Sauls
5. Das Königtum Davids
5.1 Großreich, vereinte Monarchie oder »chiefdom«?
5.2 Historizität Davids und die Inschrift von Dan
5.3 Der Beginn der Herrschaft Davids
5.4 Das Königtum Davids nach dem Tode Sauls
5.5 Khirbet Qeiyafa und das Königtum Davids
5.6 Jerusalem als »Stadt Davids«
5.7 Ausdehnung der Herrschaft Davids auf den Norden
6. Das Königtum Salomos
6.1 Salomo als Nachfolger Davids
6.2 Die Liste der Verwaltungsbezirke Salomos
6.3 Salomo als großer Bauherr
6.4 Baumaßnahmen Salomos in Jerusalem
6.5 Zum Ausbau von Hazor, Geser und Megiddo unter Salomo
6.6 Exkurs: Die Chronologiedebatte in der Archäologie und das 10. Jh. v. Chr.
6.7 Erzwungene Arbeitsleistung
6.8 Handelsbeziehungen Salomos
6.9 Zusammenfassung
7. Die sog. Reichsteilung
7.1 Das Königtum Rehabeams von Juda
7.2 Die Erhebung Jerobeams zum König
7.3 Die Residenzen Jerobeams
7.4 Die Errichtung von »Reichsheiligtümern« in Bet-El und Dan
7.5 Eine These zur sog. Reichsteilung
8. Der Feldzug Pharao Schischaks
8.1 Probleme der Datierung des Feldzugs
8.2 Der Anlass des Feldzugs
8.3 Spuren der Zerstörung im 10. Jh. v. Chr.
8.4 Ein Stelenfragment aus Megiddo
8.5 Ägyptische Dominanz in Palästina im 10./9. Jh. v. Chr.
V. Geschichte Israels und Judas
1. Überblick über die Geschichte des neuassyrischen Großreiches
2. Quellenlage und regionale Entwicklung
2.1 Der Rückgriff auf Listenmaterial in der biblischen Darstellung
2.2 Zur Datierung der Könige von Israel und Juda
2.3 Zuverlässigkeit der biblischen Angaben
2.4 Die Könige Israels und Judas in außerbiblischen Quellen
2.5 Die Entwicklung Judas im Vergleich mit Israel
3. Die Aramäer und ihr Einfluss auf die Entwicklung Israels und Judas
3.1 Lokale aramäische Häuptlingstümer
3.2 Geschur
3.3 Aspekte der materiellen Kultur der Aramäer
3.4 Aram-Damaskus als Hegemonialmacht
4. Israel und Juda unter den Omriden
4.1 Das Königtum in Israel von Jerobeam bis Omri
4.2 Auseinandersetzungen mit Juda
4.3 Konsolidierung der Herrschaft
4.4 Außen- und Innenpolitik der Omriden
4.5 Baumaßnahmen der Omriden
4.6 Die antiassyrische Koalition unter Ahab
4.7 Die Abhängigkeit Judas von Israel
4.8 West- und Südexpansion Judas im 9. Jh. v. Chr.
4.9 Handelsaktivitäten Israels im Süden
5. Der Putsch Jehus und die Herrschaft der Nimschiden
5.1 Auseinandersetzungen Israels mit den Aramäern
5.2 Jehu und die Inschrift von Dan
5.3 Der Sturz Ataljas
5.4 Die aramäische Expansion unter Hasaël
5.5 Joasch und die aramäische Dominanz im 8. Jh. v. Chr.
5.6 Amazja und die erneute Abhängigkeit von Samaria
5.7 Jotam und die letzten Nimschiden in Jerusalem
5.8 Die lange Regierungszeit Asarjas/Usijas
5.9 Die Blütezeit Israels unter Jerobeam II.
6. Juda unter assyrischem Einfluss und der Untergang Israels 720 v. Chr.
6.1 Die Entwicklung Judas im 8. Jh. v. Chr.
6.2 Die assyrische Expansionspolitik und ihre Folgen
6.3 Ahas als neuassyrischer Vasall
6.4 Der Versuch einer Wiederauflage der antiassyrischen Koalition
6.5 Der Bau eines neuen Altars in Jerusalem und die Frage der Assyrisierung des Kultes
6.6 Strafexpedition Tiglat-Pilesers III.
6.7 Der Abfall Hoscheas und die Belagerung Samarias
6.8 Eingliederung in das neuassyrische Provinzsystem
6.9 Deportation eines Teils der Bevölkerung im Norden
7. Juda nach dem Untergang Israels unter Hiskija
7.1 Entwicklung Jerusalems im 8. Jh. v. Chr.
7.2 Ausbau der Verwaltung in Juda
7.3 Kultzentralisation und eine Kultreform Hiskijas?
7.4 Außenpolitik Hiskijas am Ende des 8. Jh.s v. Chr.
7.5 Der Feldzug Sanheribs und die Eroberung von Lachisch 701 v. Chr.
7.6 Der Abzug Sanheribs von Jerusalem 701 v. Chr.
7.7 Die Unterwerfung Judas durch Sanherib
8. Juda im 7. Jh. v. Chr. unter Manasse
8.1 Die Außenpolitik Manasses
8.2 Die Diskrepanz zwischen dem biblischen und dem historischen Manassebild
8.3 Manasse als treuer Vasall Assurs
8.4 Der wirtschaftliche Ausbau des Reiches unter Manasse
8.5 Assyrischer Kulturdruck und religiöse Entwicklung
9. Juda im Kräftespiel zwischen Assur, Babylon und Ägypten – Joschija
9.1 Innenpolitische Widerstände gegen Assur
9.2 Der Niedergang des assyrischen Großreiches
9.3 Juda unter ägyptischer Kontrolle
9.4 Keine signifikante Ausdehnung der Reichsgrenzen unter Joschija
9.5 Die Kultreform Joschijas
9.6 Der Tod Joschijas und die Absetzung Joahas’
10. Das Ende des Staates Juda
10.1 Jojakim als neubabylonischer Vasall und der Abfall von Babylon 601 v. Chr.
10.2 Die erste Eroberung Jerusalems 597/96 v. Chr.
10.3 Deportation der judäischen Bevölkerung
10.4 Zidkija und die trügerische Hoffnung auf Ägypten
10.5 Die zweite Eroberung Jerusalems 588/87 v. Chr.
11. Die Provinz Judäa nach dem Untergang des Staates
11.1 Kontinuität und Diskontinuität nach 587/86 v. Chr.
11.2 Gedalja als babylonischer Verwaltungsbeamter
11.3 Eine dritte Deportation nach der Ermordung Gedaljas?
12. Die babylonische und ägyptische Diaspora
12.1 Die babylonische Diaspora
12.2 Judäer in Ägypten und die Militärkolonie auf der Nilinsel Elephantine
VI. Geschichte Israels in der Perserzeit
1. Überblick über die Geschichte des persischen Großreiches
1.1 Kyrus der Große und der Untergang des babylonischen Reiches
1.2 Kambyses II. – Aufstände in Persepolis
1.3 Die Instabilität des Reiches nach dem Abfall Ägyptens
2. Wirtschaft und Verwaltung des Perserreiches
2.1 Persische Toleranzpolitik und ihre Grenzen
2.2 Das Verwaltungssystem des persischen Reiches
2.3 Steuern und Abgaben
3. Die Provinz Jehud und ihr politischer Status
3.1 Grenzen der Provinz Jehud
3.2 Wirtschaftlicher Aufschwung im 5. Jh. v. Chr.
3.3 Politischer Status der Provinz Jehud
4. Das Kyrus-Edikt und die Rückkehr aus dem Exil
4.1 Zur Überlieferung des Kyrus-Ediktes
4.2 Zur Authentizität des Kyrus-Ediktes
4.3 Plausibilität der Rückführung der Tempelgeräte
4.4 Die Rückkehr der Exulanten und die demographische Entwicklung in Jehud
5. Restauration Jerusalems und der Bau des Zweiten Tempels
5.1 Jerusalems Zustand in der Mitte des 6. Jh.s v. Chr.
5.2 Baubeginn des Zweiten Tempels unter Scheschbazzar
5.3 Serubbabel und der Wiederaufbau des Tempels
5.4 Widerstand gegen den Tempelbau
5.5 Zweifel an der Datierung des Tempelbaus
5.6 Einweihung des Zweiten Tempels 515 v. Chr.?
6. Die Reorganisation der Gemeinde unter Nehemia
6.1 Der Bericht Nehemias
6.2 Nehemia als Statthalter und die Datierung seines Wirkens
6.3 Die Restauration des Mauersystems Jerusalems
6.4 Weitere Maßnahmen Nehemias
7. Die Mission Esras
7.1 Die biblische Darstellung
7.2 Probleme des zeitgleichen Wirkens Esras und Nehemias
7.3 Datierung der Mission Esras
7.4 Zur Frage der Historizität der Maßnahmen Esras
8. Samaria, die Samarier und die Samaritaner
8.1 Entwicklung der persischen Provinz Samaria
8.2 Das sog. samaritanische Schisma
8.3 Das Heiligtum auf dem Garizim
9. Heiligtümer in der Perserzeit und die pluriforme Gestalt der YHWH-Verehrung
10. Die Perserzeit als formative Periode des späteren Judentums – Zusammenfassung
VII. Geschichte Israels in hellenistischer Zeit
1. Überblick über die Geschichte der hellenistischen Epoche
1.1 Das Ende des Perserreiches und der Aufstieg Alexanders
1.2 Der Tod Alexanders und die Kämpfe der Diadochen
1.3 Machtkämpfe zwischen Ptolemäern und Seleukiden
1.4 Entwicklungen im 2. Jh. v. Chr.
2. Hellenismus
2.1 Der Begriff Hellenismus
2.2 Hellenisierung
3. Wirtschaft und Verwaltung der hellenistischen Reiche
3.1 Die Hyparchien und der Provinzstatus Judäas
3.2 Wirtschaft und Steuersystem in der Provinz Judäa
3.3 Organisation der Diasporajuden in Ägypten
4. Tobiaden, Oniaden und die Hintergründe des Makkabäeraufstandes
4.1 Die Familie der Tobiaden und ihre Vorgeschichte
4.2 Die Entwicklungen unter Onias II. und die Flucht Hyrkans in das Ostjordanland
4.3 Das Amt des Hohepriesters
4.4 Konflikte zwischen proseleukidischen und proptolemäischen Parteigängern
4.5 Die Heliodor-Affäre
4.6 Die Absetzung des Onias III.
4.7 Der Tempel in Ägypten (Leontopolis/Heliopolis)
4.8 Die Hellenisierung Jerusalems unter Jason
4.9 Die Absetzung Jasons als Hohepriester
5. Die Krise unter Antiochus IV. und der Makkabäeraufstand
5.1 Die Ägyptenpolitik von Antiochus IV.
5.2 Jason ergreift erneut die Macht in Jerusalem
5.3 Einordnung und Bewertung der Maßnahmen von Antiochus IV.
5.4 Der Makkabäeraufstand
6. Die Hasmonäer
6.1 Eine Parallelregierung in Michmas
6.2 Jonatan als Hohepriester in Jerusalem
6.3 Der Anschluss an die Seleukiden und der Machtzuwachs unter Jonatan
6.4 Juda als teilautonomer Staat unter Simeon
6.5 Johannes Hyrkan I.
6.6 Aristobul I. und Alexander Jannai
6.7 Salome Alexandra
6.8 Das Eingreifen der Römer und das Ende des hasmonäischen Staates
6.9 Religiöse Gruppierungen in der Hasmonäerzeit
VIII. Geschichte Israels in römischer Zeit – Ein Ausblick
1. Neuordnung Palästinas unter römischer Herrschaft
2. Die Aufstände Alexanders und Antigonus’
3. Judäa nach dem Sieg Cäsars
4. Herodes der Große
4.1 Das Zerrbild des Despoten Herodes
4.2 Die Baupolitik des Herodes
4.3 Der herodianische Tempel in Jerusalem
4.4 Konflikte um das politische Erbe des Herodes
5. Die Nachfolger des Herodes
5.1 Archelaus und die Neuorganisation in Judäa
5.2 Konflikte um den Kaiserkult unter Herodes Agrippa I.
6. Der Jüdische Krieg 66–70 n. Chr.
6.1 Hintergründe und Beginn der judäischen Erhebung
6.2 Der militärische Widerstand der Zeloten
6.3 Das Eingreifen Roms und die Zerstörung des Tempels
6.4 Masada
6.5 Die Neuformierung des Judentums nach der Zerstörung des Tempels
7. Der Bar-Kochba-Aufstand 132–135 n. Chr.
IX. Nachwort
X. Anhänge
1. Chronologische Übersichten
1.1 Übersicht über die archäologischen Epochen
1.2 Übersicht über die Dynastien in Ägypten
1.3 Übersicht über ausgewählte Herrscherchronologien altorientalischer Reiche
1.4 Synchronistische Übersicht über die Könige Israels und Judas
2. Glossar ausgewählter Fachtermini
3. Abkürzungsverzeichnis
4. Hinweise zum Gebrauch und zu den verwendeten Textausgaben
5. Allgemeine und übergreifende Literatur
6. Karten zur Orientierung
7. Ortsnamen mit Koordinaten
8. Quellennachweis der Karten und Abbildungen
9. Register
Vorwort
Die hier vorgelegte Geschichte Israels ist aus dem »Grundriss der Geschichte Israels« entstanden, der erstmalig in der siebten Auflage der Einleitung in das Alte Testament (2007) erschienen ist. Als Erich Zenger mich seinerzeit fragte, ob ich einen knappen Überblick über die Geschichte auf etwa 30 Seiten erstellen könnte, habe ich voller Zuversicht zugesagt. Bei der Erarbeitung stellte sich dann schnell heraus, dass eine so knappe Darstellung kaum ohne Referenz auf eine ausführlichere Darstellung sinnvoll war. Zu viel war und ist in der Disziplin »Geschichte Israels« im Umbruch. Der erschienene Grundriss war dicht und vom Umfang der »Einleitung« nicht mehr angemessen. Daher hat mich nicht zuletzt der Verlag ermuntert, den »Grundriss« aus der Einleitung auszugliedern und ihn als Studienbuch auszuarbeiten. Ich habe mich nach einigem Zögern auf dieses Projekt eingelassen, weil die Disziplin »Geschichte Israels« gegenwärtig in eine neue Phase eintritt bzw. eingetreten ist. Während über Jahre eine große Zurückhaltung in der Einleitungswissenschaft gegenüber der Rekonstruktion der Geschichte Israels herrschte, ist inzwischen die Zuversicht wieder größer und auch im deutschsprachigen Raum erscheinen Gesamtdarstellungen der Geschichte Israels. Die Fülle an Einzeluntersuchungen ist groß und erfordert eine Zusammenschau. Dieser Aufgabe habe ich mich versucht zu stellen. Die hier vorgelegte Darstellung verlangt den Lesenden einiges ab. Vieles Eingeübte wird hinterfragt, vielfältig destruiert und wieder neu zusammengesetzt. Die Infragestellung des biblischen Befundes und die Spiegelung der akademischen Diskussion werden häufig der einfachen und eindeutigen Position vorgeordnet. Das fordert zur Auseinandersetzung und vielleicht auch manchmal zum Widerspruch heraus.
Die Darstellung hat Vielen Vieles zu verdanken. Eine Reihe von Autorinnen und Autoren haben mir unveröffentlichte Manuskripte zur Verfügung gestellt, Auskünfte zu laufenden Ausgrabungen bzw. ihrem Spezialgebiet gegeben oder Einzelfragen mit mir diskutiert: D. T. Ariel, A. Berlejung, J. Blenkinsopp, E. Gass, H. Gitler, U. Hübner, J. Hutton, I. Finkelstein, L.-M. Günther, F. Lippke, J. Kamlah, O. Keel, S. Kisilewitz, K. Koenen, E. A. Knauf, G. N. Knoppers, R. G. Kratz, G. Lehmann, O. Lipschits, A. Mazar, B. Morstadt, H. Niehr, M. Oeming, O. Sergi, T. Pola, H.-J. Stipp, W. Zwickel. Sehr viel Interdisziplinäres durfte ich in den vergangenen Jahren von Fellows und Kollegiaten im Bochumer Käte Hamburger Kolleg lernen. Teile der Darstellung wurden in einem Forschungsaufenthalt an der Universität in Pretoria geschrieben, wo ich eine wohltuende akademische Gastfreundschaft erleben durfte.
Besonders erwähnt seien aus dem Team in Bochum Katharina Pyschny und Katharina Werbeck sowie aus dem Verlag Kohlhammer Florian Specker. Ohne die Unterstützung meiner Frau Sabine wäre die Fertigstellung des Manuskriptes nicht möglich gewesen. Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Ergänzung des Vorworts zur zweiten Auflage
Wenn ein Buch schneller ausverkauft als es durch die Mühlen der akademischen Rezeption gelangt ist, freut das den Autor natürlich ungemein. Dass dann eine zweite Auflage die Möglichkeit gibt, die Darstellung an einigen Passagen gründlich zu überarbeiten und an vielen Stellen zu ergänzen, die Literatur durchgehend auf den aktuellen Stand zu bringen und schließlich auch kleinere Versehen zu beseitigen, erleichert hoffentlich die weitere Rezeption des Buches eher, als dass es sie durch die veränderten Seitenzahlen und die veränderte Anordnung der Kapitel erschwert. Erneut habe ich Vielen zu danken, die mich in der Bearbeitung tatkräftig unterstützt haben. Johannes Bremer, Jonathan Steilmann, Sarah-Christin Uhlmann und Katharina Puwalski ergänzen die bereits Genannten.
I. Vorbemerkungen zur Historik
1. Geschichtsschreibung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
G. Essen, Kann Gestern besser werden?, in: F. Bruckmann/R. Dausner (Hg.), Im Angesicht der Anderen (Studien zu Judentum und Christentum 25), Paderborn 2013, 495–516 • G. Essen/C. Frevel (Hg.), Theologie der Geschichte – Geschichte der Theologie (QD 294), Freiburg 2018 • C. Frevel, Bibel und Geschichte, in: W. Dietrich (Hg.), Die Welt der Hebräischen Bibel, Stuttgart 2017, 43–56 • E. A. Knauf, From History to Interpretation, in: D. V. Edelman (Hg.), The Fabric of History (JSOT.S 127), Sheffield 1991, 26–64 • J. Rüsen, Zerbrechende Zeit, Böhlau 2001 • ders., Kultur macht Sinn, Köln 2006 • ders., Zeit und Sinn, Frankfurt a. M. 2012 • ders., Historik, Köln 2013 • K. L. Sparks, The Problem of Myth in Ancient Historiography, in: S. L. McKenzie (Hg.), Rethinking the Foundations (BZAW 294), Berlin/New York 2000, 269–280.
»Die Geschichte ist … ein Wissen von dem Geschehen« schreibt der Nestor der modernen Geschichtswissenschaft Johann Gustav Droysen (1808–1884). Der Schlüssel zum Verstehen dieses Sätzchens liegt weder in dem Begriff der »Geschichte« noch in dem des »Geschehens«, sondern in dem des »Wissens«. Wissen ist zielgerichtete Information, die der Sinnstiftung in der Gegenwart dient, um Zukunft zu verändern. Geschichte und Vergangenheit sind nicht dasselbe, sondern Geschichte ist auf Vergangenheit bezogen. Droysen wollte darüber hinaus darauf aufmerksam machen, dass es in der Geschichte nicht um die Vergangenheit als Vergangenheit geht, sondern um das in den Vergangenheiten »Jetzt und Hier noch Unvergangene«. Geschichte, auch die »Geschichte Israels«, die im Kontext des theologischen, judaistischen, religionswissenschaftlichen oder geschichtlichen Studiums eine Rolle spielt, hat eine Vergangenheit zum Gegenstand, ohne in dieser Vergangenheit aufzugehen. Sie bedient sich Formen des historischen Erzählens, um darin Zeit zu gestalten. Das tut sie nicht um der vergangenen Vergangenheiten, sondern um der Zukunft willen. Denn Geschichte macht Sinn!
Sie versucht, eine Kohärenz zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herzustellen und in den Verknüpfungsvorgängen Orientierung zu bieten. Geschichte, mag sie auch noch so objektiv daherkommen, zielt auf einen subjektiven Sinn, der im Wandel der Zeit Identität konstituiert. Historiographie folgt darin immer einem Interesse. Würden denjenigen, der das Gewesene erzählt, diese Vergangenheiten nicht betreffen, würde er sie nicht erzählen. Das Subjekt verortet sich durch die Geschichten in der Geschichte, im Kontinuum der Zeit. Mit den Bemerkungen ist nicht abzuweisen, dass Geschichte niemals objektiv ist, sondern einen normativen Anspruch mitträgt. »Erfahrungen der Vergangenheit sind ohne normative Absichten auf Zukunft historisch blind; normative Absichten auf Zukunft sind ohne Erfahrungen der Vergangenheit historisch leer« (Jörn Rüsen).
Will Geschichtsschreibung Orientierung bieten, erfordert sie daher immer einen Standpunkt; sowohl desjenigen, der die Geschichte schreibt, als auch desjenigen, der sie rezipiert. Nicht alle Entscheidungen jedoch wird und will derjenige, der die Geschichtsschreibung vorlegt, seinen Leserinnen und Lesern abnehmen. Das hat schon der von Cicero als »Vater der Geschichtsschreibung« (De Legibus 1,5) bezeichnete antike Schriftsteller Herodot (ca. 485–424 v. Chr.) betont, wenn er am Anfang seines Hauptwerkes der Historien schreibt: »Ich will nicht entscheiden, ob es so oder anders gewesen ist« (Hdt. Hist. I,5). Das bedeutet nicht, dass es eine von Deutung freie »objektive« Darstellung gibt, sondern, dass die Leserinnen und Leser aufgerufen sind, sich als aktiver Teil des Deutungsgeschehens zu begreifen. Auch eine Geschichte Israels – und mag es noch so implizit und beiläufig sein – liest man nicht ohne normativen Anspruch und ohne Bezug zur Konstruktion einer kollektiven Identität.
2. Geschichte als deutende und sinnstiftende Selektion und Konstruktion
K. Bieberstein, Jerusalems Geschichte(n) zu schreiben, in: M. Konkel/O. Schuehgraf (Hg.), Provokation Jerusalem (JThF 1), Münster 2000, 16–69 • G. Essen, Historische Sinnbildung, in: K. Appel/E. Dirscherl (Hg.), Das Testament der Zeit (QD 278), Freiburg 2016, 59–76 • C. Frevel, Bibel und Geschichte, in: W. Dietrich (Hg.), Die Welt der Hebräischen Bibel, Stuttgart 2017, 43–56 • F. Hartenstein (Hg.), Geschichte Israels und biblische Geschichtskonzepte: VuF 53, 2008, 1–85 • O. Kaiser, Glaube und Geschichte im Alten Testament (BThS 150), Neukirchen-Vluyn 2014 • J. Rüsen, Zerbrechende Zeit, Böhlau 2001 • ders., Historik, Köln 2013.
Geschichte richtet sich auf das Geschehene, um ein Wissen darüber für die Gegenwart zu bewahren, »auf dass das von Menschen Geschehene nicht mit der Zeit verblasse«, wie wiederum Herodot formuliert. Gleich zu Beginn unterscheidet der »pater historiae« zwischen den überkommenen Mythen und der geschichtlichen Zeit, über die allein er erzählen will. Er behält sich dabei über das ganze Werk hindurch vor, nicht alles zu glauben, was ihm selbst berichtet wurde. Das erzeugt nicht nur starke Tendenzen in der Darstellung, sondern sogar Widersprüche. So ist es letztlich bezeichnend, dass über die Glaubwürdigkeit der Darstellung Herodots bereits in der Antike lebhaft diskutiert und sie etwa von dem Schriftsteller Manetho von Ägypten heftig kritisiert wird. Flavius Josephus fasst im 1. Jh. n. Chr. sogar zusammen, dass sich alle griechischen Autoren über die Wahrheitswidrigkeit der Darstellungen Herodots im Klaren seien (Jos. cont. Ap. I,73). Damit ist jedoch – das zeigt die unverzichtbare Bedeutung der Erzählungen Herodots – über die historische Bedeutung noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie die moderne Rezeption, die sich dem antiken Schriftsteller Herodot nach einer Phase völliger Ablehnung wieder vermehrt zuwendet, zeigt. Es ist gerade die Unschärfe der Unterscheidung zwischen Mythos und Geschichte bei Herodot, die die Frage nach dem Verhältnis von Vergangenheit und Erzählung aufwirft.
Das zuletzt Gesagte weist nicht nur darauf hin, dass die Quellenauswahl für die Geschichte Israels zentral ist, sondern auch, dass es keine Identität von Geschehen und Geschichte gibt und geben kann. Wo aber verläuft die Grenze zwischen Konstruktion (die auf Geschehenes deutend Bezug nimmt) und Fiktion (die ihren Ausgang nicht mehr an einem Geschehenen nimmt)? Die Erzählung von der Entstehung der Welt in Gen 1–3 hat ebensowenig eine »Historie« als Bezugspunkt wie die Fluterzählung in Gen 6–9 und wahrscheinlich auch die Abrahamerzählung in Gen 12–25. Wo die Grenze verläuft, ob bei den Erzeltern (Gen 12–36), in der Josefsnovelle (Gen 37–50), der Exoduserzählung (Ex 1–15), der Wüstenerzählung (Ex 16–Dtn 34), in der Landnahmeerzählung (Jos 1–24) oder erst später, wird unterschiedlich bewertet. In der Forschung wird daher viel darüber diskutiert, wann eine Geschichte Israels einzusetzen hat und ob man eine solche überhaupt schreiben kann (L. L. Grabbe). Geschichtsschreibung kann nicht zeigen, »wie es eigentlich gewesen« (so Leopold von Ranke 1795–1886), sondern »die Vergangenheiten sind vergangen« (so Johann Gustav Droysen 1808–1884) und damit heute unerreichbar. Es gibt keine objektive Geschichte, die im Bergwerk der Vergangenheiten ansteht und an die Oberfläche der Zeit geholt werden könnte (↗ IX.), sondern der Einheit der Vergangenheit steht die Pluralität möglicher Geschichten gegenüber. Geschichtsschreibung ist immer Konstruktion und eine Form der Sinnkonstitution, die aus der produktiven Erinnerung (explizit retrospektive, d. h. zurück gewandte Perspektive) für die Gegenwart und Zukunft zu verstehen und zu lernen sucht (implizit prospektive, d. h. nach vorne gewandte Perspektive). Geschichte ist keine bloße Repräsentanz der Vergangenheit, sondern eine Form des Verstehens und der Deutung.
Die einfache Unterscheidung zwischen Geschichte und Geschichten, zwischen story und history oder zwischen fact und fiction ist hilfreich, weil sie klar machen kann, dass das Erzählte nicht das Gewesene ist und es nicht nur durch die Vergangenheit von diesem getrennt ist. Doch die Unterscheidung greift zugleich zu kurz, weil das Erzählte nicht unabhängig vom Gewesenen ist und sich beides gar nicht randscharf voneinander trennen lässt.
Geschichte stiftet Orientierung und das geschichtliche Erinnern konstituiert einen Sinn, der eine kollektive Identität bildet und sich zugleich zu ihr in ein Verhältnis setzt. Geschichtsschreibung ist ein subjektives Deutungsgeschehen und Teil einer kollektiven Identitätskonstruktion. Die Menge der dafür zur Verfügung stehenden Daten variiert, aber Geschichte kann grundsätzlich nur durch die Selektion, Abstraktion, Reduktion und Kombination von Daten kohärent konstruiert werden. Dabei muss man sich bewusst machen, dass zum einen die verfügbaren Daten nicht vollständig sind, sondern eine Selektion darstellen, und zum anderen ihre Verwendung in einer »Geschichte Israels« eine Selektion aus der Fülle der verfügbaren Daten bedeutet. Geschichtsschreibung unterliegt damit einer doppelten Selektion, von der nur die zweite steuerbar ist. Auch nach der Auswahl sind jedoch die Daten ohne Beziehung zueinander. Die selektierten Daten müssen miteinander zu einer »Geschichte« verknüpft werden, was hier mit dem Begriff »Konstruktion« beschrieben wird. Das bedeutet, dass im retrospektiven Entwurf der Geschichte die Informationen bewertet und gewichtet werden müssen. Sie müssen ausgewählt und aufeinander bezogen werden, wobei das Ergebnis immer im Vergleich zur Vergangenheit lückenhaft bleibt. Es gibt keine unveränderliche geschichtliche Wahrheit, und der Maßstab ist nicht, »wie es eigentlich gewesen«. Erst die Interpretation macht das Geschehen der Vergangenheit erzählbar. Dabei ist der »Sinn« nicht etwas, das der Geschichte innewohnen würde, sondern »Sinn« wird der Geschichte von der Gegenwart her zugeschrieben und in die Vergangenheit eingeschrieben. Dieser Deutungsprozess wird jedoch selten explizit, sondern läuft quasi in jeder Konstruktion von Geschichte im Hintergrund.
Die Bibel als »Geschichtsbuch« ist Teil dieses Deutungsprozesses, jedoch heißt das nicht, dass die Bibel einfach als Geschichtsdarstellung aufgefasst werden kann. Das wäre eine fundamentalistische Position, wohingegen in der Bibelwissenschaft die biblische Geschichtsdarstellung als Traditionsliteratur begriffen wird, deren historischer Wert einer kritischen Überprüfung bedarf. Genauso wenig, wie die Bibelwissenschaft die biblische Darstellung mit einer geschichtlichen Darstellung identifiziert, so wenig geht sie davon aus, dass die biblischen Geschichten darin aufgehen, Erzähltes zu sein. Sie haben zumindest dahingehend einen Bezug zur Geschichte, dass sie darin entstanden sind. Über weite Strecken – etwa in den sog. Geschichtsbüchern (1 Sam, 2 Sam, 1 Kön, 2 Kön, 1 Chr, 2 Chr, Esra, Neh, 1 Makk, 2 Makk) – lassen sie auch den Anspruch erkennen, historisch plausibel sein zu wollen. Damit bieten sie noch keine verlässliche Historiographie, sind aber als Quelle auch nicht aus der Rekonstruktion einer Geschichte Israels von vornherein auszuschließen.
3. Minimalisten, Maximalisten und die Quellen der Geschichte Israels
B. Becking/L. L. Grabbe (Hg.), Between Evidence and Ideology (OTS 59), Leiden 2011 • P. R. Davies/D. V. Edelman (Hg.), The Historian and the Bible (LHBOTS 530), London 2010 • W. Dietrich, Historiography in the Old Testament, in: M. Sæbø (Hg.), Hebrew Bible, Old Testament. Vol. 3,2, Göttingen 2015, 467–499 • L. L. Grabbe (Hg.), Can a »History of Israel« Be Written? (JSOT.S 245), Sheffield 1997 • I. Hjelm, Maximalist and/or minimalist approaches in recent representations of ancient Israelite and Judean history, in: J. West/J. Crossley (Hg.), History, Politics and the Bible from the Iron Age to the Media Age, London 2017, 1–18 • O. Kaiser, Glaube und Geschichte im Alten Testament (BThS 150), Neukirchen-Vluyn 2014 • J. Lendering, Maximalist and Minimalist, http://www.livius.org/theory/maximalists-and-minimalists/ [Zugriffsdatum 23.7.2018] • A. Mazar, Archaeology and the Bible, in: VT.S 163, Leiden 2014, 347–369 • M. B. Moore, Philosophy and Practice in Writing a History of Ancient Israel (LHBOTS 435), New York/London 2006 • M. B. Moore/B. E. Kelle, Biblical History and Israel’s Past, Winona Lake 2011.
Welcher Wert der Bibel als Quelle zukommt, darüber gehen die Meinungen weit auseinander, wofür sich seit einer Kontroverse der 90er Jahre die methodische Unterscheidung von Minimalisten und Maximalisten durchgesetzt hat. Während die sog. Minimalisten biblische Texte nur dann in die Geschichtsrekonstruktion einbeziehen, wenn sie mit außerbiblischen (archäologischen, → epigraphischen, → ikonographischen) Befunden in Deckung gebracht werden können, nehmen Maximalisten die Bibel so lange als historische Quelle, wie sie nicht durch außerbiblische Befunde widerlegt werden kann oder an sich nicht plausibel ist (E. A. Knauf, K. Sparks, L. L. Grabbe, K. B. Moore). Derartige Kategorien verzerren durch die scharfe Trennung, sind aber heuristisch hilfreich zur Unterscheidung eines prinzipiellen Umgangs mit den Quellen. Einig sind sich alle darin, dass eine Geschichte des antiken Israels nicht im Nacherzählen der biblischen Geschichten aufgehen darf. Denn dann würden »Heilsgeschichte« (auf das Handeln Gottes hin gedeutete Geschichte) und »Geschichte« (als kritisch reflektierte Rekonstruktion der Geschichte) unzulässig miteinander vermengt. Die biblische Darstellung ist allerdings weniger am historisch Gewesenen als an dessen Deutung interessiert. Daher wird die Bibel im Zusammenhang der Geschichte Israels oft als Tendenzliteratur bezeichnet. Der literaturwissenschaftliche Begriff wird unterschiedlich verwendet und hat meist einen stark pejorativen, abwertenden Klang. Dabei bezeichnet er ebenso Literatur, die für religiöse, politische, ideologische und propagandistische Zwecke missbraucht wird, als auch solche Literatur, die zur kollektiven Identitätssicherung gebraucht wird und dabei zu Lasten der Objektivität zur Parteilichkeit und eindeutigen Positionierung neigt.
Richtig ist, dass die Bibel im letztgenannten Sinn theologische Tendenzliteratur ist, aber deswegen muss sie noch nicht in jedem Fall eine späte unhistorische Fiktion sein. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen dafür, dass die Angaben der Bibel in Einzelfällen einen hohen Grad an Plausibilität haben. So etwa die Notiz über den Angriff des Aramäers Hasaël (ca. 845–800 v. Chr.) auf die Philisterstadt Gat (2 Kön 12,18), die Information, dass Darius I. (522–486 v. Chr.) auf ein Archiv in Ekbatana zugreift (Esra 6,1), oder die bedeutende Rolle von Hazor in der Spätbronzezeit (Jos 11,1). Aber schon diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Kontexte sind, in denen die verwertbaren Informationen stehen: Während die militärische Landnahme des Josuabuches ahistorisch ist, sind es beim Wiederaufbau des Tempels in Esra »nur« die als Original zitierten Dokumente. Beim Tribut Joaschs in 2 Kön 12,19 steht lediglich die literarische Ausschmückung infrage. Jede einzelne Stelle bedarf einer Prüfung, welche Rolle sie in einer historischen Argumentation spielen kann. Eine generelle Verwerfung der Bibel als Quelle für die Geschichte Israels wäre töricht. Eine völlige Ablehnung würde zudem verkennen, dass die Historiographie der Bibel in Vielem durchaus vergleichbar zur antiken Geschichtsschreibung ist. Das bedeutet auch, dass die Bibel nur vor dem Hintergrund einer modernen Geschichtsforschung, aber auch einer Literaturgeschichte des Alten Testaments zu verwerten ist, die die jeweiligen »Geschichtswerke« analysiert und zeitlich einordnet. Der Abstand zwischen der Zeit, von der erzählt wird, und der Zeit, in der erzählt wird (der Zeit des Erzählers), ist dabei ebenso wichtig wie die Kontextualisierung der Texte in ihren antiken Zusammenhängen.
Es ist richtig, dass das in der Bibel gezeichnete Israel und das historische Israel oft weit auseinandertreten und man sich vergegenwärtigen muss, dass das biblische Israel zu keinem Zeitpunkt eine real in der Geschichte existierende Größe war (P. R. Davies), jedoch darf ebensowenig verkannt werden, dass beide Größen aufeinander bezogen sind. Als antiker Text ist das »biblische« Israel zudem Teil des »historischen« Israel, was aufgrund der langen Entstehungs-, Traditions- und Rezeptionsgeschichte der Texte zu vielfältigen Differenzierungen herausfordert.
Bei aller gebotenen Zurückhaltung gegenüber dem Historizitätsgehalt des biblisch Erzählten ist genauso festzuhalten, dass auch nichtbiblische Quellen vom Historizitätsgehalt nicht zwingend besser oder schon gar nicht objektiver dastehen. Es gibt keine objektiven Daten oder Quellen. Auch archäologische Befunde, außerbiblische Inschriften, Texte und Bilder bedürfen der methodisch geleiteten Interpretation. Die Annahme, es gäbe bruta facta, in denen das Gewesene unmittelbar greifbar wäre, ist eine Fiktion. Die Differenz der Fakten zwischen »Wirklichkeit« und »Geschichte« ist die deutende Perspektive, was noch einmal auf die Grundeinsicht führt: Geschichte ist Konstruktion (↗ I.2). Dass das keine neue Einsicht ist, zeigt das viel zitierte Wort von Julius Wellhausen (das allerdings im Kontext literargeschichtlicher Rekonstruktionen geprägt wurde): »Konstruiren muß man bekanntlich die Geschichte immer … Der Unterschied ist nur, ob man gut oder schlecht konstruirt« (Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 31886, 383).
4. Quellen einer »Geschichte Israels«
C. Frevel, »Dies ist der Ort, von dem geschrieben steht ...«: BN 47, 1989, 35–90 • C. Hardmeier (Hg.), Steine – Bilder – Texte, Leipzig 2001 • H. M. Niemann, Archäologie im Rahmen der Bibelwissenschaft, in: C. Ammer (Hg.), Einsichten aus Wissenschaft und Kunst, Hannover 2009, 9–31 • ders., Geschichte Israels, Archäologie und Bibel (AOAT 418), Münster 2015 • E. Pfoh, Rethinking the Historiographical Impulse: SJOT 32, 2018, 92–105.
Zu den entscheidenden Fragen jeder Geschichte gehört die Frage, welche Quellen der Darstellung zugrunde gelegt werden. Denn Auswahl und Gewichtung der Quellen entscheiden zwischen »guter« und »schlechter« Konstruktion. Der gezielte Ausschluss von Quellen (etwa der Archäologie in Beschränkung auf die Bibel) führt zu einem einseitigen Ergebnis (↗ I.3). Daher ist »ohne Einschränkung alles heranzuziehen, das irgend unmittelbar oder mittelbar einen Beitrag zu liefern mag« (Martin Noth, Geschichte Israels, Göttingen 1950, 52). Dazu gehören vor allem der (a) biblische Befund, (b) außerbiblische Texte, (c) → Epigraphik, (d) Archäologie, (e) → Ikonographie und (f) → Numismatik. Alle Quellen sind gleichermaßen einer kritischen Analyse und Bewertung zu unterziehen.
(a) Dass die Bibel trotz ihrer Darstellungstendenz zu den Quellen einer Geschichte Israels zu zählen ist, wurde bereits oben begründet. Natürlich haben nicht alle Informationen aus den erzählenden oder weisheitlichen Texten gleichermaßen einen Informationswert für die Geschichtsdarstellung. Doch besonders die sog. Geschichtsbücher, also d. h. die Bücher der Könige, der Chronik, Esra und Nehemia, aber auch Samuel, Josua und Richter müssen in die Rekonstruktion einbezogen und je in ihren Informationen einzeln bewertet werden. Aus der biblischen Quelle z. B. stammt die Aussage, dass König Joschafat von Juda (868–847 v. Chr.) eine Seeflotte in Ezjon-Geber zu installieren suchte, um über den Golf von Elat Außenhandel mit der arabischen Halbinsel und Ägypten zu betreiben. Der König des Nordstaates soll ihm eine Kooperation angeboten haben, die Flotte gemeinsam zu betreiben (1 Kön 22,49–50). Diese wirtschaftsgeschichtlich und außenpolitisch wichtige Notiz (↗ V.4.5) muss für die Entwicklung der beiden Staaten Juda und Israel ausgewertet werden. Allerdings nicht so, dass sie 1:1 als historisch übertragen wird, sondern im Rahmen einer kritischen Überprüfung der Aussage mit den anderen zur Verfügung stehenden Informationen zum 9./8. Jh. v. Chr. und dem Verhältnis von Juda und Israel, dem Verhältnis zu 1 Kön 9,26–28, wo Gleiches von Salomo gesagt wird und der Partner Hiram von Phönizien ist, dem archäologischen Befund von Ezjon-Geber und der Plausibilität des Fernhandels mit »Ofir« (was kein reelles, sondern ein legendäres Land ist) korreliert wird. Die Verwendung der Bibel als Quelle muss allerdings methodisch reflektiert geschehen und ist nicht abzukoppeln von einer Literargeschichte des Alten Testaments. Es macht z. B. einen Unterschied, ob Angaben zu David und Salomo bereits am Hof der Könige verschriftet wurden oder erst Jahrhunderte später.
(b) Zu den wichtigen außerbiblischen Texten gehören die antiken jüdischen Schriftsteller wie Philo von Alexandrien (ca. 10 v. Chr.–40 n. Chr.) und vor allem Flavius Josephus (ca. 37–100 n. Chr.). Wichtig sind aber auch die Informationen der nichtjüdischen griechischen Schriftsteller wie Herodot, Thukydides von Athen oder Hekataios von Abdera. Der aus Kleinasien stammende Herodot (ca. 485–424 v. Chr.) bietet eine Geschichte des Perserreiches ab dem Lyderkönig Krösus (ca. 560–547 v. Chr.) angefüllt mit einer Unmenge an Erzählungen über die Völker des Perserreiches. Thukydides beschreibt in der zweiten Hälfte des 5. Jh.s v. Chr. die griechische Geschichte, beginnend mit dem Krieg zwischen Athen und Sparta bis in das Jahr 411 v. Chr. Während Herodot und Thukydides vollständig erhalten sind, sind von dem Historiker und Philosophen Hekataios von Abdera aus dem 4. Jh. v. Chr. nur fragmentarische Werke erhalten. Darunter ist eine Geschichte Ägyptens, die wichtige Informationen über die Judäer/Juden in Ägypten liefert, die bei Flavius Josephus zitiert sind. Nur über Zitate bei Josephus und antiken christlichen Schriftstellern schließlich ist Manetho von Ägypten als Historiker bekannt, dessen Geschichte Ägyptens im Original verloren gegangen ist.
Zu den wichtigen außerbiblischen Quellen für eine Geschichte Israels gehört auch das in syrisch und griechisch überlieferte → Onomastikon des Eusebius von Cäsarea, das mit seiner Auflistung biblischer Ortsnamen für die historische Landeskunde unverzichtbar ist. Neben den deuterokanonischen Büchern, etwa den beiden Makkabäerbüchern (1 Makk, 2 Makk), die im Kanon der griechischen Septuaginta überliefert sind, gehören auch viele apokryphe außerbiblische Bücher zu den Quellen mit verwertbaren historischen Informationen. So etwa das (im orthodoxen Kanon erhaltene) dritte Makkabäerbuch (3 Makk), das die Rettung der alexandrinischen Juden vor der Verfolgung des Ptolemäerkönigs Ptolemäus IV. Philopator (221–204 v. Chr.) erzählt, oder die fiktive Erzählung des Aristeas, die in legendarischer Form die Übersetzung der Tora ins Griechische unter Ptolemäus II. Philadelphos (285/83–246 v. Chr.) berichtet.
Neben den sog. Historikern und historischen Werken sind schließlich die ägyptischen und mesopotamischen Texte von großem Wert für eine Geschichte Israels, seien es nun Erzählungen, Königslisten oder Chroniken. Erwähnt seien die Erzählung des Sinhuhe aus dem 2. Jt. v. Chr. oder der um 1071 v. Chr. entstandene sog. Reisebericht des Wenamun. Von direkterem Quellenwert ist beispielsweise die sog. Babylonische Chronik, in der auf vier erhaltenen Tontafeln die Ereignisse des Zeitraums von 626–594 v. Chr. chronologisch gegliedert geschildert werden.
(c) Die → Epigraphik ist eine Teildisziplin der Altertumswissenschaften, die sich mit Inschriften beschäftigt. Diese sind als Quellen für eine Geschichte Israels von unverzichtbarem Wert. Beispiele wären etwa für eine Lapidarinschrift die 1993 gefundenen aramäischen Fragmente der Verkleidung eines → Orthostaten aus Dan/Tell el-Qāḍī (↗ IV.5.2 u. V.4.3), in denen ein aramäischer Herrscher Auseinandersetzungen mit israelitischen und judäischen Königen in der Mitte des 9. Jh.s v. Chr. schildert. Mehrere → Hortfunde von → Ostraka, das sind auf Tonscherben mit Tinte geschriebene Texte, bereichern die Kenntnis über die wirtschaftliche und politische Organisation in Israel und Juda im 8./7. Jh. v. Chr. Zum Teil handelt es sich dabei auch um Briefe wie aus Lachisch oder um Briefformulare wie aus Kuntilet ʿAǧrūd oder um Dokumente der Militärorganisation wie aus Arad. Neben den Ostraka sind Inschriften auf Stempel- und Rollsiegeln sowie auf → Bullen und Siegelabdrücken (↗ Abb. 1) von Bedeutung über das → Onomastikon hinaus. Beispielhaft seien die inzwischen über 1.400 lmlk-Siegelabdrücke aus Juda genannt (↗ Abb. 37), in denen neben der Aufschrift »für den König« jeweils einer von vier Orten (Hebron, Socho, Sif und mmšt) genannt wird. Die auf Krughenkeln angebrachten Siegelabdrücke können als Quelle für die Wirtschafts- und Steuerorganisation des judäischen Staates zur Zeit des Königs Hiskija (725–697 v. Chr.) kurz vor (und wahrscheinlich auch kurz nach) dem Angriff der Assyrer auf Juda 701 v. Chr. verstanden werden. Aufgrund der großen Anzahl von verschiedenen Typen von lmlk-Stempelabdrücken lässt sich die Entwicklung des administrativen Systems in Juda im 8./7. Jh. v. Chr. präziser beschreiben. Zudem handelt es sich um einen wichtigen Indikator zur Datierung von archäologischen Befunden, da die Stempel auf den Krughenkeln nur für einen relativ kurzen Zeitraum verwendet wurden.
Abb. 1: Beispiele von Siegeln und Bullen aus Juda und Samaria aus verschiedenen Zeiten. Der Skarabäus (a) stammt aus der Grabung am Gihon im 9. Jh. v. Chr. Das geflügelte Wesen ist wahrscheinlich als Greif zu deuten, der das Symbol des Lebens beschützt. Das Motiv hat syrische Parallelen, oft beschützt der Greif aber einen Lebensbaum. Die ebenfalls in der Nähe der Gihon-Quelle gefundene Bulle (b) zeigt einen Thron mit hoher Lehne und eine geflügelte Scheibe darüber (9. Jh. v. Chr.). Aus dem späten 7. Jh. v. Chr. datieren die zwei Siegelabdrücke aus dem sog. Haus der Bullen mit exemplarischen Bildmotiven wie einer weidenden Hirschkuh (c) und einer Taube mit Zweigen (d). Ebenfalls aus dem Haus der Bullen am Abhang des Südosthügels in Jerusalem stammen die beiden anikonischen Siegelabdrücke (e) mit der Aufschrift »dem Gemarjahu (zugehörig), dem (So)hn des Schafan« und (f) lʿzryhw bn ḥlqyhw »von/für ʿAzaryāhū, den Sohn des Ḥilqiyāhū«.
Abb. 1(Fortsetzung von Seite 22): Die Beispiele (g) und (h) stammen aus dem → Hortfund aus Wādī ed-Dālīye, der ins 4. Jh. v. Chr. (um 375–335 v. Chr.) datiert, und zeigen griechischen Einfluss. Der junge, nackte Mann (g) kann wegen der Keule und den rechts unten noch erkennbaren Resten eines Löwenfells als Herakles identifiziert werden. Diese Bulle versiegelte mit sechs anderen den Samaria Papyrus 1 (Sklavenverkauf), der in das Jahr 335 v. Chr. datiert. (h) zeigt den Abdruck eines Metallfingerrings mit mandelförmigem Ringkopf auf einer Bulle, an der noch Reste der Schnur zu erkennen sind. Dargestellt ist ein junger, nackter Krieger mit Schild.
(d) Den verfügbaren archäologischen Daten kommt eine zentrale Bedeutung in der Rekonstruktion der Geschichte Israels zu. Dabei sind mit der Terminologie Fernand Braudels sowohl geschichtliche Informationen zur longue durée, zur moyenne durée und zur courte durée/événement von Bedeutung. Mit der longue durée sind sich nur langsam verändernde Konstanten gemeint, also etwa die geologischen, klimatischen oder kulturellen Bedingungen, weitgehend unveränderliche geopolitische Strukturen, wiederkehrende Siedlungsmuster etc. Die moyenne durée hingegen beschreibt Konjunkturen wie etwa den phasenweisen Wechsel von → Urbanisierung und Deurbanisierung, den Zusammenbruch der internationalen Handelssysteme in der Spätbronzezeit, Phasen besonderer klimatischer Trockenheit etc. Die Ebene der événements schließlich meint die historischen Ereignisse wie die archäologisch nachweisbare Eroberung Lachischs 701 v. Chr., die Eroberung Gazas durch Tiglat-Pileser III. 734 v. Chr. oder das sowohl textlich bezeugte (Am 1,1; Sach 14,5) wie archäologisch (in Gat/Tell eṣ-Ṣāfī, Hazor, Megiddo, Geser, Lachisch, Tell Dēr ʿAllā u. a. m.) nachweisbare verheerende Erdbeben, das zwischen 800 und spätestens 760 v. Chr. Palästina erschütterte und meist auf 762 v. Chr. datiert wird (A. M. Maeir).
Die archäologischen Daten entstammen sowohl Ausgrabungen als auch Oberflächensurveys, in denen in größeren Gebieten alle verfügbaren Siedlungsspuren gesammelt werden. In Ausgrabungen, die in Palästina seit der Mitte des 19. Jh.s durchgeführt werden, werden Siedlungsschichten, sog. → Strata, isoliert, sodass über die relative Abfolge dieser Schichten auf einem → Tell die Siedlungsgeschichte eines Ortes rekonstruiert werden kann. Architekturreste, sehr oft nur Fundamente von Gebäuden, lassen sich zu der Befestigung und der Bebauung eines Ortes hypothetisch rekonstruieren. So zeugt z. B. die sog. broad wall, ein im jüdischen Viertel in Jerusalem entdecktes Mauerstück, von der westlichen Stadtbefestigung im 8. Jh. v. Chr. und – weil es zuvor im Westteil der Stadt keine Befestigungsmauer gab – von der zeitgleichen Erweiterung der Stadt nach Westen. Die materielle Kultur (Keramik, Werkzeuge, Gewichte, Schmuck, Figurinen etc.) erlaubt eine relative chronologische Einordnung und gibt oft weitere Aufschlüsse über die Geschichte eines Ortes oder einer Region.
(e) Die → Ikonographie Palästinas beschäftigt sich mit der Bildwelt der südlichen Levante (Israel/Palästina/Jordanien), die ebenfalls eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion der Geschichte Israels darstellt. Dabei geht es weniger um Abbilder der assyrischen, persischen oder israelitischen Könige (denn Bilder unterliegen durchweg bestimmten Darstellungskonventionen und sind stilisiert), sondern um Informationen zur Kulturgeschichte, die aus dem Symbolsystem abgeleitet werden. Von besonderer historischer Bedeutung sind die Siegelabdrücke, die selbst historische Informationen enthalten. So etwa ein Stempelsiegel mit Königskartusche aus Geser (↗ Abb. 2), das in die Zeit der 18. Dynastie (1550–1292 v. Chr.) auf Pharao Amenophis III. (1388–1351/50 v. Chr.) weist und damit zur Datierung des → Stratums, in dem der Fund gemacht wurde, beiträgt.
Abb. 2: Skarabäus aus Geser (ca. 1390–1353 v. Chr.), das in der rechten Kartusche den Thronnamen Amenophis’ III. und in der linken den Eigennamen der Königin (»Große königliche Gemahlin Teje, sie möge leben«) enthält. Über (»vollkommener Gott«) und unter (»dem Leben gegeben ist«) den Kartuschen finden sich weitere ägyptische Inschriften. Die Aufsicht und Seitenansicht lassen den Aufbau eines Skarabäus erkennen, der einen Blatthornkäfer nachbildet, am ehesten den ägyptischen heiligen Pillendreher (Scarabaeus sacer L.), der in Ägypten mit dem Sonnenlauf verbunden wurde und für die ständige Erneuerung steht. Als Stempelsiegelamulett sind Skarabäen in der ganzen Levante verbreitet.
Oder der Abdruck auf dem Gefäßhenkel aus Tel Ḥārāsīm (↗ Abb. 3), der neben der Besitzerin Hanuna auch den Provinznamen Jehud nennt und so die (wahrscheinlich negativ zu beantwortende) Frage der Zugehörigkeit des Ortes in der Schefela zur persischen Provinz Jehud aufwirft.
Abb. 3: Perserzeitlicher Siegelabdruck auf einem Gefäßhenkel vom Tel Ḥārāsīm (ca. 530–330 v. Chr.) mit der aramäischen Inschrift lḥnwnh yhwd »Der Hanuna (gehörig), Jehud«. Die Erwähnung der Provinz Jehud könnte darauf hindeuten, dass es sich bei Hanuna um ein Mitglied der Verwaltung handelt.
Da ansonsten der Zusatz Jehud auf offizielle Mitglieder der Administration weist, wird durch den Siegelabdruck zugleich die Frage nach der Rolle von Frauen in der persischen Provinzverwaltung gestellt und schließlich die der Rückkehrerinnen aus Babylon angeschnitten, da ein ähnliches Exemplar aus Babylon bekannt ist.
(f) Als Quelle der Datierung sind besonders Münzen ab der Perserzeit von Bedeutung, wobei die Genauigkeit der Datierung ab der hellenistischen Zeit zum Teil bis auf einzelne Jahre hin anwächst. Dabei ist allerdings die Datierung über sekundär datierte Funde generell mit einer Unsicherheit belastet, da der Prägezeitraum einer Münze nicht mit ihrem Verwendungszeitraum identisch sein muss. So sind z. B. bei den Grabungen auf dem Garizim insgesamt 14.000 Münzen gefunden worden. Mit den 72 persischen Münzen lässt sich die früheste Bauphase des Tempels ungefähr datieren. Die ältesten Münzen im Grabungsbefund, die aus Zypern, Tyrus und Sidon stammen (↗ Abb. 4), lassen zusammen mit anderen Indizien erkennen, dass das Heiligtum bereits im 5. Jh. v. Chr. existierte.
Zunächst ergibt sich aber nur ein terminus post quem, d. h. ein Datum nach dem der entsprechende Befund datiert werden kann, wenn die entsprechenden Funde im Fundamentbereich gemacht worden sind. Da aber nicht immer auszuschließen ist, dass die Münzen über den Zeitraum ihres Umlaufs als Zahlungsmittel aufbewahrt wurden und so ihr Verwendungszeitraum über den Prägezeitraum hinausgeht, bleibt eine gewisse Unsicherheit. Die Datierungstendenz hängt oft vom Fundkontext ab. Wird eine Münze im Fundamentbereich eines Gebäudes gefunden, ist ein terminus ante quem, d. h. die Errichtung des Gebäudes vor dem Prägezeitraum einer Münze, ausgeschlossen. Wenn die Münze hingegen auf dem Fußboden eines Gebäudes gefunden wurde, gibt sie einen Hinweis auf den Zeitpunkt der Errichtung, der vor der Prägung der Münze liegen muss. Der terminus post quem ist bei Einzelstücken sicherer, weil sich nicht ausschließen lässt, dass ein älteres Stück länger in Gebrauch geblieben ist. Neben der Datierungsfunktion sind Münzen als Hinweis auf wirtschaftliche und politische Zusammenhänge von großem Wert.
Abb. 4: Die ältesten der insg. 14.000 Münzen aus dem Tempelbezirk auf dem Garizim. Die Drachme (a) wurde in Zypern ca. 480 v. Chr. geprägt, (b) in Tyrus zwischen 450–400 v. Chr., (c) in der ersten Hälfte des 4. Jh.s v. Chr. auch in Tyrus und (d) im späten 5. Jh. v. Chr. in der Hafenstadt Sidon.
Das letzte Beispiel macht noch einmal deutlich, dass auch Quellen einen Kontext haben und zunächst der Einordnung und Analyse bedürfen, bevor sie für die historische Rekonstruktion ausgewertet werden können. In einem wissenschaftlichen Kontext unverzichtbar ist dabei die Nachprüfbarkeit der Argumentation. Dabei ist besonders auf einen Grundsatz hinzuweisen: Die positive Evidenz ist weit beweiskräftiger als das Fehlen von Belegen. Denn das Fehlen von Belegen sagt als solches noch nicht viel aus. Es gilt der Merksatz »The absence of evidence is not the evidence of absence« (übertragen etwa: die Nicht-Existenz von Belegen belegt nicht die Nicht-Existenz). Nur weil es keine Quelle gibt, die die Existenz Salomos außerbiblisch belegt, ist damit König Salomo noch nicht unhistorisch. Aus dem Fehlen von lmlk-Stempeln in Sif/Tell Zīf südöstlich von Hebron ist nicht unbedingt zu schließen, dass der Ort außerhalb der judäischen Administration lag (Jos 15,24.55; 2 Chr 11,8) oder nichts mit den überwiegend im Norden Judas gefundenen Siegelabdrücken lmlk-Sif zu tun hatte. Tendenziell kann allerdings auch das Fehlen von Evidenz aufschlussreich sein, etwa wenn für eine militärische Landnahme von Jericho (Jos 6) oder Ai (Jos 8) entsprechende Hinweise im archäologischen Befund fehlen.
Zwar kommt außerbiblischen Quellen nicht prinzipiell ein Vetorecht zu und alle Quellen können prinzipiell den gleichen historischen Wert haben, doch sind insbesondere dann außerbiblische Quellen vorzuziehen, wenn es eine koinzidente Zusammenstimmung gegen den biblischen Befund gibt. Eine feste Hierarchie zwischen den Quellen jedoch gibt es nicht. Die Unterscheidung in Primärquellen (Archäologie, → Epigraphie, → Ikonographie) und Sekundärquellen (z. B. Bibel, Babylonische Chronik, Josephus und andere antike Geschichtsschreiber) hat nur insofern ihr Recht, als dass sie den Abstand zu den zeitlichen Ereignissen als qualitatives Kriterium wertet und damit den Primärquellen ein gewisses »Prä« zukommen lässt. Beide Arten von Quellen sind gleichermaßen kritisch und methodisch reflektiert in eine Geschichte Israels einzubringen.
Die im Rahmen der Einleitungswissenschaft zum Alten/Ersten Testament zu behandelnde Geschichte Israels steht nicht für sich, sondern bedarf zudem des ergänzenden Rahmens der Sozial- und Kulturwissenschaften, der Philosophie und insbesondere der historischen Disziplinen (Alte Geschichte, Historische Anthropologie, Altorientalistik, Ägyptologie u. a. m.).
5. Wann beginnt eine »Geschichte Israels«?
J. Day (Hg.), In Search of Pre-Exilic Israel (JSOT.S 406), London 2004 • L. L. Grabbe (Hg.), Can a »History of Israel« Be Written? (JSOT.S 245), Sheffield 1997 • ders., Ancient Israel, London 22017 • J.-L. Ska, L‘histoire d‘Israël: RSR 103, 2015, 15–34 • ders., Questions of the »History of Israel« in Recent Research, in: M. Sæbø (Hg.), Hebrew Bible, Old Testament, Vol. 3,2, Göttingen 2015, 391–432.
Für den Beginn einer Darstellung der »Geschichte Israels« werden verschiedene Optionen diskutiert. Die Positionen sind dabei abhängig von der Vorentscheidung, wie das Verhältnis von biblischen und außerbiblischen Quellen gewertet wird, wann die biblischen Texte datiert werden und wie die politische Größe Staat als Grundlage der Geschichte definiert wird. Bildet die Bibel den Ausgangspunkt, sind die Extrempositionen die Erzeltern (mündliche Überlieferungen aus der sog. Patriarchenzeit bilden die Grundlage) auf der einen und die hellenistische Zeit (die Bibel wird als hellenistisches Buch verstanden) auf der anderen Seite. Bilden hingegen die außerbiblischen Daten den Ausgangspunkt, wird entweder mit dem sog. Landnahmeprozess (in dem Israel entsteht), dem 10./9. Jh. v. Chr. (in dem staatliche Strukturen eines »Israel« erstmalig erkennbar werden), dem 9. Jh. v. Chr. (in dem »Israel« erstmals als politische Größe außerbiblisch erwähnt wird) oder noch später begonnen. In der folgenden Darstellung wird eine Mittelposition eingenommen. Es erscheint sinnvoll, zwischen einer Vorgeschichte Israels und der Geschichte Israels zu unterscheiden, den Übergang aber mehr oder minder fließend zu halten. Es ist zuzugestehen, dass von einer staatlichen Größe im eigentlichen Sinn frühestens (!) im 10. Jh. v. Chr., eher im 9. Jh. v. Chr. gesprochen werden kann. Eine Geschichte Israels könnte begründet erst dann einsetzen. Aber ohne die Vorgeschichte Israels, die zeitlich mindestens bis zur Mittelbronzezeit (MB II, 2000–1550 v. Chr.) zurückgreifen muss, was hier aus Platzgründen unterbleibt, ist eine Geschichte Israels ebenso wenig zu verstehen wie ohne den Kontext der Nachbarkulturen. Auch hier muss die Darstellung stark reduzieren. Sieht man von der biblischen Darstellung ab, existiert eine Größe »Israel« vor dem 9. Jh. v. Chr. streng genommen weder ethnisch noch politisch. Da aber für die Zeit ab etwa 1000 v. Chr. der Terminus Königszeit eingeübt ist, wird hier für die Landnahme, die oft als → Ethnogenese verstanden wird, der Begriff Frühgeschichte verwendet.
Für chronologische Angaben werden neben Jahresangaben auch die in der Archäologie eingeführten Epochenbezeichnungen der Metallzeitalter Bronzezeit und Eisenzeit benutzt. Grob unterscheidet man die Frühbronzezeit ca. 3200–2000 v. Chr. (FB-Zeit), die Mittelbronzezeit ca. 2000–1550 v. Chr. (MB-Zeit) und die Spätbronzezeit ca. 1550–1200 v. Chr. (SB-Zeit) von der Eisenzeit ca. 1200–587 v. Chr. (E-Zeit). Den Eisenzeiten folgt die sog. babylonisch-persische Zeit 587–333 v. Chr., dann die hellenistische Zeit 333–37 v. Chr., an die sich die römische Periode anschließt. Die jeweiligen Perioden werden weiter unterteilt, dazu die Tabelle ↗ X.1.1. Es ist sinnvoll, sich zur Orientierung zunächst die Epocheneinteilung einzuprägen.
6. Was bezeichnet Israel in der »Geschichte Israels«?
B. J. Diebner, Seit wann gibt es »jenes Israel«?, Münster 2011, 31–84 • E. Pfoh, From the search for ancient Israel to the history of ancient Palestine, in: I. Hjelm/T. Thompson (Hg.), History, Archaeology and the Bible Forty Years After »Historicity«, New York 2016, 143–158 • R. Smend, Das alte Israel im Alten Testament, in: ders., Bibel und Wissenschaft, Tübingen 2004, 1–15 • N. Thiel, »Israel« and »Jew« as Markers of Jewish Identity in Antiquity: JSJ 45, 2014, 80–99 • K. Weingart, Stämmevolk – Staatsvolk – Gottesvolk? (FAT II/68), Tübingen 2014; M. Weippert, Art. Israel und Juda: RLA 5, 1980, 200–208.
Die Bezeichung »Israel« ist vieldeutig. Biblisch kann Israel den Erzvater Jakob bezeichnen, dem in Gen 32,29 – dem ersten, aber nicht jüngsten Beleg des Wortes yiśrāʾel im Pentateuch – der Ehrenname »Israel« verliehen wird (Gen 35,10).
Später bezeichnet »Israel« im Pentateuch die Gesamtheit der 12 Söhne Jakobs und ihrer Nachkommen, die etwa in Ex 1,9 »das Volk der Kinder Israel« (Luther) oder einfacher »das Volk der Israeliten« (EÜ) genannt werden. Ab dem Exodus (↗ II.4) bezeichnet »Israel« biblisch bis in die Königszeit das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, auch in seiner politischen Verfasstheit als Stämmebund (↗ III.5–7), als Königtum (↗ IV.4–6) oder als Staat. »Israel« ist jedoch nicht nur das »Gesamtisrael«, sondern ab der sog. »Reichsteilung« (↗ IV.7), bei der durch die Königserhebung Jerobeams die Einheit des Königtums unter Saul, David und Salomo zerbricht (1 Kön 11), wird »Israel« zur Bezeichnung des politischen Gebildes im Norden, während »Juda« den kleineren Teil im Süden bezeichnet. Nach dem Untergang der politischen Größe »Israel« 722/20 v. Chr. (↗ V.6) wird jedoch auch Juda biblisch vor allem in prophetischen Texten als »Israel« bezeichnet, und so geht »Israel« ins Exil, obwohl aus dem ehemaligen Staat im Norden 597 bzw. 587/86 v. Chr. nicht noch einmal Bewohner deportiert wurden (↗ V.9 u. V.11). Auch die nachexilische Gemeinde (↗ VI.3) wird als »Israel« angesprochen, und das hält sich über die hellenistische Zeit, wo es unter den Hasmonäern wieder einen König »Israels« gibt (↗ VII.6), über die Zeitenwende bis in die Zeit des Neuen Testaments durch (↗ VIII.). Schaut man auf den außerbiblischen Befund, werden die aufgelisteten Größen nur selten tatsächlich als Israel bezeichnet. Inschriftlich ist Israelsicher zuerst auf der Merenptah-Stele zu finden (1208 v. Chr.), wobei nicht klar ist, was der Name dort bezeichnet (↗ II.3). Auf der moabitischen Mescha-Stele in der zweiten Hälfte des 9. Jh.s v. Chr. (↗ V.4.1) und auf der aramäischen Stele von Dan (↗ V.4.3) bezeichnet Israel den von Samaria aus regierten Staat. Aus dem Jahr 853 v. Chr. stammt auch der Beleg aus einer Inschrift Salmanassars III. (859–824 v. Chr.), in dem Ahab von Israel genannt wird (geschrieben kurSir-ʾi-la-a-a) (↗ V.4.6). Ein Beleg für die Zwischenzeit vom 12.–9. Jh. v. Chr. fehlt und es ist letztlich derzeit auf der Grundlage der außerbiblischen Quellen nicht aufzuhellen, ab wann Israel als politische Größe auf die Bühne der Weltgeschichte tritt. Es scheint aber so zu sein, als wenn das erst im 9. Jh. v. Chr. mit dem von Samaria aus regierten Königtum der Fall war (↗ IV.7). Die Bedeutung des Namens ist ebenso unklar wie das, was er ursprünglich bezeichnet.
Das Frühjudentum und das nachbiblische Judentum sind sich ihrer Identität als »Israel« durchgehend auch nach der Tempelzerstörung 70 n. Chr. bewusst. Seit der Gründung des modernen Staates »Israel« 1948 bis in die Gegenwart ist die Bezeichnung schließlich nicht nur eine religiöse Bezeichnung des »Volkes Israel«, die mit dem Begriff »Judentum« synonym gebraucht wird, sondern auch die eines politisch verfassten Gemeinwesens. Daneben ist »Israel« eine geographische Bezeichnung des Landes Israel, dessen Gebiet ebenso durch die Zeiten unterschiedlich zu konkretisieren ist.
Da die Vielfalt und Breite der unterschiedlichen Füllungen immer mitschwingen, ist die Bezeichnung »Israel« nicht einfach zu verwenden. In der folgenden Darstellung meint »Israel« nahezu durchgehend die politische oder geographische Größe im 1. Jt. v. Chr. Wenn die theologisch und religiös aufgeladenen Bedeutungsebenen explizit gemeint sind, ist das im Text angezeigt. Der Titel »Geschichte Israels« folgt eher einer Konvention für den übergeordneten Titel der Darstellung, als dass er eine exakt zutreffende Bezeichnung wäre.
7. Der Raum der »Geschichte Israels« und die Bezeichnungen des Landes
C. Frevel, Das Land der Bibel, in: E. Zenger (Hg.), Lebendige Welt der Bibel, Freiburg 1997, 68–80 • M. Noth, Die Welt des Alten Testaments, Freiburg 1992 • W. Zwickel, Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde, Darmstadt 2002 • ders., Das Heilige Land, München 2009.
So wie »Israel« als politisch-soziale Größe durch die Zeiten etwas sehr Unterschiedliches meinen kann, ist auch die geographische Konkretion des Begriffs aufgrund sich wandelnder Grenzziehungen verschieden. Das gilt auch für Palästina, Syrien, Jordanien oder Ägypten, die ebenfalls zugleich moderne politische Größen bezeichnen. Die nicht biblische Bezeichnung »Palästina« etwa leitet sich von dem aramäischen pelištāʾīn ab, in dem das hebräischepelištîm »Philister« nachklingt (vgl. das ägyptische prst/pw-r-s-ṯ). Bei Herodot (Hdt. Hist. I,105; III,5.91; VII,89) wird so das Siedlungsgebiet der Philister in der Küstenebene von Jafo bis Gaza benannt, doch schon im 9./8. Jh. v. Chr. umfasst die Bezeichnung in neuassyrischen Quellen auch Teile der phönizischen Küstenebene. 135 n. Chr. wird Palästina zur Bezeichnung der römischen Provinz syria palaestina, der zunächst nur das Land westlich des Jordans zugerechnet wird. Unter Kaiser Diokletian (284–305 n. Chr.) wird der nördliche Teil der provincia arabia, das südliche Ostjordanland, der Negeb und der Sinai der Provinz zugeschlagen. Um 400 n. Chr. wird dann die Provinz dreigeteilt in palaestina prima (Juda, Samaria, Küstenstreifen), secunda (Galiläa, nördliches Ostjordanland) und tertia (südliches Ostjordanland vom Arnon südwärts, Negeb, Sinai) (zu den Regionen ↗ X.6, Karte 14). In dem britischen Mandatsgebiet von 1920, das in etwa das heutige Staatsgebiet Israels, die palästinensischen Autonomiegebiete und Jordanien umfasst, wirkt diese Grenzziehung Palästinas ebenso nach wie in dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch, wo Palästina als Regionalbezeichnung für den südlichen Teil der syro-palästinischen Landbrücke steht. Palästina ist dabei südlicher Teil der Levante, des sog. fruchtbaren Halbmonds, der sich von Mesopotamien über Syrien, den Libanon und die phönizische Küste bis zum Nilschwemmland in Ägypten erstreckt (↗ X.6, Karte 13).
Wie der Israelbegriff (↗ I.6) sind auch die Bezeichnungen des Landes nicht neutral, sondern mit historischen und modernen Konnotationen verbunden. »Judäa« und »Samaria« sind z. B. im modernen Verwendungskontext die Bezeichnungen des Staates Israel für das besetzte Westjordanland in den Grenzen von 1967. Durch den Gebrauch der biblischen Bezeichnungen im modernen Kontext wird ein israelischer Anspruch auf das Gebiet der Autonomiegebiete mitgesetzt. Jede Wahl eines Begriffes oder einer Bezeichnung nimmt eine bestimmte Perspektive ein. So ist etwa, wenn das scheinbar neutrale »Transjordanien« gebraucht wird und damit das Gebiet jenseits des Jordans gemeint ist, der Standpunkt notwendig im Westjordanland und das bedeutet implizit eine Wertung. Auch »Syrien«, »Israel« und »Palästina« lassen sich nicht völlig aus dem Bann der Ideologien heraushalten. Es ist wichtig, sich das stets bei dem Gebrauch der Bezeichnungen zu vergegenwärtigen. In der vorliegenden Darstellung ist häufig von der südlichen Levante die Rede, wenn der Raum Südsyriens gemeint ist. Auch »Palästina« ist möglichst neutral als geographische Bezeichnung verwandt.
Legt man den Gebrauch von Palästina als Regionalbezeichnung des Gebietes westlich und östlich des Jordantals und seiner südlichen Fortsetzung im Araba-Graben zugrunde, spielt die »Geschichte Israels« in diesem Raum bzw. in Teilen dieses Raumes (↗ X.6, Karte 14). Sie ist jedenfalls nicht nur auf das Staatsgebiet des heutigen »Israel« oder auf das antike Israel und Juda zu beschränken. Die Bezeichnung »Heiliges Land«, die biblisch nur in Sach 2,16 (ʾadmāt haqqodæš) auftaucht und in der »heiligen Grenze« bzw. dem »heiligen Gebiet« (gebûl qådšô) von Ps 78,54 anklingt, ist gegenüber dem neutraleren Palästina weniger geeignet, da sie theologisch stark aufgeladen ist und zudem keinesfalls immer klar ist, welches Gebiet damit genau gemeint ist.
Die Bezeichnung Kanaan schließlich, die in der Literatur häufiger synonym zu Palästina gebraucht wird, ist bereits im 3. Jt. v. Chr. belegt und geht auf das keilschriftliche kinaḫḫi zurück. In den Texten der syrischen Stadt Ebla/Tell Mardīḫ Ende des 3. Jt.s v. Chr. scheint die Bezeichnung das Gebiet Nordsyriens zu benennen, doch im 2. Jt. v. Chr. steht Kanaan für die ägyptische Provinz Kanaan, die im Süden an Ägypten grenzt und im Norden bis Byblos reicht. In den Amarnabriefen(↗ II.2.6) findet sich jedoch auch ein weiterer Gebrauch, der ganz Syrien bis an den Orontes mitumfasst und den gesamten von Ägypten dominierten Besitz im Norden bezeichnet. Außerbiblisch ist Kanaan im 1. Jt. v. Chr. nicht mehr in Inschriften oder Texten verwandt. Auf einem ägyptischen Statuettenfragment (Baltimore MD 22.203) aus der 22./23. Dynastie (946/45–716 v. Chr.) ist noch einmal von einem Gesandten namens Pedieseaus »dem Kanaan« die Rede (HTAT Nr. 104), womit wie auch sonst häufiger die Stadt Gaza gemeint ist. Danach verschwindet die Bezeichnung aus dem Quellenmaterial, um dann in hellenistisch-römischer Zeit wieder in phönizischen Quellen aufzutauchen. Biblisch ist Kanaan eine der Bezeichnungen für das verheißene Land (z. B. Gen 12,5; Ex 6,4; Num 13,2), wobei auch dabei nicht durchgehend der gleiche geographische Raum gemeint ist. Zudem ist die Bezeichnung durch den konstruierten kulturell-religiösen Gegensatz zwischen Israel und Kanaan (Gen 9,25; Lev 18,3) stark aufgeladen, sodass sie sich nicht zur generellen Verwendung eignet. In der vorliegenden Darstellung wird Kanaan im engeren Sinn für das Gebiet der spätbronzezeitlichen Provinz Kanaan bzw. für den südsyrischen Ausläufer der bronzezeitlichen Stadtkultur verwendet (↗ II.2.1, Karte 1).
Die knappen Ausführungen zu den Bezeichnungen des Landes und den damit verbundenen Konnotationen zeigen, dass die »Geschichte Israels« nicht von einer Geschichte der Region, die auch die politische Geschichte der Nachbarn berücksichtigt, zu lösen ist. Das spätbronzezeitliche Kanaan (↗ III.) ist ebenso wie das Israel und Juda der Königszeit (↗ IV. u. V.), die perserzeitlichen Provinzen Jehud und Samaria (↗ VI.) und das hellenistische Judaä (↗ VII.) eingebunden in das sich je verändernde »Gleichgewicht der Kräfte« im Großraum Vorderasiens. Die Lage der Region auf der syro-palästinischen Landbrücke zwischen Vorderasien und Ägypten macht es strategisch und politisch immer wieder auch interessant für die großen Mächte, die das politische Geschehen bestimmen.
8. Biblische Zahlen und Chronologien
C. Berner, Jahre, Jahrwochen und Jubiläen (BZAW 363), Berlin u. a. 2006 • E. Gass, »Im x-ten Jahr von …«, in: H. Rechenmacher (Hg.), In Memoriam Wolfgang Richter (ATSAT 100), St. Ottilien 2016, 65–89 • T. Hieke, Genealogien der Genesis (HBS 39), Freiburg 2003 • K. Koenen, 1200 Jahre von Abrahams Geburt bis zum Tempelbau: ZAW 126, 2014, 494–505 • J. Kotjatko-Reeb u. a. (Hg.), Nichts Neues unter der Sonne? (BZAW 450), Berlin u a. 2014 • A. Laato, Guide to Biblical Chronology, Sheffield 2015 • J. Werlitz, Das Geheimnis der biblischen Zahlen, Wiesbaden 42011.
Wann fanden die Ereignisse, die im Alten Testament berichtet werden, statt? Die Frage nach der biblischen Chronologie, also der Verortung der Ereignisse in einem zeitlichen Verlauf, stellt sich unabhängig von der Frage, welchen geschichtlichen Wert man den einzelnen Informationen beimisst. Das lässt sich am Beispiel von 1 Kön 14,25 zeigen, wo von einem Feldzug des ägyptischen Pharaos gegen Jerusalem im fünften Jahr Rehabeams die Rede ist. Das Ereignis ist in der erzählten Konkretion (Angriff Jerusalems) nicht historisch, ein Feldzug Schischaks nach Palästina aber sehr wohl. Es handelt sich um eines der wichtigsten Ereignisse im 10. Jh. v. Chr., doch ist die Datierung dieses Feldzugs sehr kompliziert (↗ IV.8) und die Angabe von 1 Kön 14,25 ein wichtiger Anhaltspunkt, wenn man davon ausgeht, dass sie zutreffend ist. Doch wann war das »fünfte Jahr« Rehabeams?
Die Angaben in den alttestamentlichen Texten sind häufig vermeintlich konkret: Der Bau des Ersten Tempels fand 480 Jahre nach dem Exodus statt (1 Kön 6,1), der Aufenthalt Israels in Ägypten soll 430 Jahre gedauert haben (Ex 12,40, vgl. aber Gen 15,13). Das scheint eine genaue Angabe, und man ist geneigt, dem Glauben zu schenken. Nimmt man Gen 21,5; 25,26; 47,9.28 hinzu, begann der Aufenthalt in Ägypten 290 Jahre nach der Geburt Abrahams. Zusammengenommen ergibt sich, dass der Tempel 1.200 Jahre nach Abrahams Geburt gebaut worden sein muss (K. Koenen). Keines der Daten dieser »relativen Chronologie« ist absolut und die runde Zahl am Ende deutet darauf hin, dass das Ziel der Aussage nicht die Chronologie, sondern die Heilsgeschichte ist. Für eine verlässliche »absolute Chronologie« sind die Daten daher kaum zu gebrauchen. Das ergibt sich auch, wenn man in Betracht zieht, dass Jakobs Enkel Kehat mit nach Ägypten zog (Gen 46,11), aber dessen Enkel Mose die Hebräer aus Ägypten geführt hat (Ex 6,18.20