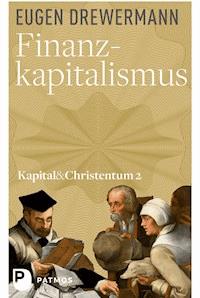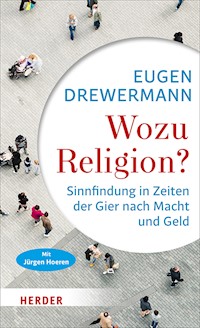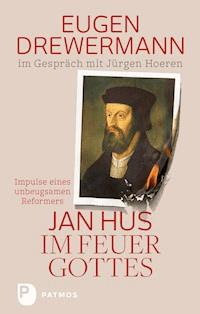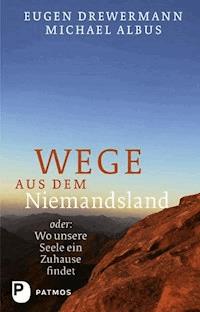Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Märchen vermitteln tiefe Weisheiten, auch über Gott. Gott und die Gerechtigkeit sind Thema der Grimm'schen Märchen, die Eugen Drewermann auslegt. Über Gott kann man viel sagen, doch entscheidend ist, was jemand tut, meint die Geschichte "Der Arme und der Reiche". Der "Schneider im Himmel" konterkariert auf humorvolle Weise die unheilvolle Strafegerechtigkeit in Ethik und Justiz und kommt der Aufforderung der Bergpredigt nahe, nicht über Menschen zu Gericht zu sitzen. Die Geschichte vom "Sterntaler"-Mädchen zeigt dagegen etwas von Gottes Art zu richten als eine Belohnung des Guten durch sich selbst. Die Geschichte von den "Drei Sprachen" spricht von Gott, indem sie ironischerweise jemanden zum Papst krönt, der die Sprache der Tiere versteht und ihr folgt. Ein Buch, das daran erinnert, was es heißt, gütig und gerecht, also menschlich zu handeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Navigation
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Bildteil
ÜBER DAS BUCH
ÜBER DEN AUTOR
IMPRESSUM
HINWEISE DES VERLAGS
Eugen Drewermann
Geschichten gelebter Menschlichkeit
oder: Wie Gott durchGrimm´sche Märchen geht
Patmos Verlag
Inhalt
Einleitung
Der Arme und der Reiche (KHM 87) oder: Vom gastfreundlichen Geben
Vor alten Zeiten, als der liebe Gott noch selbstauf Erden wandelte
… und ging hinüber zu dem kleinen Haus
„hätt ich das nur gewußt!“
„Was helfen mir alle Reichtümer der Welt?“
„Du mußt mir auch wieder herunterhelfen“
Der Schneider im Himmel (KHM 35) oder:Vom einsichtigen Vergeben
daß der liebe Gott … sich ergehen wollte
Da sah er alles, was auf Erden geschah
„wollt ich richten, wie du richtest“
Die Sterntaler (KHM 153) oder:Vom freiwilligen Hergeben
Und weil es so von aller Welt verlassen war
fielen auf einmal die Sterne vom Himmel
Die drei Sprachen (KHM 33) oder:Gott hat die Tiere als Geschwister uns gegeben
„ich habe gelernt, was die Hunde bellen“
„Mein Sohn, was hast du gelernt?“
„Sie … müssen einen großen Schatz hüten“
daß er der heilige Papst werden sollte
Bildbeschreibungen
Literatur
Anmerkungen
Einleitung
Es ist in Märchen wie auch sonst im Leben: Da geht von Gott die Rede, doch oft genug in »ungöttlichem« Sinne, – das Wort bezeichnet nicht, was es besagen sollte, ja, es meint offenbar das Gegenteil von dem, was einem Menschen Gott sein müßte.
Das Märchen vom Marienkind (KHM 3) zum Beispiel1 erzählt davon, daß die Madonna selber ein Arme-Leute-Kind bei sich im Himmel aufzieht, es köstlich hält und mit den Engeln spielen läßt; allein, man braucht nicht viel Psychologie dazu, um in dieser Beschreibung einer scheinbar äußerst wünschenswerten Kindheit den Anfang einer unvermeidbaren Tragödie zu erkennen, geformt aus dem Ideal »kindlicher Unschuld« und jungfräulicher Unberührtheit, – nicht zufällig war es die katholische Kirche, welche im 16. Jh. in Böhmen gerade diese Geschichte in Umlauf brachte, um ihre Art von Marienfrömmigkeit in der Andacht des Volkes gegen die Lehre der Reformatoren von der Rechtfertigung des Menschen allein aus Gnade durchzusetzen. Sie ahnte nicht und will bis heut nicht wissen, was sie dabei als »göttlich« zu verteidigen und zu verwalten unternahm: die Unterdrückung der (weiblichen) Sexualität in rigoroser Form! Denn: Kaum wird jenes »Marienkind« zwölf Jahre alt – kaum möchte es vom Mädchen aufreifen zur Frau –, als die »Gottesmutter« ihm die Schlüssel zu den zwölf Kammern des Himmels anvertraut, unter dem strengen Verbot, die dreizehnte sich zu erschließen. Hinter jeder Türe, die es öffnet, entdeckt es im Fortschritt der Zeit einen Apostel – die Gestalt eines Mannes, die aller Aufmerksamkeit und Verehrung wert wäre, wenn sie sich dem heranwachsenden Mädchen nicht nur als betrachtbar, sondern auch als betastbar erzeigen wollte. Das, freilich, muß im Beisein der Englein für ganz undenkbar gelten. Alles Heilige überhöht und überwölbt hier überdeutlich die Sehnsucht nach einem Leben, das in seiner himmlischen Verklärung jede irdische Erfüllung ausschließt, und so erfüllt sich das Verlangen nach Liebe einzig im Verbotenen: Mit klopfendem Herzen öffnet das Kind schließlich auch die dreizehnte Tür, hinter der, wie es staunend und verzückt bemerkt, als Inhalt aller männlichen Verlockung die Dreifaltigkeit selber in ihrer Herrlichkeit thront. Verstohlen nur wagt das Mädchen an den Eingang dieser Tür zu rühren, da vergoldet sich sein Finger. Und fortan spaltet seine Seele sich in ein geheimes Wissen auf, das es bei den Verhören der Madonna sogar gegen das Indiz des sündhaft goldenen Fingers beharrlich verleugnen muß, und in eine nach außen verteidigte Unschuld, die es ermöglicht, dem Reinheitsideal der Madonna weiter zu genügen. Es ist zur Frau geworden, ohne doch Frau sein zu dürfen. Wohl, es wird, zur Strafe aus dem Himmel in die Welt verstoßen, an der Seite eines Königs zur Mutter, doch darf es nicht mit Mütterlichkeit auf die eigenen Kinder antworten, die es zur Welt gebiert; denn jedesmal tritt die Mutter Gottes dazwischen und stiehlt ihm eins nach dem andern fort. Erst als es als Hexe und als Menschenfresserin bei lebendigem Leibe verbrannt werden soll, bricht es zusammen und gesteht seine Schuld; und jetzt endlich auch erhört die Jungfrau und Mutter Maria seine Beichte und zögert nicht, ihm zu vergeben. Man versteht: wer seine Sünden reumütig bekennt, dem werden sie von der Mutter Gottes (und von der Mutter Kirche) gnädig nachgelassen … So soll das Märchen vom Marienkind bezeugen.
Was aber heißt da Gott? Und Gottesmutter? Und Dreifaltigkeit? Und was Apostel? Engel? Himmel? Die gesamte religiöse Sprache dient leicht durchschaubar nur dem Zweck, als heilig, göttlich und erhaben hinzustellen, was die ganz normale Entwicklung eines Mädchens zu seiner Weiblichkeit in etwas Sündhaftes und Widergöttliches erniedrigt. Das Madonnenideal kirchlich-katholischer Keuschheit erlaubt es nicht, die engelgleiche Unschuld eines Kindes, will sagen: seine sexuelle Unerfahrenheit, je zu verlassen, und wenn es doch geschieht, so einzig um den Preis der schwersten Schuldvorwürfe, Selbstanklagen, Strafgewärtigungen und Abspaltungen gerad der wärmsten und der innigsten Gefühle. »Gott« nennt sich in dem Märchen vom Marienkind die patriarchale Unterdrückung weiblicher Empfindsamkeit, die Triebrepression einer Kirche, deren Moral es gebietet, daß eine Frau sich dafür schuldig spricht, eine Frau zu sein. Eine solche Frömmigkeitshaltung zwingt zu ständiger Unaufrichtigkeit, Verdrängung und Verformung der intimsten und integersten Gestimmtheiten, sie zerreißt, was zusammengehört, sie zerstört, was sich entfalten möchte, sie vergiftet die an sich reinen Quellen des Lebens. Mit einem Wort: Was hier Gott heißt, ist der vollkommene Selbstwiderspruch des Göttlichen als Zwang zum Widerspruch einfacher Menschlichkeit. Ein Märchen? Ja! Jedoch ein Albtraum, wenn es psychologisch nicht gefiltert wird.
Uneingeschränkt gilt das für alle Märchen. Es ist naiv oder gedankenlos, das riesige Erzählmaterial der Märchen in den Überlieferungen der Völker gewissermaßen unter das methodische Veto zu stellen, sie sollten, ja, sie dürften psychologisch nicht durchleuchtet werden, nur um sich in die beruhigten Stuben eines ästhetischen Genießens oder einer philologisch möglichst korrekten Erstellung der Text- und Motivgeschichte der jeweiligen Märchenfassung zurückzuziehen. Die Faszination, die Märchen auf die Seele von Menschen zu allen Zeiten ausüben, trägt und erträgt wohl auch eine Unzahl philologischer und völkerkundlicher Traktate, doch all die so gelehrt erscheinenden Abhandlungen können den Märchen ihren urtümlichen Zauber, ihre anheimelnd-unheimliche Weiß- wie Schwarzmagie, nicht abhandeln. Was sie zu sagen haben, kommt einer betörenden Beschwörung guter wie böser Geister gleich, – es rührt, wie Traumbotschaften der vergangenen Nacht, ans Zentrum all der unbewußten Kräfte unserer Psyche, in denen sich die Phantasie und Poesie des Lebens, die kreativen und die krankhaften Seiten von Vorstellung und Daseinsdeutung geltend machen. Wer da sich weigert, sie zu deuten, sie durchzuarbeiten, sie in die Dichtung seiner eigenen Wirklichkeit umzuwandeln, verurteilt sich von selbst dazu, taub gegenüber den therapeutischen und tumb gegenüber den tragischen Seiten der Seele zu bleiben, von denen die Märchen Kunde geben.
Was hilft´s, religionsgeschichtlich darauf zu verweisen, daß mancherlei Rede von Gott oder Gnom, von Hulda oder Hexe im Märchen aus älteren Schichten »heidnischer« Frömmigkeitshaltungen herrührt? Gewiß, die Frau Holle der GRIMMschen Sammlung (KHM 24)2 verweist schon im Titel zurück auf die Göttin der Germanen, die Gerechtigkeit sprach auf den Thing-Plätzen: Frau Welt, so die Botschaft dieses Märchens, hält es stiefmütterlich stets mit den Falschen – den Fälschern, den Faulen, und man möchte schier an dem Gang der Geschichte verzweifeln, erlebt man doch nie, daß das Gute sich lohnt und das Böse sich straft, ganz im Gegenteil! Wie aber, man verzichtete gänzlich auf den Gedanken einer solchen Belohnungsgerechtigkeit und lernte es, nach dem »Brunnenabsturz«, nach einer dramatischen Vertiefung der gesamten Betrachtungsweise, das Gute nicht mehr im Schielen nach möglichen Erfolgen und Vergünstigungen zu tun, sondern einfach im Gehorsam gegenüber den Erfordernissen und Bedürfnissen der jeweiligen Situation? Man täte die Dinge, einfach weil sie dran sind? Man begönne, gehorsam zu werden dem schreienden Rufen von Menschen, Tieren und Gegebenheiten nach dem, was dringend erfordert ist? Dann würde man lernen, daß das Gute, das man um seiner selbst willen tut, seinen Lohn in sich selbst trägt; dann träte man, im Bilde des Märchens gesprochen, unter den Torbogen der »Frau Holle«, und es würde vergoldet, was solcherweise goldwert ist.
Nur wenn man sich bereit macht, dem Märchen der »Frau Holle« eine solche wesentliche Bedeutung für die Gestaltung des eigenen Lebens abzulauschen, vernimmt man etwas von dem vormals ausgesprochen religiösen Kern, der dieser Erzählung vom Ursprung her innewohnt. Vieles spricht dafür, daß in den Gestalten der »Goldmarie« und der »Pechmarie«, wie sie bei LUDWIG BECHSTEIN heißen3, sich gewisse Erinnerungen an die Herkunft von Sonne und Mond aufbewahrt haben; doch nicht dies ist das Göttliche, was in einer Weltentstehungsmythe einmal über die Natur der Himmelsgestirne des Tags und der Nacht erzählt worden sein mag, sondern was sich zur Antwort auf eine fundamentale Frage der Menschen allenthalben nach Recht und Unrecht, nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, nach Gut und Böse auszuformen weiß. Nicht wie es der Sonne (scheinbar) im Umlauf des Jahres ergeht – wenn sie im Winter der »Frau Holle« die Betten ausschlägt, daß es auf Erden zu schneien beginnt, oder wenn sie im Sommer das Brot aus der Hitze des Backofens zieht und im Herbst die Apfelbäume von der Last ihrer Früchte befreit –, verdient »göttlich« genannt zu werden; was einmal Naturmythologie war, hat sich als solche erledigt und ist schon deshalb auf das Niveau eines bloßen Märchens herabgesunken; doch was es an Weisheit zur Deutung des menschlichen Lebens besitzt, geht mit dem Ende einer alten Religionsform nicht verloren, sondern bewahrt seine Bedeutung im Gegenteil uneingeschränkt in seiner Menschlichkeit.
Auf ihre Menschlichkeit hin also muß man die Märchen befragen, will man wissen, was wahrhaft Göttliches in ihnen redet. Daß sie selber von Gott und von göttlichen Mächten erzählen, ist, wie man sieht, nichts als ein Anlaß, näher nachzuschaun. Was macht es mit den Menschen, wenn sie einer solchen Geschichte zu folgen beginnen? Welche Gefühle und Eindrücke erzeugt sie im Raume des Religiösen, wenn da die Rede geht von Gott und von göttlichen Mächten? So viel steht fest: was nicht der Befreiung des Menschen zu Vertrauen und Liebe dient, sondern was ihn verschüchtert oder verschreckt und vom Leben geradezu abhält, das trägt nicht Gott, sondern meint dessen Gegenteil.
Also: den Teufel? – Auch da heißt es Obacht zu geben!
Einzig die kirchliche Dogmatik Roms gebietet nach wie vor zu glauben, daß es den Teufel realiter gebe als das Böse in persönlicher Gestalt.4 Die kanaanäische Mythe vom Morgenstern, der aus Stolz ob seiner Schönheit sich vermaß, die Sonne überstrahlen zu wollen, und der seither Morgen für Morgen zur Strafe ins Dunkel verbannt wird, bildet kulturhistorisch den Hintergrund derartiger Lehren, die metaphysisch objektivieren, was allenfalls Sinn machen kann, wenn man es als eine symbolische Darstellung seelischer Auseinandersetzungen und Befindlichkeiten im Herzen des Menschen deutet.5 Der Unterschied ist absolut: Gott als Person muß es geben, damit ein Bezugspunkt sei, um die Widersprüchlichkeiten des menschlichen Daseins jenseits der Angst in Vertrauen zu ordnen; doch einen Teufel zu glauben führt in die Irre. Es kommt vielmehr entscheidend darauf an, die vermeintliche Widersprüchlichkeit von Gott und Teufel – entsprechend der persischen Mythologie von dem ewigen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen6 – gerade nicht in Gott zu verewigen, sondern sie in den Innenraum der menschlichen Psyche zurückzuholen; erst wenn die Vorstellungen von Teufel und Hölle als Projektionen von Abhängigkeit und Angst beziehungsweise von Verlorenheit und Verzweiflung als Formen der Selbstwahrnehmung bewußt gemacht werden, lassen sich ihre Inhalte in den Prozeß der Selbstfindung integrieren. Wo nicht, droht die Gestalt des »Teufels« die alten abergläubischen Reste vergangener Zeiten wiederzubeleben und macht in jedem Falle Gefahr, das Ich seine vielleicht schon überwunden geglaubte Ohnmacht aus Kindertagen gegenüber den Elterngestalten von Vater und Mutter erneut als eine unüberschreitbare Tatsache spüren zu lassen.
Da tritt etwa in dem Märchen von dem Bärenhäuter (KHM 101)7 der Teufel an einen dienstentlassenen Soldaten heran, der nicht mehr weiß, wovon er leben soll, und schließt mit ihm einen Sieben-Jahres-Vertrag auf den Besitz seiner Seele: er kann in seiner Not so viel Geld aus der Tasche holen, wie immer er mag, doch muß er dafür auf jegliche Reinlichkeitspflege verzichten und darf in all der Zeit kein Vaterunser beten; bleibt er am Leben, so gehört er sich selbst, stirbt er vor Ablauf dieser Frist, ist seine Seele dem Teufel verfallen; als Kleidung tragen muß er dessen grünen Rock, und als sein Nachtlager hat ihm das Fell eines soeben zur Mutprobe erlegten Bären zu dienen. – In all dem erlebt der Soldat im Grunde nur noch, was für ein Barbar aus ihm als »Bärenhäuter«, als Berserker, im Kriegsdienst geworden ist; er gehorchte als Söldner bereits dem »Teufel«, ohne es zu wissen, und er kann sich von dessen Einfluß nur lösen, indem er Mitleid mit der Mittellosigkeit anderer übt und auf diese Weise nachreift zur Liebe.
Die Gestalt, die in diesem Märchen im Sturmgebraus und mit Pferdefuß als Teufel ihm entgegentritt, trägt erkennbar die Züge des germanischen Kriegsgottes Wotan, des Herrn der Einherier, der Helden, die er, wenn sie auf der Walstatt gefallen sind, zu sich nach Walhall holt. Derlei Vorstellungen von männlicher Kriegsbereitschaft und Tapferkeit galten vormals als göttlich, nunmehr aber fungieren sie nur noch als Chiffre seelischer Entfremdung; sie prägen das Bild einer Teufelei, die jener Soldat verinnerlichen mußte, als man ihn aus einem sensiblen Menschen in ein wildes Tier auf den Schlachtfeldern seines Königs umwandelte; das ehedem Ehrwürdige erweist sich für ihn jetzt als eine schwere Hypothek, die erst nach jahrelangem Suchen sich überwinden lassen wird. – Als teuflisch und dämonisch erscheint in diesem Märchen mithin der Geist des Militärs selber, der Menschen auf Befehl zu Mördern macht; doch eben: wer sich mit der ihm auferlegten seelischen Verformung ehrlich auseinandersetzt, kann sich nicht länger hinter einem Glaubenssatz verschanzen, nach dem es einen Teufel gebe, der als ein Wesen an sich selbst die Schuld an der Verwandlung des menschlichen Lebens in eine Hölle auf Erden trüge; der muß die Ursachen des Unheils in sich selber suchen.
Manches von alledem, was einem Menschen wie verhext und wie verteufelt scheinen mag, erweist in psychologischer Betrachtung sich als das Schattenbild der eigenen Eltern. In dem Märchen von dem Mädchen ohne Hände (KhM 31)8 beispielsweise verspricht der Teufel einem armen Müller großen Reichtum, wofern er ihm vermacht, was hinter seinem Haus im Garten steht; der Müller glaubt, das sei sein Apfelbaum, und geht leichthin auf das so verlockende Angebot ein; doch was der Teufel meint, ist nicht der Baum, sondern des Müllers Tochter. Als er indes nach drei Jahren seinen hinterhältigen Vertrag einzulösen gedenkt, bleibt das Mädchen für ihn in einem Schutzkreis aus Kreide unerreichbar, und unter der Drohung, sonst selber vom Teufel entführt zu werden, muß der Vater seiner Tochter schließlich die durch das viele Weinen ganz rein gewordenen Hände abhacken; aber auch die Tränen, die das Mädchen auf die Handstümpfe weint, waschen es rein und bewahren es somit davor, in die Hände des Bösen zu geraten. – »Nur wenn ich keine Hände zur Erfüllung eigener Wünsche mehr besitze, kann ich den Händen des Teufels entkommen. Nur im Verzicht auf jegliches Bedürfnis bewahre ich meinen Vater davor, daß der Teufel mit ihm durchgeht. Nur in der Traurigkeit ständiger Selbsteinschränkung bin ich ein gutes Kind.« So lautet die Lektion, die dieses »Mädchen ohne Hände« in Kindertagen bereits zu lernen hatte.
Der »Teufel« – das ist in dieser Geschichte erkennbar kein gefallener Engel, der, aus dem Himmel verstoßen, auf Erden versuchen würde, seinen Kampf gegen Gott in den Herzen der Menschen fortzusetzen: das ist als erstes die persönliche Gefährdung verzweifelten Jähzorns im Gemüt und Gebaren des Vaters, falls seine Tochter ohne Rücksicht auf die offenbare Armut der Familie ihn weiterhin mit Worten wie »ich hätte aber gern«, »ich möchte doch so sehr«, »warum bekomme ich nicht auch« auf die Nerven gehen sollte. Die Widersprüchlichkeit des Vaters zwischen Fürsorge und Überforderung, zwischen Verantwortung und Zerstörung, zwischen Hilflosigkeit und Haß ist es, was seinem Kinde als der »Teufel« selbst vorkommen muß, – es kann den »guten« Vater in ihm nur noch retten durch Verdrängung der gesamten kindlichen Wunschwelt.
Daß ein solches Mädchen es überhaupt vermag, sich in die Welt zu getrauen, liegt laut Märchen einzig an der Erwartung, daß mitleidige Menschen ihm schon von selber geben würden, was es braucht. In dieser Zuversicht setzt allem Anschein nach sich das Erinnerungsbild der Mutter fort, die zwar nicht imstande war, die notbedingten Grausamkeiten ihres Mannes zu verhindern, die dem Kinde aber dennoch ein unerschütterliches Vertrauen, gemocht zu werden und beschützt zu sein, mit auf den Lebensweg zu geben vermag.
Auch diese mütterliche Seite im Erleben des Kindes wird in dem Märchen von dem Mädchen ohne Hände in die Sphäre des Göttlichen emporgehoben: Ein Engel kommt und weist am Ende eines langen Tags der Wanderung die Liebesuchende in den Garten eines Königs; in diesem wächst ein Birnbaum, dessen Früchte allesamt gezählt sind; gleichwohl wagt das Mädchen es in seinem Hunger, mit dem Munde eine der Birnen zu sich zu nehmen, – die Geschichte vom »Sündenfall« in Gen 3,1–7 erzählt sich noch einmal9, nur in entgegengesetzter Richtung, mit dem Ziel, das urtümliche Schuldgefühl, durch (ein verbotenes) Essen schuldig (geworden) zu sein, endgültig zu widerlegen: Der König dieses Gartens verstößt die arme Müllerstochter nicht, im Gegenteil, er gewinnt sie lieb und erhebt sie zu seiner Gemahlin. – Ein Engel Gottes, der hineingeleitet in die verlorene Unschuld der Kindheit, der lehrt, sich seiner Daseinsberechtigung zu getrauen, der zu dem »Ort« hinführt, an dem geschrieben steht: »Hier wohnt ein jeder frei«, – auch solch ein »Engel« muß nicht dogmatisch als ein Wesen an sich selbst genommen werden, als ein »geschaffener Geist«, der – im Gegensatz zum Teufel – Gott dienstbar geblieben wäre; in ihm verkörpert sich vielmehr all die Bejahung und Bestätigung, die dieses Kind von seiten seiner Mutter in die Seele gelegt bekommen hat: es darf sein, es soll leben, es ist mit seinem Dasein gewollt, ersehnt, erwünscht, – es hat ein Recht auf seine eigenen Hände, die ihm am Ende des Märchens wunderbarerweise wieder wachsen …
An einer Stelle wie dieser wird der absolute Unterschied deutlich, der bei der Interpretation von Märchen (und gleichermaßen auch der Bibel oder der kirchlichen Dogmatik) zu beachten ist: Wann immer bestimmte Erscheinungen mit dem Wirken böser Geister erklärt werden sollen, kommt es psychologisch darauf an, die Vorstellung von einem »Teufel« auf die Erfahrungen von Angst, Hilflosigkeit und Schuldgefühl in der frühen Kindheit – idealtypisch gegenüber dem eigenen Vater – zurückzuführen und ihnen damit den Anschein des »Objektiven« und »Absoluten« zu nehmen; was sich aus der psychischen Entwicklung eines Menschen ergibt, ist notwendig relativ, es ist gebunden an die Besonderheiten eben dieses Werdegangs. Anders bei den Vorstellungen »guter Geister«. Auch sie ergeben sich aus den Erfahrungen eines Kindes – vornehmlich mit seiner Mutter –, auch sie sind schon von daher nicht als an sich »wahr« zu nehmen; doch was sie dem Menschen zu sagen haben, ist absolut als wahr zu setzen; ja, man muß es ins Göttliche überhöhen, weil sich darin etwas mitteilt, das in dieser Unbedingtheit die liebste Mutter der Welt ihrem liebsten Kinde nicht zu vermitteln vermag: die Überzeugung von der unwiderruflichen Bejahung seines Daseins; das Gefühl einer letztgültigen Geborgenheit in seiner Existenz; die Festigkeit des Vertrauens, begleitet und umfangen zu sein, gleich, was geschehen wird. Der schlimmste »Teufel« kann nichts weiter sein als ein Ausbund alter Kinderängste und deren Folgewirkungen; ein »Engel« aber ist nie nur ein spätes Abbild von erfahrener oder zumindest doch ersehnter mütterlicher Güte, er ist vielmehr ein Fenster ins Unendliche: Gefangen in den Widersprüchen und Ambivalenzen aller Eindrücke inmitten dieser endlichen Welt, öffnet sich in der Erscheinung eines Engels die Kerkerwand der irdischen Gefangenschaft und gibt den Blick frei auf den Hintergrund, aus dem wir leben, und auf das Ziel hin, für das wir geschaffen sind.
In solchen Augenblicken bringen Märchen wirklich etwas Göttliches zur Sprache – nie schon Gott selber, wohlgemerkt, wohl aber doch so etwas wie einen Hinweis auf die Stelle einer stimmigen Vorstellung von Gott. Beide: Teufel wie Engel, sind Bilder der menschlichen Seele, doch während das eine Bild das Licht nicht durchläßt, das ins Innere der Seele leuchten möchte, erweist das andere sich als gerade für den Zweck geschaffen, sich durchsichtig zu halten auf die Sonne hin; in jedem Falle sind es deren Strahlen, die dieses Bild dem Auge sichtbar machen. – Im Mädchen ohne Hände wird das Vaterbild des »Teufels« sich sogar noch in die Beziehung der Müllerstochter zu ihrem »König« drängen und per Übertragung dafür sorgen, daß jedes Wort der Bestätigung und Ermutigung zwischen den beiden sich anhört wie Unglück und wie Fluch, – wie schwer ist es, Liebe zu glauben, wenn das Wiederaufleben alter Wünsche einhergeht mit dem Wiederaufflackern alter Verbote! Ob er es will oder nicht, der »König« zieht von vornherein die Hoffnungen ebenso wie die Befürchtungen auf sich, die in den Kindertagen seiner Königin einmal dem eigenen Vater gegolten haben. Um diesem Teufelskreis von Abhängigkeit und Lebensangst zu entkommen und eigenhändig und eigenständig zu werden, muß in der Gestalt des Engels all die positive Erwartung und Erfahrung weitergehen, die sich einst mit der Mutter verband, und erst wenn es sich als eine Wesensaussage über die Grundlage unseres Daseins von allem nur Psychologischen freisetzt ins Grundsätzliche, ins Religiöse, gewinnt das Bild dieses Engels die Fähigkeit, Freiheit zu schenken. Erst dann redet das Märchen wirklich von Gott.
Schaut man sich in der GRIMMschen Sammlung um, in welchen Geschichten Göttliches vergleichbar »rein« zur Sprache kommt und was sich über Gott von solchen Märchen lernen läßt, so muß man stets vor Augen haben, daß schon der Gattung nach die Märchen weder Mythen noch Legenden sind. Um überhaupt von Gottes »Handeln« in der »Welt« Kunde zu geben, ist die Darstellung des Mythos unverzichtbar, – er ist nur zu verstehen, wenn man die scheinbare Vergegenständlichung des Göttlichen gerade nicht dogmatisch »wörtlich« nimmt, sondern als die Symboldarstellung seelischer Erfahrung in ihrer hochpoetischen Verdichtung innerlich versteht10; die Legende verknüpft das Handeln Gottes mit vermeintlich historischen Persönlichkeiten, deren fromme Ergriffenheit durch Gott jedwedes wunderbare Eingreifen Gottes in ihrem Schicksal als wahre Begebenheit dartun soll, – auch hier ist zum rechten Verständnis alles Äußere als Bild des Inneren zu lesen11: nicht daß Franziskus zu den Fischen predigt12, ist das Wunder, ganz wunderbar ist vielmehr die Einheit allen Lebens auf der Erde, betrachtet man‹s mit Gottes Augen, der die Liebe ist. Märchen sind demgegenüber bereits gattungsgeschichtlich rein profane Erzählungen13, – es ist ein Mißbrauch, sie, wie mit Marienkind geschehen, für konfessionspolitische Propaganda zu vernutzen. Andererseits besitzen Märchen – gerade wegen ihrer entsakralisierten Denk- und Darstellungsweise – ein Merkmal, das literaturwissenschaftlich keine Rolle zu spielen scheint, während es menschlich doch das Wesen vornehmlich aller »Zaubermärchen« ausmacht: sie weigern sich, von einem transzendenten Glück der Liebe in klösterlicher Entsagung oder himmlischer Tröstung zu träumen; statt dessen versprechen und beschwören sie die Möglichkeit, es möchten hier auf Erden trotz aller Widerstände und Gefahren die Liebenden doch zur Erfüllung ihrer Wünsche finden.
Und eben dieser Glaube an die Liebe als an die einzige und wahre Quelle allen Glücks macht in gewisser Weise gerad die so profanen Märchen zu einem quasi religiösen Zeugnis: Wenn es denn stimmt, daß Gott die Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,16), so sprechen mittelbar die Märchen, wie keine andere Gattung der Weltliteratur sonst, von Gott, und alle Wunder, die sie auf der Suche der Liebenden zu ihrer wechselseitigen Erlösung schildern, dienen nur dem Ausdruck dieser einen grundlegenden Überzeugung, an der, wenn man sie glaubt, die ganze Welt sich ändert und die da heißt: Gott schützt die Liebenden14. Wer in der Weise von der Liebe spricht, der spricht von Gott, selbst wenn er nominell ihn nicht im Munde führt, und umgekehrt kann gelten, daß überall, wo lieblos über Göttliches geredet wird, im Grunde eine Gotteslästerung geschieht.
Wie aber steht es dann mit all den Märchen, die, zum Teil in Übernahme alter mythischer Motive, Gott selbst auftreten lassen – inkognito, Menschengestalt annehmend? Den Göttern HOMERs fiel derlei augenscheinlich leicht: Wann immer in der Odyssee Athene ihrem Schützling helfen will, kann sie, wie gleich zu Anfang, in der Gestalt des Taphier-Fürsten Mentes den Sohn des Odysseus, Telemachos, auffordern, in Pylos bei dem alten Nestor und in Sparta bei Menelaos sich nach dem Verbleib seines Vaters zu erkundigen15, oder sie kann Odysseus selbst, nachdem die Phäaken ihn in Ithaka abgesetzt haben, in der Gestalt eines Schafhirten erscheinen16; ebensowenig stellt es für sie eine Schwierigkeit dar, die Gestalt einer »schönen und großen« Frau anzunehmen, die freilich nur für Odysseus und dessen Hunde sichtbar ist17: – »Denn die Götter sind keineswegs für alle erkennbar«, wie es bedeutungsschwer heißt18. Doch damit stellt sich im homerischen Mythos nicht anders als in den Märchen die Frage, wie um alles in der Welt man denn (einen) Gott in der Gestalt eines Menschen erkennt.
Die einfachste Antwort könnte lauten, man erkenne, wie in den angegebenen Beispielen der »göttliche Dulder« Odysseus, Göttliches als Wegweiser und Retter in Augenblicken äußerster Ratlosigkeit und lebensgefährlicher Not, – wer da als Helfer sich meldet, trägt etwas in sich, bringt etwas mit sich von Gott. Das stimmt; und doch betrachtete man in dieser Perspektive die Welt gewissermaßen ganz mit den Augen des »Mädchens ohne Hände«: was da von Gott her in Erscheinung träte, trüge die Züge eines Engels (oder halt einer »Athene«), es gelangte aber nicht darüber hinaus, so daß man die in den Mythen und Märchen weit seltenere, aber nicht minder wichtige umgekehrte Blickrichtung leicht aus den Augen verlöre: daß Gott auch in der Gestalt eines Menschen erscheinen kann, nicht um Hilfe zu schenken, sondern sich schenken zu lassen. Wäre es möglich, daß Göttliches aufschiene nicht nur in seinem Reichtum, sondern gleichermaßen auch in der Armut von Menschen – als eine Anfrage an unsere Menschlichkeit? Dann ginge die Rede von Gott, um Göttliches erkennbar zu machen in allem Bedürftigen, und es wäre nicht mehr Gott selber, der als Beistand herzuträte, sondern von der Gestalt des Bedürftigen ginge die Frage aus, ob man darinnen Gott wiedererkennt und sich selber zur Hilfe hin auftut.
Der Bedürftige: das kann – bevorzugt unter all denen, die Jesu Gleichnis vom Großen Weltgericht (Mt 25,31–46) aufzählt19 – auch sein der Bettler oder der Fremde, und so ist es kein Wunder, daß in der Sammlung der Brüder GRIMM sich gerade eine solche Geschichte von einem Armen und Fremden als Gottesgestalt findet – unter dem Titel: Der Arme und der Reiche (KHM 87). Die eigentliche Trennung unter den Menschen, meint dieses Märchen, verläuft nicht zwischen den Armen und den Reichen, wohl aber zwischen den Hilfsbereiten und den Berechnenden, und es zeigt sich, daß gerade die Armen eher über die Fähigkeit des Erbarmens verfügen als all diejenigen, die gar nicht wissen, was Not ist. Nur wer erfahren hat, was sozial und psychisch Leid und Elend bedeuten, wird wie von selbst befähigt sein zu Mitleid und zu Gastlichkeit. Und nur ein solcher, der Gott entdeckt in der Armut von Menschen, wird zu Gott finden. Man kann über Gott vielerlei Worte drechseln, doch entscheidend vor Gott ist, was jemand tut.
Die wohl am meisten bedrückende Form der Armut ist indessen die Armseligkeit menschlicher Schuld; und gerade hier herrscht erstaunlicherweise die schlimmste Verwirrung. Der wahre Glaubenssatz des bürgerlichen Zusammenlebens nämlich ist kein wirklich christlich-religiöser, sondern ein durch und durch ethischer; er besagt, daß Menschen gut sind, wenn und weil sie gut sein wollen, und daß sie böse sind, wenn und weil sie böse sein wollen; in dem einen Falle verdienen sie belohnt, in dem anderen Falle bestraft zu werden. So will es die Gerechtigkeit. Und so, aus Gründen der Gerechtigkeit, verläuft eine kategorische Trennlinie nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern jetzt vor allem zwischen den Guten und den Bösen, zwischen den Belohnenswerten und den Strafenswerten. In aller Regel wird diese Vorstellung sogar ins Absolute gesteigert, indem die institutionalisierten Religionsformen sich am Ort staatstragend geben und Gott selber zum Inbegriff eben einer solchen Strafegerechtigkeit erklären. Doch in Wahrheit tut man damit Gott ebenso Unrecht wie man sich weigert, Menschen in ihrer Not gerecht zu werden. – In dieser Lage ist es überaus begrüßenswert, in der Sammlung der BRÜDER GRIMM einem Märchen zu begegnen, das der Einstellung der Bergpredigt, überhaupt nicht über Menschen zu Gericht zu sitzen (Mt 7,1–5)20, in seiner Kernaussage äußerst nahe kommt: der Geschichte von dem Schneider im Himmel (KHM 35). Wenn es irgend eine Erzählung gibt, die in der Form einer märchenhaften Parabel Gott – christlich betrachtet – »wahr« zur Sprache bringt, so ist es diese Geschichte, die zudem den Vorteil hat, die unheilvolle Tragödie der Strafegerechtigkeit in Ethik und Justiz auf humorvolle Weise als Komödie zu konterkarieren. Gerade der zwangsneurotisch-sadistische Ernst aller streng sich gebenden Moral löst sich hier auf in ein befreiendes Gelächter. – Eine solche Geschichte gehört schon deshalb unbedingt in eine Darstellung des Themas »Gott im Märchen«, vergleichbar ein Stück weit der plattdeutschen Erzählung von dem Mäken von Brakel (KHM 139)21, das die gesamte »Marienkind«-Moral auf den Kopf stellt.
Und auch wohl eine dritte Geschichte gehört hierher, die derart »fromm« ist, daß man psychologisch gewiß die größten Zweifel an sie setzen müßte, verstünde man sie lediglich als Wunder-Märchen, statt ein Gleichnis auf uns selbst darin zu sehen, – das ist die Geschichte vom Sterntaler-Mädchen (KHM 153). Als »Ideal«, widerstandslos alles herzugeben, könnte sie psychoanalytisch nur als ein Ausdruck schwerster »retentiver Gehemmtheiten«22 gelesen werden; doch als eine Beispielserzählung für die Art, wie es dann doch – entsprechend dem Frau Holle-Märchen – eine »Belohnung« des Guten durch sich selber gibt, ist die Geschichte »typisch« religiös: sie zeigt etwas von Gottes Art zu »richten«.
Nun bedarf allerdings das moralisch scheinbar so geordnete Weltbild des braven Bürgers nicht nur in der Vorstellung einer rein äußerlich – von einem Richter oder gar von Gott – verhängten Strafegerechtigkeit einer heilsamen Erschütterung durch eine Darstellung, die, gerade als eine religiöse, »märchenhaft« sein muß, um den »Realismus« einer bloßen Oberflächenbetrachtung durch eine psychologisch wie existentiell vertiefte Sicht auf den Menschen prinzipiell neu zu formen; es existiert in der Erzählgattung der Märchen vielmehr darüber hinaus ein uraltes Wissen um eine Wahrheit, die gerade in der »christlich« sich gebenden Ethik so gut wie ganz verlorengegangen zu sein scheint, – das ist die tiefe Einheit von Mensch und Tier und damit das Ende der biblisch begründeten Anthropozentrik des abendländischen Weltbildes. »Tiere haben keine Rechte, schon deshalb weil sie keine Pflichten haben«, erklärte vor einer Weile ein österreichischer Weihbischof, um den traditionellen Standpunkt seiner Kirche zu verteidigen23; »Verantwortung« soll da etwas sein, das allein von Menschen für Menschen in Geltung steht. »Gut« ist in dieser Überzeugung alles, was dem Überleben der menschlichen Spezies dient, »böse« alles, was dem Artegoismus Abbruch tut. Wie aber, wenn Menschen begönnen, sich nicht länger als die Herren der Schöpfung zu gebärden, wie es die Bibel in ihrem ersten Schöpfungsbericht in Auftrag gibt (vgl. Gen 1,28; 9,1.2), sondern wenn sie sich, entsprechend der jahwistischen Paradieserzählung in Gen 2,1524, als »Diener« und »Bewahrer« im »Garten« der Welt zu begreifen anfingen? Kaum etwas von der Art und Weise des üblichen Umgangs mit den Tieren behielte dann noch seine Legitimität, – es wäre als gedankenlose Grausamkeit, getarnt als praktische Vernunft, erkennbar. – Ein Märchen, das über die Kraft verfügt, einen solchen Umsturz des Bewußtseins einzuleiten, ist die Geschichte von den Drei Sprachen (KHM 33). Sie spricht von Gott, indem sie ironischerweise jemanden zum »Papst« krönt, der imstande ist, den stummen Schrei gequälter Kreaturen zu vernehmen und sein Verhalten danach zu verändern. Auch diese Geschichte ist deshalb unverzichtbar in einem Bändchen über »Gott im Märchen«.
Eine psychologisch-religiöse Märchendeutung bliebe ein müßig Unterfangen, wenn beim Leser wieder nur der Eindruck sich verstärkte, daß Geschichten dieser Art etwas an sich Schwerverständliches darstellten, das sich nur den »Fachleuten« erschließen könnte; das Gegenteil ist richtig. Es gab einmal eine Zeit, in der wir Märchen noch als unsere eigene Sprache begreifen konnten, – als wir Kinder waren. Mitgefühl mit Mitgeschöpfen – jedem Kind und allen Kindern der Natur ist diese Haltung selbstverständlich, nur uns nicht, die wir auf »zivilisierte« Weise »erwachsen« werden mußten. Insofern möchten die vorgelegten Interpretationen nicht nur eine neue Unmittelbarkeit im Verständnis der Märchen vermitteln, sondern zugleich dabei helfen, ein Stück verlorener Kindlichkeit und verlorengegangener Kindheit zurückzuschenken.
Der Arme und der Reiche (KHM 87) oder: Vom gastfreundlichen Geben
»Antinoos! das war nicht recht, daß du nach dem armen Herumstreicher geworfen hast! Unseliger! wenn er nun vielleicht irgendein Gott vom Himmel ist! Durchwandern die Götter doch, Fremdlingen gleichend, die von weit her sind, in mancherlei Gestalt die Städte und blicken auf den Frevel der Menschen und ihr Wohlverhalten.«25 Sogar die »hochmütigen jungen« Männer, die im Hause des Odysseus um dessen Frau Penelope freien, besitzen bei HOMER im 8. Jh. v. Chr. so viel religiöses Empfinden, daß sie die Mißhandlung eines fremden Bettlers als Frevel empfinden, – es könnte ein Gott sein, der in seiner Gestalt sich verbirgt! – Das Motiv der Geschichte Der Reiche und der Arme ist uralt; bei den BRÜDERN GRIMM erzählt sie sich so:
Vor alten Zeiten, als der liebe Gott noch selber auf Erden unter den Menschen wandelte, trug es sich zu, daß er eines Abends müde war und ihn die Nacht überfiel, bevor er zu einer Herberge kommen konnte. Nun standen auf dem Weg vor ihm zwei Häuser einander gegenüber, das eine groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen, und gehörte das große einem Reichen, das kleine einem armen Manne. Da dachte unser Herrgott: »Dem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen: bei ihm will ich übernachten.« Der Reiche, als er an seine Türe klopfen hörte, machte das Fenster auf und fragte den Fremdling, was er suche. Der Herr antwortete: »Ich bitte um ein Nachtlager.« Der Reiche guckte den Wandersmann von Haupt bis zu den Füßen an, und weil der liebe Gott schlichte Kleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopf und sprach: »Ich kann Euch nicht aufnehmen, meine Kammern liegen voll Kräuter und Samen, und sollte ich einen jeden beherbergen, der an meine Türe klopft, so könnte ich selber den Bettelstab in die Hand nehmen. Sucht Euch anderswo ein Auskommen.« Schlug damit sein Fenster zu und ließ den lieben Gott stehen. Also kehrte ihm der liebe Gott den Rücken und ging hinüber zu dem kleinen Haus. Kaum hatte er angeklopft, so klinkte der Arme schon sein Türchen auf und bat den Wandersmann einzutreten. »Bleibt die Nacht über bei mir«, sagte er, »es ist schon finster, und heute könnt Ihr doch nicht weiterkommen.« Das gefiel dem lieben Gott, und er trat zu ihm ein. Die Frau des Armen reichte ihm die Hand, hieß ihn willkommen und sagte, er möchte sich‹s bequem machen und vorliebnehmen, sie hätten nicht viel, aber was es wäre, gäben sie von Herzen gerne. Dann setzte sie Kartoffeln ans Feuer, und derweil sie kochten, melkte sie ihre Ziege, damit sie ein wenig Milch dazu hätten. Und als der Tisch gedeckt war, setzte sich der liebe Gott nieder und aß mit ihnen, und schmeckte ihm die schlechte Kost gut, denn es waren vergnügte Gesichter dabei. Nachdem sie gegessen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich ihren Mann und sprach: »Hör, lieber Mann, wir wollen uns heute nacht eine Streu machen, damit der arme Wanderer sich in unser Bett legen und ausruhen kann: er ist den ganzen Tag über gegangen, da wird einer müde.« »Von Herzen gern«, antwortete er, »ich will‹s ihm anbieten«, ging zu dem lieben Gott und bat ihn, wenn‹s ihm recht wäre, möchte er sich in ihr Bett legen und seine Glieder ordentlich ausruhen. Der liebe Gott wollte den beiden Alten ihr Lager nicht nehmen, aber sie ließen nicht ab, bis er es endlich tat und sich in ihr Bett legte; sich selbst aber machten sie eine Streu auf der Erde. Am andern Morgen standen sie vor Tag schon auf und kochten dem Gast ein Frühstück, so gut sie es hatten. Als nun die Sonne durchs Fensterlein schien und der liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Als er in der Türe stand, kehrte er sich um und sprach: »Weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich euch erfüllen.« Da sagte der Arme: »Was soll ich mir sonst wünschen als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, solang wir leben, gesund bleiben und unser notdürftiges tägliches Brot haben; fürs dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.« Der liebe Gott sprach: »Willst du dir nicht ein neues Haus für das alte wünschen?« »O ja«, sagte der Mann, »wenn ich das auch noch erhalten kann, so wär mir‹s wohl lieb.« Da erfüllte der Herr ihre Wünsche, verwandelte ihr altes Haus in ein neues, gab ihnen nochmals seinen Segen und zog weiter.
Es war schon voller Tag, als der Reiche aufstand. Er legte sich ins Fenster und sah gegenüber ein neues, reinliches Haus mit roten Ziegeln, wo sonst eine alte Hütte gestanden hatte. Da machte er große Augen, rief seine Frau herbei und sprach: »Sag mir, was geschehen ist? Gestern abend stand noch die alte, elende Hütte, und heute steht da ein schönes neues Haus. Lauf hinüber und höre, wie das gekommen ist.« Die Frau ging und fragte den Armen aus; er erzählte ihr: »Gestern abend kam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge, und heute morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt, die ewige Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das notdürftige tägliche Brot dazu und zuletzt noch statt unserer Hütte ein schönes neues Haus.« Die Frau des Reichen lief eilig zurück und erzählte ihrem Mann, wie alles gekommen war. Der Mann sprach: »Ich möchte mich zerreißen und zerschlagen: hätt ich das nur gewußt! Der Fremde ist zuvor hier gewesen und hat bei uns übernachten wollen, ich habe ihn aber abgewiesen.« »Eil dich«, sprach die Frau, »und setze dich auf dein Pferd, so kannst du den Mann noch einholen, und dann muß du dir auch drei Wünsche gewähren lassen.«
Der Reiche befolgte den guten Rat, jagte mit seinem Pferd davon und holte den lieben Gott noch ein. Er redete fein und lieblich und bat, er möchte‹s nicht übelnehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur Haustüre gesucht, derweil wäre er weggegangen; wenn er des Weges zurückkäme, müßte er bei ihm einkehren. »Ja«, sprach der liebe Gott, »wenn ich einmal zurückkomme, will ich es tun.« Da fragte der Reiche, ob er nicht auch drei Wünsche tun dürfte wie sein Nachbar. Ja, sagte der liebe Gott, das dürfte er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche meinte, er wollte sich schon etwas aussuchen, das zu seinem Glück gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfüllt würde. Sprach der liebe Gott: »Reit heim, und drei Wünsche, die du tust, die sollen in Erfüllung gehen.«
Nun hatte der Reiche, was er verlangte, ritt heimwärts und fing an nachzusinnen, was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel fallen ließ, fing das Pferd an zu springen, so daß er immerfort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar nicht zusammenbringen konnte. Er klopfte ihm an den Hals und sagte: »Sei ruhig, Liese«, aber das Pferd machte aufs neue Männerchen. Da ward er zuletzt ärgerlich und rief ganz ungeduldig: »So wollt ich, daß du den Hals zerbrächst!« Wie er das Wort ausgesprochen hatte, plump, fiel er auf die Erde und lag das Pferd tot und regte sich nicht mehr; damit war der erste Wunsch erfüllt. Weil er aber von Natur geizig war, wollte er das Sattelzeug nicht im Stich lassen, schnitt’s ab, hing’s auf seinen Rücken und mußte nun zu Fuß gehen. »Du hast noch zwei Wünsche übrig«, dachte er und tröstete sich damit. Wie er nun langsam durch den Sand dahinging und zu Mittag die Sonne heiß brannte, ward’s ihm so warm und verdrießlich zumut: der Sattel drückte ihn auf den Rücken, und war ihm noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. »Wenn ich mir auch alle Reiche und Schätze der Welt wünsche«, sprach er zu sich selbst, »so fällt mir hernach noch allerlei ein, dieses und jenes, das weiß ich im voraus: ich will’s aber so einrichten, daß mir gar nichts mehr übrig zu wünschen bleibt.« Dann seufzte er und sprach: »Ja, wenn ich der bayrische Bauer wäre, der auch drei Wünsche frei hatte, der wußte sich zu helfen, der wünschte sich zuerst recht viel Bier und zweitens so viel Bier, als er trinken könnte, und drittens noch ein Faß Bier dazu.« Manchmal meinte er, jetzt hätte er es gefunden, aber hernach schien’s ihm doch zu wenig. Da kam ihm so in die Gedanken, was es seine Frau jetzt gut hätte, die säße daheim in einer kühlen Stube und ließe sich’s wohl schmecken. Das ärgerte ihn ordentlich, und ohne daß er’s wußte, sprach er so hin: »Ich wollte, die säße auf dem Sattel und könnte nicht herunter, statt daß ich ihn da auf meinem Rücken schleppe.« Und wie das letzte Wort aus seinem Munde kam, so war der Sattel von seinem Rücken verschwunden, und er merkte, daß sein zweiter Wunsch auch in Erfüllung gegangen war. Da ward ihm erst recht heiß, er fing an zu laufen und wollte sich daheim ganz einsam in seine Kammer hinsetzen und auf etwas Großes für den letzten Wunsch sinnen. Wie er aber ankommt und die Stubentür aufmacht, sitzt da seine Frau mittendrin auf dem Sattel und kann nicht herunter, jammert und schreit. Da sprach er: »Gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichtümer der Welt herbeiwünschen, nur bleib da sitzen.« Sie schalt ihn aber einen Schafskopf und sprach: »Was helfen mir alle Reichtümer der Welt, wenn ich auf dem Sattel sitze; du hast mich daraufgewünscht, du mußt mir auch wieder herunterhelfen.« Er mochte wollen oder nicht, er mußte den dritten Wunsch tun, daß sie vom Sattel ledig wäre und heruntersteigen könnte; und der Wunsch ward alsbald erfüllt. Also hatte er nichts davon als Ärger, Mühe, Scheltworte und ein verlorenes Pferd; die Armen aber lebten vergnügt, still und fromm bis an ihr seliges Ende.
Beim ersten Hören dieser Geschichte wird man wohl befriedigt schmunzeln: recht geschieht dem reichen Mann! Er ersichtlich steht im Mittelpunkt des Märchens – der Arme fungiert eigentlich nur als Kontrast zu ihm, dann auch als Auslöser seines Debakels. So also kommt es, wenn Gott lohnt und wenn er straft, im Guten wie im Bösen, soll man denken. Doch worüber ergeht hier inhaltlich das Gottesurteil, und wie vollzieht es sich?
Vor alten Zeiten, als der liebe Gott noch selbstauf Erden wandelte
Man hat, was »gut« ist und was »böse«, in unterschiedlichen Kulturen höchst unterschiedlich definiert, und selbst die Vorstellungen ein und derselben Kultur zu denselben Themen können mit dem Lauf der Zeit sich ganz erheblich, bis zum Widersprüchlichen, verändern. Wie rasch zum Beispiel wandelt sich in unserer eigenen Gesellschaft gerade in unseren Tagen die Rolle, welche Frauen, welche Männer darin spielen sollen? Mit den sozialen Verschiebungen gehen natürlich auch moralisch äußerst folgenreiche Wandlungen einher: Ehe, Sexualität, Gleichberechtigung, Autonomie – es gibt kaum einen Bereich des privaten Lebens, der nicht enormen Transformationsprozessen unterzogen wäre. Allein die unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen auf dem Hintergrund durchgreifender technischer, wirtschaftlicher und finanzieller Umgestaltungen erfolgen, führt zu Brüchen und Verwerfungen zwischen Alt und Jung, zwischen Land und Stadt, zwischen den verschiedenen Regionen Europas und vor allem – bis hin zur Gefahr von neuen Weltanschauungskriegen – zwischen Europa und den außereuropäischen Kulturen. Es ist nicht leicht, auf einen Grundbestand von »Menschenrechten« sich zu einigen.
In dieser Lage ist es von unschätzbarer Bedeutung, daß es quer durch die Zeiten und die Zonen menschlicher Geschichte so etwas gibt wie ein Grundwissen über Gut und Böse, das nicht an Satzungen, Gesetzen und Geboten festzumachen ist, die immer auch der Dezision der Mächtigen entstammen, sondern an einer im Gefühl verankerten Evidenz des Menschlichen26. Mitleid nannte ARTHUR SCHOPENHAUER (1788–1860) diese klarsichtige Haltung der Gemeinsamkeit besonders mit den Hilfsbedürftigen27, und in der Tat ist sie es, die den ältesten und unverrückbarsten Bestand an sittlichem Bewußtsein und Gewissen wiedergibt. Wie geht man um mit Fremden, Mittellosen und Schutzsuchenden? Das, mehr als alles andere, entscheidet darüber, was wir für Menschen sind. Bereits die Alten Griechen dachten so.
Wer die ohnehin exzessive und dazu noch als exemplarisch geschilderte Grausamkeit der ehrsüchtig mordenden Recken vor Troja vor Augen hat, vermutet nicht ohne weiteres, daß der gleiche HOMER, weit unterhalb seines Heldenkultes und seiner Unbedenklichkeit gegenüber der zynischen Willkür seiner Heroen im Umgang mit den im Kriege erbeuteten Frauen und Kindern, immer wieder auch sprechen kann von dem unbedingten Schutz, den insbesondere Fremde verdienen. So ermahnt zum Beispiel die Phäaken-Prinzessin Nausikaa ihre Dienerinnen, vor dem wild und verwahrlost aussehenden Odysseus, der im Sturm von Poseidon an den Strand von Scheria geworfen wurde, nicht aus lauter Angst fortzulaufen, sondern sich seiner hilfreich anzunehmen. Denn, so sagt sie:
Zeus, der Olympier, selbst verteilt das Glück an die Menschen,
Ob gering oder edel, so wie er es will, einem jeden;
Dir auch gab er wohl dies, das mußt du nun eben ertragen.28
Jeder also, je nach dem Willen des Zeus, könnte oben stehn oder unten; er ist nicht seines Glückes Schmied, er ist ein Getriebener der Götter; doch um so wichtiger ist es, diese Wesensarmut und Armseligkeit aller Menschen zu sehen und daraus – als den wahren Willen des obersten Gottes – die menschlich wesentliche moralische Folgerung zu ziehen, wie Nausikaa selber es tut, indem sie erkennt, wie es sich mit Odysseus verhält und wie ihm deshalb zu begegnen ist:
Dies ist ein Unglücksmann, der als Verschlagener herkommt,
Diesen gilt es zu pflegen; in Zeus’ Hut stehen sie alle,
Fremde sowohl als Bettler.29
Ganz entsprechend gilt der Beistand, der Odysseus zuteil wird, zunächst gar nicht ihm selbst als Person – er ist nicht abhängig von dem Wert seiner Herkunft und der Würde seines Standes –, sondern er richtet sich auf ihn als den Mittellosen, den Fremden. Flehentlich umfaßt er im Palast die Knie der Königsgemahlin Arete und die des Königs Alkinoos30 und erbittet, daß »ihnen die Götter / Segen verleihn im Leben«31; ja, er ersucht sie um das ersehnte Geleit heimwärts nach Ithaka, »da ich schon lange fern von den Meinen Leiden erdulde.«32 Als diesen heimatlosen Fremden heißt das Königspaar ihn Platz zu nehmen und mit Speise und Trank zu bewirten, denn Alkinoos selber hält es für möglich:
Kam … der Unsterblichen einer vom Himmel hernieder,
Alsdann haben die Götter wohl etwas andres im Sinne.
Denn es erscheinen uns sonst die Götter ja immer leibhaftig,
Wenn wir ihnen vollbringen die herrlichen Festhekatomben.
Und dann sitzen sie hier und speisen in unserer Mitte.
Auch wenn einer allein als Wanderer ihnen begegnet,
Dann verbergen sie nichts; denn wir sind ihnen so nahe.33
Es ist diese Nähe zum Göttlichen, die allem Umgang mit Fremdem und Fremden wesenhaft zukommt. Odysseus ist kein Gott, doch als einem Fremden gebührt ihm Respekt – nicht umsonst trägt bei AISCHYLOS (525–456) Zeus selber den Beinamen xénios – der Schützer des Gastrechts34.
Von den Griechen übernahmen die Römer unter anderem auch die Erzählung von Philemon und Baucis, deren Anfang der Geschichte von dem Armen und dem Reichen sehr ähnelt. Laut OVID (43 v.–17 n. Chr.) besuchten Jupiter und Merkur einmal »Tausend Behausungen …, ein Obdach zu finden, / Tausend Behausungen wurden versperrt. Nur eine empfing sie, / Klein mit Stroh und mit Schilfrohr gedeckt; doch hatten die fromme / Baucis, die alte, sich hier und der gleichfalls betagte Philemon / Einst in den Tagen der Jugend verbunden, sie waren in dieser / Hütte gealtert und machten die Armut sich leicht; denn sie wollten / Nie sie verhehlen; sie trugen sie gerne gelassenen Sinnes … Wie nun die Himmelsbewohner das winzige Häuslein erreichten / Und mit gesenktem Scheitel die niedere Türe durchschritten, / Lädt sie der Greis auf bereitetem Sitz zu behaglicher Ruhe. / Baucis, die emsige, breitet darüber ein rauhes Gewebe / Und zerteilt im Herde die lauliche Asche; das Feuer / Schürt sie, das gestrige, nährt es mit Blättern und trockener Rinde / Und entfacht es mit altersgeschwächtem Atem zu Flammen.«35
Bemerkenswert ist an dieser Darstellung nicht nur die herzliche Aufnahme der Götter in Bettlergestalt durch die beiden Alten, sondern auch die Gleichgesinntheit, mit der Philemon und Baucis agieren; auch in dem GRIMMschen Märchen befeuern einander Mann und Frau wechselseitig im Hause des Armen wie auch des Reichen. Die Hauptübereinstimmung zwischen Mythos und Märchen aber besteht in der gemeinsamen Überzeugung, daß man Gott selbst entweder verläßt oder einläßt, je nachdem, ob man einen Bettler abwehrt oder ehrt. Eben die gleiche Übereinstimmung besteht auch mit dem Kern der Botschaft Jesu: Als Schlußstein alles dessen, was der Mann aus Nazaret zu sagen hatte, betrachtet das Matthäus-Evangelium das Gleichnis von der Ankunft des Menschensohnes, dieser Zusammenfassung gelebter Menschlichkeit: Wenn er kommen wird, sagt Jesus dort, so wird »der König« (Gott) die Menschen einteilen entscheidend auch danach, wie sie mit Bedürftigen und Fremden umgegangen sind. »Hungrig war ich«, wird er dann sagen, »ein Fremder war ich«, »und ihr gabt mir zu essen«, »und ihr führtet mich ein (in euer Haus)« (Mt 25,35); oder aber man tat genau das Gegenteil und verfehlte damit Gott36. – Das ist ein Gedanke, ähnlich einem russischen Märchen, in dem jemand fest daran glaubt, daß heutigentags noch Gott bei ihm einkehren werde; also setzt er alles daran, den Herrgott würdig bei sich aufzunehmen. Da klingelt es, und ein Bettler steht vor der Tür; den jagt er fort, denn er hat ja Wichtigeres zu tun, als jeden Hergelaufenen zu bewirten und sich damit zur Unzeit noch Dreck und Unordnung in die Wohnung tragen zu lassen; noch mal und noch mal wiederholt sich die Szene. Spät am Abend schließlich legt der Mann sich enttäuscht aufs Lager und fragt Gott vorwurfsvoll, warum er sein Versprechen denn nicht gehalten habe. Der Herrgott aber antwortet, er habe ihn doch besucht, dreimal sogar, nur sei er nicht dagewesen, er habe beharrlich sich dreimal verweigert, mit der Begründung, Besseres zu tun zu haben37.
Der Mann in diesem russischen Märchen ist eigentlich nicht hartherzig und auch nicht pflichtvergessen, sein Fehler resultiert aus einer falschen Vorstellung von Gott, die sich am ehesten mit Macht und Pracht und Reichtum in Verbindung setzen läßt, sicherlich nicht mit Armut, Hilfsbedürftigkeit und Angewiesenheit auf fremde Unterstützung. Das GRIMMsche Märchen geht, gemessen daran, in diesem Punkt noch sehr viel weiter: sein »Reicher« ist ganz einfach hartherzig und habgierig, und »Gott«, selbst wenn er in sein Leben tritt, ist für ihn nur ein Anlaß, wie ein Kind in der magischen Phase seiner seelischen Entwicklung zu glauben, daß seine Wünsche allein schon durch die Allmacht der Gedanken38 in Erfüllung gehen werden. Nur: warum ist das so? Wenn es doch religiös so etwas wie ein Ur(ge)wissen von der Menschlichkeit des Mitleids gibt, wieso geschieht dann nicht, was man an sich erwarten könnte: daß jemand, der als »Reicher« mehr besitzt, als er unmittelbar bedarf, wie selbstverständlich teilt mit jemandem in Not? Es müßte doch für ihn ein Leichtes sein, von seinem Überfluß dem andern etwas abzugeben! Und wieso ist es offenbar im Haus des Armen selbstverständlich, einen Fremden, der um Obdach nachsucht, bei sich aufzunehmen? Wie tief bereits der Mythos von Philemon und Baucis, aber auch das Märchen der Brüder GRIMM an die »Moral« der Reichen und Besitzenden fundamentale Zweifel setzt, ergibt sich aus dem Hauptmotiv solcher Geschichten selbst: Gott kommt in seine Welt, die Menschen zu besuchen. Das ist eine Erinnerung an das verlorne Paradies, an eine Lebensform, wie sie von Gott her ursprünglich gemeint ist, nun aber im Kontrast zur »Wirklichkeit« die Funktion eines Wertungsmaßstabs über Recht und Unrecht ausübt: nach wie vor kommt Gott auf diese Erde, die Frage aber ist, wer ihn erkennt und bei sich einläßt.
Die Geschichte von dem Reichen und dem Armen selbst beginnt mit dieser urzeitlichen »Zeitangabe«: vormals, als Gott noch selbst »auf Erden unter Menschen wandelte«. Man mißverstünde dieses mythische »es war einmal« in den Urzeiterzählungen der Völker ganz und gar, wenn man darin eine historisierende Beschreibung vergangener Zustände oder Ereignisse erblicken wollte39. Das »vor alten Zeiten« meint gerade nicht etwas ein für allemal Gewesenes, im Gegenteil, es stellt etwas prinzipiell Gültiges und immer Gegenwärtiges vor Augen. Immer wieder, zu allen Zeiten und an allen Orten, kommt Gott auf diese Erde, um Menschen aufzusuchen, die ihn in ihr Haus beziehungsweise in ihr Herz aufnehmen. So spricht die Bibel in ihrer Paradieserzählung davon, daß Gott am Schöpfungsmorgen sich »im Garten (seiner Welt) erging, als der Tag kühl geworden war«. (Gen 3,8) So nah also vom Ursprung her ist die Verbindung und Verbundenheit von Gott und Mensch und Welt zu denken, und von Gott her gesehen hat sie sich auch niemals aufgelöst. Geändert aber von Grund auf hat sich durch seinen »Sündenfall« die Lage für den Menschen: er jetzt, schuldig geworden, flieht vor Gott als einem strafenden und rächenden Verfolger40, und so wird es zum Hauptproblem der »christlichen« Theologie bei der Auslegung der Botschaft Jesu, wie die Angst des Menschen vor Gott, der eigentlich das Gegenüber, den Garanten eines vorbehaltlosen Vertrauens bilden sollte, sich überwinden läßt. – Auch die jüdische Überlieferung kennt die Vorstellung von dem Besuch Gottes inmitten einer Welt, die sich von ihm entfremdet hat, allerdings hat sie aus den Erzählungen von Schöpfung und Fall des Menschen niemals die prinzipielle Konsequenz gezogen, die Paulus daraus entwickelt hat: daß Menschen von sich aus zum Guten gar nicht fähig sind, es sei denn, sie wären in ein Feld bedingungsloser Liebe, einer absoluten Bejahung unabhängig von allen Verdiensten und Vorleistungen, zurückgekehrt – als, paulinisch gesprochen, »Erlöste« aus »Gnade«41. Statt dessen hat vor allem im chassidischen Judentum die Lehre von der Schekhina42, der »Einwohnung« des »Geistes« Gottes, eine große Bedeutung erlangt: nachdem Gott durch die Schuld der Menschen von der Erde verbannt wurde, lebt er in seiner eigenen Schöpfung gewissermaßen selber im Exil und wandert als ein Fremder unerkannt umher, suchend, wo er eine Bleibe fände. Und umgekehrt ergeht deshalb die Frage an den Menschen, wie er den in den Dingen und Menschen verborgenen Gott zu erkennen vermag.
»So ist es gemeint«, schreibt MARTIN BUBER