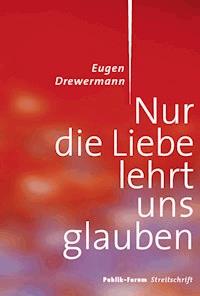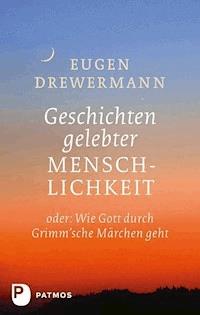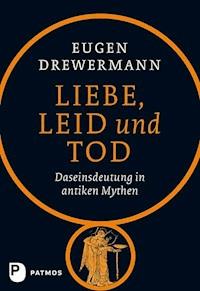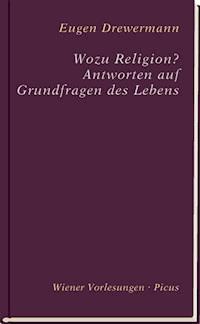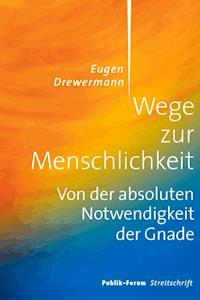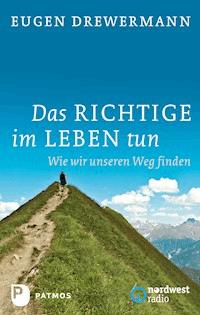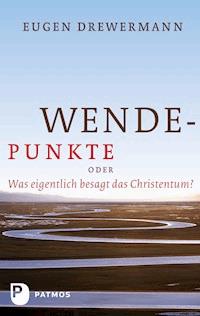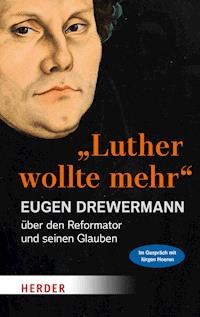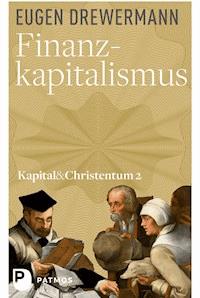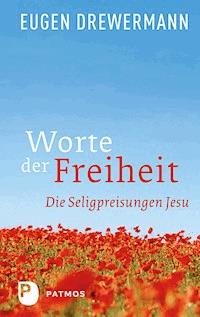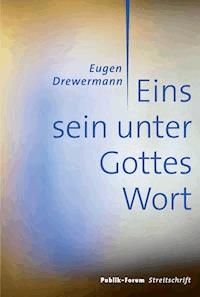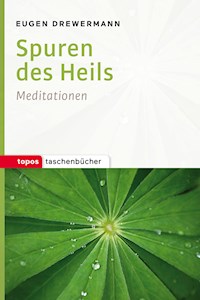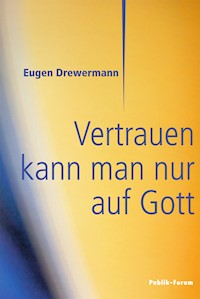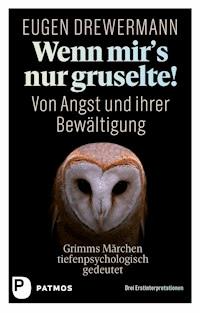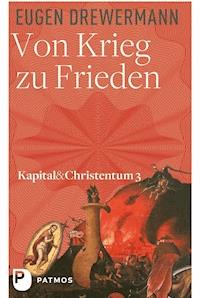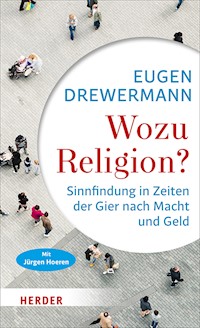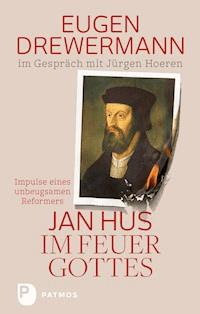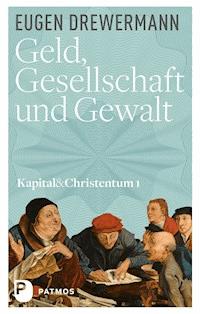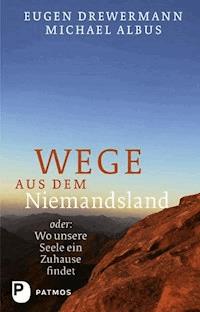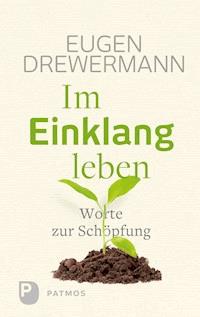
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch birgt Schätze aus Eugen Drewermanns umfangreichem Werk, die sich auf das Thema "Schöpfung" beziehen. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln geben die Texte den Leserinnen und Lesern Anstöße zu eigenen Überlegungen. Drewermanns Ausführungen fordern zum Gespräch heraus, sodass Leben und Glaube frag-würdig bleiben. Erstmalst liegt hier eine leicht zugängliche Zusammenstellung seiner wichtigsten Gedanken zum Verhältnis der Menschen zur Schöpfung vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über den Herausgeber
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Eugen Drewermann
Im Einklang leben
Worte zur Schöpfung
Ausgewählt und herausgegeben von Heribert Körlings
Patmos Verlag
Inhalt
Im Einklang leben mit der Schöpfung
Vorwort
Der Aufbau des Buches
Abweisende Natur?
oder: Fressen und Gefressen-Werden?
Notwendiger Hintergrund
oder: Die große Brücke?
Mögliches Vertrauen
oder: Dankbar für das Leben?
Einträchtiges Leben
oder: Auf die Stimme der Geschöpfe hören?
Quellenverzeichnis
Im Einklang leben mit der Schöpfung
Vorwort
„Im Einklang leben“ präsentiert Perlen aus Eugen Drewermanns umfangreichem Werk, die sich auf das Thema „Schöpfung“ beziehen.
Die folgenden Hinweise zur Auswahl und Zusammenstellung der Texte mögen der Orientierung dienen und für die Beschäftigung mit den Texten hilfreich sein:
Die Frage nach der Wirklichkeit
Wie ist es möglich, Gott als Schöpfer zu vertrauen, die Wirklichkeit als Schöpfung zu betrachten und sinnvoll in ihr zu leben? Diese Fragen haben eine zentrale Bedeutung für Eugen Drewermann. Er nähert sich ihnen aus zwei entgegengesetzten Richtungen:
Abweisende Natur – abwesender Schöpfer?
Als Teil der Natur erlebt die und der Einzelne diese als abweisend. Vom Gesetz des Fressen und Gefressenwerdens bestimmt, erscheint er, wenn auch am Ende der Nahrungskette, im Kreislauf des Werdens und Vergehens. Mit Blick auf diese Wirklichkeit lässt sich nach Drewermanns Ansicht aus der Natur, entgegen der christlichen Glaubenslehre, kein allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender, allgütiger Schöpfergott ableiten. Im Gegenteil. In ihr lasse sich kein planender Schöpfer erkennen.
Angst, Sehnsucht, Liebe – Brücken zum Schöpfer?
Im Vergleich zum Tier spitzt sich die Angst des Menschen noch zu, insofern sie Kennzeichen des Daseins ist, verbunden mit dem Bewusstsein seiner Kontingenz, d.h. seiner Nicht-Notwendigkeit, Vergänglichkeit. Diese Daseinsangst lässt sich nach Drewermann nur im Vertrauen auf ein absolutes Gegenüber beruhigen, eine absolute Person, die mich und den anderen als diese Person will und schätzt: Die Notwendigkeit des Schöpfers zeigt sich, so Drewermann, im Kontext der Daseinsangst, vor dem Hintergrund der zwischenmenschlichen Liebe sowie in der Sehnsucht, unbedingt gewollt, angenommen, geschätzt zu sein. Ein solches Gegenüber kann nämlich kein Mensch einem anderen endgültig sein und bieten.
Der Schöpfer beruhigt die existenzielle Angst der Menschen. Er stillt unsere Sehnsucht, unendlich geliebt zu sein. „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“ drückt dieses Vertrauen aus: Mein Dasein ist in und trotz aller Angst getragen, mein unstillbares Verlangen, geschätzt und angenommen zu sein, findet seine Erfüllung.
Vertrauen zum Schöpfer – die Wirklichkeit als Gegenüber?
Im Vertrauen auf den Schöpfer zeigt sich die Wirklichkeit als Gegenüber. Damit sind für die Einzelnen als Geschöpfe Möglichkeiten gegeben, in der Beziehung zu sich selbst, zum Mitmenschen und zur Natur sinnvoll zu leben.
Ausverkauf der Natur – Möglichkeiten der dialogischen Beziehung?
Das Objektverhältnis zur Natur im kapitalistischen Wirtschaftssystem mit der Vergötzung des Geldes führt nach Auffassung Drewermanns zur Ausbeutung; das Lebendige werde instrumentalisiert. Dagegen bestehe die dialogische Beziehung darin, für die Stimme der Geschöpfe hellhörig zu werden; der Dienst am Leben ergebe sich als Konsequenz daraus.
Der Aufbau des Buches
Am Anfang stehen Ausführungen, die den unterschiedlichen Zugang zur Wirklichkeit thematisieren (S. 14–16). Es folgen Texte über die Eigenart der Natur und den Stellenwert der Menschen in ihr (S. 16–24).
Den Übergang von der Es- zur Du-Perspektive der Wirklichkeit bilden Überlegungen über die menschliche Angst, über die zwischenmenschliche Liebe sowie über die Sehnsucht nach absoluter Annahme (S. 26–49).
Die Texte zu Gott als Schöpfer sind damit eng verbunden (S. 52–80).
Die dann folgenden Ausschnitte beinhalten das sich daraus begründende Selbstverständnis der Menschen als Personen im Verhältnis zu sich selbst (S. 99–115), zu den Mitmenschen (S. 116–121) und zur Natur (S. 82–136).
Heribert Körlings
Abweisende Natur?
oder: Fressen und Gefressen-Werden?
Als Naturwissenschaftler wollen wir kausal begründend erklären, was ist; als Menschen wollen und müssen wir existentiell fragend den Sinn dessen, was erscheint, soweit zu enträtseln versuchen, daß wir auf die Infragestellung unseres Daseins eine Antwort erhalten, mit der wir leben können.
Und es geschah so 417
Noch um 1900 gab es grundlegende Fragestellungen, etwa von Wilhelm Dilthey, nach dem Verhältnis von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Dilthey brachte es, kurz gesagt, als Resultat eines komplizierten Gedankengangs auf den Begriff, daß die Naturwissenschaften es mit dem Erklären zu tun hätten, – darunter verstand er die Erklärung des objektiven Geschehens nach Verstandeskategorien im Sinne Kants; demgegenüber meinte er, daß die Geisteswissenschaften es zu tun hätten mit dem Begriff des Verstehens. Verstehen ist gerade nicht eine Beziehung zwischen Ich und Es, zwischen erklärendem Subjekt und zu erklärender Objektwelt, sondern der Austausch zwischen Ich und Du, ein dialogisches Geschehen, ein Wechsel des Standpunkts der Betrachtung. Man nähert sich dem anderen an, ohne daß man wissen kann, wer er ist. Der einzige Zugangsweg zum Verstehen sind die Selbstmitteilungen des anderen; nur was er als Subjekt von sich äußert, öffnet mir die Tür, mich in ihn einzufühlen, in ihn hineinzuschauen, mich von ihm einladen zu lassen, daß er mir seine Welt „erklärt“. Und je mehr ich mich in seinem Innenraum bewege, beginne ich ihn zu verstehen. Ein solches Geschehen hat nichts Zudringliches, nichts Invasives, es ist überhaupt nur möglich, durch die Tür der Seele des anderen zu kommen, wenn sie sich von innen öffnet, wenn so viel Vertrauen besteht, daß der andere sich nicht bedroht fühlt, – wenn ich also konsequent darauf verzichte, ihn begreifen zu wollen, angreifen zu wollen, ergreifen zu wollen. Nur wenn ich die ganze objektivierende Zugangsmethodik abstelle, erhalte ich eine Chance, das zu tun, was in der Psychotherapie, in der Hermeneutik, in einem zwischenmenschlichen Dialog der Fall sein sollte.
Wege aus dem Niemandsland 181f.
Religion bestünde darin, den einzelnen Menschen so absolut zu setzen, daß er ganz und gar aus der Hand Gottes hervorgeht und in der Hand Gottes steht; … er ist nie ein Mittel zum Zweck, sondern stets ein Zweck an sich selbst, das wirklich Absolute wäre der Mensch, und da wohnte Gott, wo dies begriffen würde.
Das Königreich Gottes in unserer Seele 383
Erklären und Verstehen, Naturwissenschaft und Daseinsauslegung (Hermeneutik), objektive Betrachtung und subjektive Einfühlung müssen mithin zusammenkommen, um der Not eines Menschen gerecht zu werden. Dabei kann das Verstehenwollen sich streckenweise des Erklärens bedienen, um den anderen besser zu „begreifen“.
Jesus von Nazareth 375
Die Welt, wie die Ordnung der Natur sie uns darbietet, ist alles andere als liebend und gütig, sie ist ganz im Gegenteil gleichgültig, grausam und roh. … Es gehört zu dem Gesetz einer materiellen Welt, daß das eine Lebewesen das andere verdrängen und bekämpfen muß, daß das eine sich am Leben erhält durch die Tötung des anderen, daß dort, wo das eine ist, das andere nicht sein kann.
Dogma, Angst und Symbolismus 231f.
Kein Mensch auf der Suche nach den Manifestationen einer unendlichen Güte auf Erden wird nicht zutiefst irritiert sein durch den Anblick der endlosen Grausamkeit des ebenso unerläßlichen wie unabläßigen Fressens und Gefressenwerdens. Die Geschmeidigkeit des Kätzchens – soeben noch bewundernswert als ein Beispiel für die Größe des Gottes der Schöpfung – erklärt seinen Körperbau darwinistisch ganz einfach durch seine Verwandtschaft mit den Fehden und durch seine Spezialisierung als Nachtjäger auf Kleinlebewesen wie Vögel und Mäuse: – mit einem Mal begreift man seine großen, Restlicht verstärkenden Augen, die federnden Fußballen, die dolchartigen Reißzähne und Krallen und schon geht der Blick ins Weite: plötzlich begreift man das unaufhörliche Wettrüsten zwischen Beutegreifern und Beutetieren, man begreift den Zusammenhang der „Nahrungspyramide“ nach der einfachen Regel, daß es stets die Großen sind, welche die Kleinen fressen, ja, mit Mal fängt man an, die Energiemenge der Biomasse eines Biotops zu errechnen, die sich in der Vielzahl der Arten zwischen Geburt und Tod auf einem bestimmten Niveau des Fließgleichgewichts stabilisiert ... Wenn es eine „Intelligenz“ in dieser „Ordnung“ gibt, dann ist es eine, die sich am besten in der Sprache der Mathematik formulieren läßt, der aber so etwas wie Güte und Mitleid absolut abgeht.
Wendepunkte 55
In jedem Augenblick stellt sich im Leben eines Menschen die Entscheidungsfrage, was er als „eigentliche“ Wirklichkeit betrachtet. Die „Gesetze“ der „Welt“ sind, wie sie sind, und sie werden sich nicht ändern: Solange es sie gibt, werden Raubtiere auf die Jagd gehen nach Beutetieren und werden die Beutetiere sich durch Flucht oder Angriff zu verteidigen suchen; solange es sie gibt, werden Bakterien und Viren versuchen, sich zwischen den Zellen und in den Zellen ihrer „Wirtsorganismen“ zu vermehren und werden die „Wirtstiere“ ihre Immunabwehr zu verbessern trachten; solange es sie gibt, werden die Pflanzen, von den Blaualgen bis zu den Mammutbäumen, um einen „Platz an der Sonne“ untereinander konkurrieren; und all dieses stumme Ringen um einen Ort zum Leben bedeutet den endlosen Kampf, den alle gegen alle um Sein und Nichtsein führen. Wie soll es jemals einen ehrlichen Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie geben, wenn dieses entsetzliche Angesicht der Natur nicht in seinem vollkommenen Widerspruch zu dem Gottesbild der Religionen anerkannt und zugegeben wird? In dem Glauben an Gott setzt sich das genaue Gegenteil der „Natur“ absolut: statt des Konkurrierens das Kooperieren, statt des zynischen Zufalls ein System des Zusammenhalts, statt der Gleichgültigkeit des Todes die Gleichwertigkeit jedes einzelnen Lebens. Es ist dabei nicht so, als wenn die Elemente, deren sich die Religion bedient, nicht im Naturprozeß bereits enthalten wären: Daß sozial lebende Wesen wie wir Menschen nach Schockerfahrungen sich schutzsuchend aneinanderdrängen, ist offenbar ein Teil der Überlebensstrategie der Arten; selbst neurobiologisch läßt sich heute zeigen, daß in Angsterlebnissen die Botenstoffe Dopamin und Norepinephrin ausgeschüttet werden, die das Bedürfnis nach Anlehnung verstärken. Doch diese Mechanismen, die das Überleben sichern helfen sollen, sind nur antagonistisch zu den Eindrücken von Tod und Destruktion, die gleichermaßen zur Natur gehören; sie sind daher nur relativ. An Gott zu glauben aber heißt, all die Gefühle, Antriebe Gedanken und Verhaltensweisen absolut zu setzen, die dem Leben dienen.
Vom Ungeheuren, ein Mensch zu sein 429f.
Was heute den „Unglauben“ bedingt, ist der Schrecken und das Schaudern vor einer Natur, die nur umso rätselhafter wird, je genauer wir sie zu betrachten und zu verstehen suchen.
Der sechste Tag 47
Ein unheimliches, grausiges Gesetz, nicht der Vernunft, sondern des Hungers, nicht Gottes, sondern der Gier, liegt in den Gliedern der Wesen und nötigt sie, übereinander herzufallen und um eines kurzzeitigen Überlebens im Augenblick wegen einander alle Formen von physischer und psychischer Qual bis hin zum Tod aufzuerlegen. – Mit welch einer Sorgfalt etwa bildet die Natur den Körper eines Hasen heran, und mit welch einer Mühe zieht eine Häsin ihre Jungen auf? Ihr Leben setzt sie ein, um einen Raubvogel von der Sasse der Kleinen zu vertreiben. Und doch genügt ein winziger Moment der Unachtsamkeit oder der Schwäche oder der Ohnmacht, und Beutegreifer aller Art werden ihre Chance nutzen. – Wer in diesem unerhörten Zwang zu gräßlichster Grausamkeit im Herzen aller Lebewesen kein ethisches, kein religiöses Problem erkennt, bis hin zur Infragestellung der bloßen Möglichkeit von Ethik und Religiosität insgesamt, weiß ganz offensichtlich nicht, wovon er redet, wenn er „das Gute“ und „den Guten“ als Ziel des Handelns und als Ursache der Welt benennt.
Vom Ungeheuren, ein Mensch zu sein 321f.
Die Tatsache der Welt erfordert keinen Gott als Schöpfer; und die Einrichtung der Welt ist, wie sie ist, die Widerlegung jedwedes Gedankens einer Schöpfung.
Wendepunkte 67
In Wirklichkeit meint die Bibel mit ihrem berühmten Satz: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ gar nicht einen zeitlichen Anfang; etwas frei, aber sinngemäß richtig müßte man das Wort „Anfang“ mit „prinzipiell“, „wesentlich“ wiedergeben und sagen: „Wesentlich hängt die Welt in jedem Augenblick von der Schöpfermacht Gottes ab“, und noch genauer müßte man das Wort „Welt“ („Himmel und Erde“) wiedergeben mit „unser ganzes Verständnis als Menschen“; die Aussage lautet dann: „Wir als Menschen können uns selbst wesentlich nur verstehen im Gegenüber eines Gottes, von dessen Güte wir in jedem Augenblick leben.“
Weder um die philosophischen noch um die physikalischen Grundlagen eines „Anfangs“ der Zeit geht es dabei, sondern (wie stets in der Religion!) einzig und allein um unser Selbstverständnis als Menschen.
Hat der Glaube Hoffnung? 326
Offenbar irrt sich, wer da denkt, es gebe eine Vorsehung speziell für ihn, es sei das Drehen der Fixsternsonnen und der Galaxien just auf seine Bedürfnisse nach Leben und Zufriedenheit berechnet. Es kann Gott im ganzen so den einzelnen nicht meinen, und wenn er es nicht kann, gibt es auf der Ebene der einzelnen Existenz unsäglich viel Leid, das keinen Sinn ergibt, unendlich viel an Zumutungen, für die es keine Lösung gibt. Wie lebt man damit? ... Wir können von Gott nicht erwarten, daß er seine Welt zugunsten der Bedürfnisse jedes einzelnen einrichtet und es wird dem Schöpfer nicht gerecht, daß er das Werk der Welt jederzeit korrigiert und ändert. Die Welt als ganze, wie sie ist, ist vollkommen. Zu ihr gehört auch das Leid, auch die Not, und sie wird nicht geändert, weil einzelne das möchten. Dies ist eine Wahrheit, wie wir sie so kaum in der Bibel finden, aber wie die ganze Neuzeit sie uns lehrt. Wir können nicht daraus entkommen. Wir können auch nicht im Namen des Glaubens verlangen, daß wir so nicht denken dürften. Diese Bitterkeit muß stehenbleiben.
Dann aber gibt es etwas anderes, und dies lebt offensichtlich in der Person Jesu: daß es möglich ist unter Menschen, jeden Schmerz und jedes Leid absolut ernst zu nehmen. Dies steht nicht im Widerspruch zur Gleichgültigkeit der Natur, es ist ein einfacher Ausdruck unserer Menschlichkeit.
Zwischen Staub und Sternen 33 und 60
Das jedenfalls ist es, wonach wir suchen: eine Synthese von Rationalität und Mystik. Es müßte gestattet sein, ebenso vernünftig zu denken wie stark und kräftig zu glauben; es müßte erlaubt sein, die äußere Welt so bruchlos zusammenhängend zu verstehen, wie nur irgend möglich, und dabei Gott noch viel tiefer zu erahnen. Erst dann könnten wir Abschied nehmen von dem Bemühen der Theologie, in den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuzeit immer wieder nach Fugen und Löchern zu suchen, in die hinein Gott als Lückenbüßer geschoben werden könnte. Wir müßten im Gegenteil darauf vertrauen, daß die Kraft, die uns leben läßt durch die Liebe, alles durchzieht, so wie die Seele nicht eine Stelle im Körper ist, sondern alles, was den Körper lebend macht, bestimmt. Sie ist nicht gelöst von ihm, denn das wäre der Tod; sie ist dieser Körper, sie geht ihm hervor, und sie gestaltet ihn mit; da ist keine Trennung zwischen Geist und Materie vorstellbar. Vieles, was wir in der Gegenwart paradoxerweise von den Naturwissenschaften tiefer lernen denn je, könnte und müßte unsere Art, gläubig zu sein, entscheidend prägen. Wir würden Gott nicht mehr ersehnen in einem fernen Jenseits, wir würden ihn antreffen mitten in dieser Welt, und seine Bekundungen stünden nicht im Widerspruch zu dem, was wir sehen, sondern sie gingen mitten darin ein.
Das Johannesevangelium II 313
Es ist nicht eine animistische Todesfurcht, die der Religion zum Grunde liegt, es ist vielmehr Frage, die schon sehr früh, spätestens auf der Stufe des Neandertalers beginnt, wie es möglich ist, ein Leben sinnvoll zu finden, dessen Beginn absolut nicht notwendig, dessen Dauer jederzeit bedroht und dessen Ende ebenso zufällig wie unabänderlich sein wird. Im „Haushalt“ der Natur stellt sich diese Frage nicht: Sie bringt beliebig viele Individuen hervor, um unter ihnen die „Fittesten“ im Überlebenskampf auszuwählen; das heißt, selbst dieses „um zu“ ist fiktiv: – es überlebt ganz einfach nur dasjenige, was imstande ist, seine Gene erfolgreich weiterzugeben. So die Biologie. So die Natur.
Im Anfang 738
Sieht man genau hin,