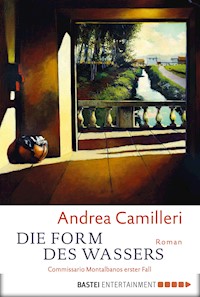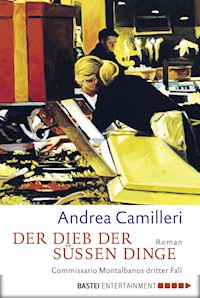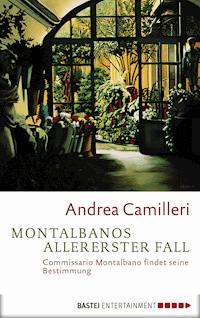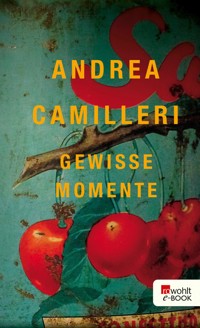
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Welche Menschen und Bücher haben mir im Lauf meines langen Lebens zu innerer Klarheit verholfen? Diese Frage stellt sich Italiens bedeutendester lebender Schriftsteller und beantwortet sie in kurzen, pointierten Geschichten: Über seine bewegten Jugendjahren auf Sizilien, zur Zeit des Faschismus. Das Hausmädchen seiner Großtante, deren Mut seine Familie vor den Repressalien der deutschen Besatzer schützte. Über seine Zeit als Theaterregisseur, bevor er ein weltberühmter Schriftsteller wurde. Hier gibt es die schöne Szene, in der Arthur Adamov, Meister des absurden Theaters, Camilleri das Telefon reicht und ihn unvorbereitet mit Becket höchstpersönlich sprechen lässt, dessen "Warten auf Godot" Camilleri gerade in Rom inszeniert. Oder den Wutanfall Camilleris während der Proben eines Stückes, das vor Kirchenvertretern aufgeführt werden soll. Der Kardinal, der Camilleris Fausthieb nicht nur verzeiht, sondern berechtigt findet, ist der spätere Papst Johannes XXIII. Und natürlich begegnet der Leser auch bedeutenden Figuren der abendländischen Literatur: Orlando furioso – und Pinocchio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Ähnliche
Andrea Camilleri
Gewisse Momente
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein persönliches Buch des großen italienischen Schriftstellers:
Über seine bewegten Jugendjahre auf Sizilien, zur Zeit des Faschismus. Über beeindruckende Menschen wie das Hausmädchen seiner Großtante, deren Mut seine Familie vor den Repressalien der deutschen Besatzer schützte. Über seine Zeit als Theaterregisseur, bevor er ein weltberühmter Schriftsteller wurde. Über unvergessliche Begegnungen mit Pier Paolo Pasolini, Samuel Beckett, Antonio Tabucchi, dem Papst und Pinocchio.
Ein Buch zum Staunen, Lachen, Weinen – und ein wertvolles Stück Zeitgeschichte.
Über Andrea Camilleri
Andrea Camilleri wurde 1925 in Porto Empedocle, Sizilien, geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur und lehrte über zwanzig Jahre an der Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Seit 1998 stürmte jeder Titel des Autors die italienische Bestsellerliste. Mit seinem vielfach ausgezeichneten Werk hat er sich auch einen festen Platz auf den internationalen Bestsellerlisten erobert. Im Kindler Verlag sind etliche seiner Werke erschienen, zuletzt «Die Inschrift» (2018). Andrea Camilleri ist verheiratet, hat drei Töchter, vier Enkel und lebt in Rom.
Vorbemerkung
Dieses Buch versammelt in ungeordneter Folge, doch mit besonderer Berücksichtigung meiner Jugendjahre, Begegnungen, die wenige Momente oder fast ein ganzes Leben andauerten und eine Art Kurzschluss in mir auslösten. Das heißt, sie führten zunächst zu einer vorübergehenden Distanz und dann zu größerer Helligkeit in meinem Geist.
Es sind bekannte Namen dabei, viel häufiger aber geht es um Begegnungen mit, sagen wir, gewöhnlichen Menschen, die für mich von ebenso großer Bedeutung waren. Einige werde ich bei dieser Sammlung vergessen, da bin ich sicher; andere dagegen habe ich bewusst nicht erwähnen wollen, auch dessen bin ich mir sicher. Doch die Männer, die Frauen und die Bücher, von denen ich in diesem schmalen Buch erzähle, waren Funken, Blitze, Momente größerer Klarheit für mich – und dafür wollte ich ihnen danken.
a.c.
Antonio
Als ich an einem Morgen Mitte Januar 1942 das Café Cuocolo betrat, sah ich einen Unbekannten an der Kasse sitzen, einen Jungen, sicher zwei oder drei Jahre älter als ich, pausbäckig, pummelig, blond, mit dicken Brillengläsern, der so sehr mit der Lektüre eines Buches beschäftigt war, dass er nur kurz den Blick hob, wenn er Geld entgegennehmen, den Rest herausgeben und einen Gruß murmeln musste. Neugierig geworden, spähte ich nach dem Buch, das er las: Die enge Pforte von André Gide. Meine Überraschung war groß. Wie viele Menschen mochte es in der ganzen Provinz Agrigento geben, die Gide lasen? Höchstens ein knappes Dutzend. Ich konnte mich nicht zurückhalten, ich musste ihn ansprechen: «Gefällt dir Gide?»
Die Antwort lautete: «Warum? Hast du ihn gelesen?»
«Habe ich. Gefällt er dir?»
«Er überzeugt mich nicht ganz.»
Am nächsten Tag saß Andrea an der Kasse, der Sohn von Signor Cuocolo. Der Junge, den ich am Vortag gesehen hatte, saß hingegen mit einer ausgetrunkenen Tasse Kaffee an einem Tisch und las noch immer in dem Roman von Gide. Ich bat ihn um Erlaubnis, mich neben ihn zu setzen, wir stellten uns vor. So erfuhr ich, dass er Antonio hieß und der ältere Bruder von Andrea war.
«Warum habe ich dich hier noch nie gesehen?»
Er erzählte, dass ihr Vater, früh zum Witwer geworden, von Salerno hierher nach Porto Empedocle gezogen war, wo er nicht nur das Café eröffnet hatte, sondern auch zum größten Kaffeeimporteur der Provinz aufgestiegen war. Antonio war mit seinem Bruder in Salerno im Haus der Tante geblieben, und erst als er die Schule beendet hatte, war er nach Porto gekommen, um seinem Vater und Andrea zu helfen, der bereits vor ihm dorthin gegangen war.
«Welche Fakultät besuchst du?»
«Ich bin nicht an der Universität», antwortete er.
«Willst du nicht studieren?»
«Natürlich, aber erst später.»
«Was heißt später?»
«Wenn ich den Militärdienst geleistet habe.»
«Entschuldige, aber das verstehe ich nicht.»
«Wenn sie mich als Student einziehen, muss ich den Kursus für Offiziersanwärter machen.»
«Na und?»
«Ich will kein Offizier werden, ich möchte keine Befehle erteilen.»
«Aber wenn du kein Offizier wirst, musst du einfacher Soldat sein, und das heißt, dass du Befehlen gehorchen musst.»
Er sah mich mit einem listigen Lächeln an: «Befehle kann man immer umgehen.»
Zwischen uns entstand eine heftige Freundschaft. Antonio war ein noch gefräßigerer Leser als ich und ein scharfsinniger, gründlicher Kritiker seiner Lektüren. Er besaß einen wachen Geist und machte wenig Worte, doch die hatten ein beträchtliches Gewicht. Er hasste Sport, war aber seltsamerweise ein Meister im Rollschuhfahren: auf Asphaltstraßen erreichte er eine unglaubliche Geschwindigkeit. In der ersten Februarhälfte kam die berühmte rosa Postkarte mit seiner Einberufung. Wir waren im Krieg, diese Karte bedeutete mit fast hundertprozentiger Sicherheit, dass mein Freund an die Front geschickt wurde.
Zwei Monate lang erhielt ich keine Nachricht von ihm. Zu meiner größten Überraschung sah ich ihn in den ersten Maitagen wieder an der Kasse sitzen. Diesmal las er einen Roman von Steinbeck.
«Hast du Urlaub?»
«Nein, sie haben mich entlassen.»
«Warum das?»
«Auf meinem Personalblatt steht, dass ich für den Militärdienst völlig ungeeignet bin.»
«Das bist du wirklich, aber wie haben sie das herausgefunden?»
Er lächelte.
«Ach nichts, ein paar Dummheiten, mehr nicht.»
Es war klar, dass er über seine kurze Zeit als Soldat nicht sprechen wollte.
Doch ein paar Tage später kam ein junger Mann auf Urlaub nach Porto, der während Antonios Militärdienst sein Kamerad gewesen war. Er erzählte uns, was passiert war. Am zweiten Tag ihres Aufenthalts in der Kaserne von Palermo war Antonio beim Wecken nicht aufgestanden, sondern einfach auf seiner Pritsche liegen geblieben. Der Feldwebel war gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
«Geht es dir nicht gut? Willst du dich krankmelden?»
«Nein, es geht mir ausgezeichnet, danke.»
«Warum bist du dann nicht aufgestanden?»
«Weil der Wecker für meinen Geschmack zu früh klingelt.»
Ein kräftiger Tritt des Feldwebels stieß ihn von der Pritsche, und er bekam fünf Tage Gefängnis. Wieder draußen, war er kurze Zeit später in Zivilkleidung zum Appell angetreten – militärisch waren nur die Stiefel und das Schiffchen auf dem Kopf.
«Warum bist du nicht in Uniform», brüllte der Feldwebel.
«Weil der Stoff mich kratzt.»
Diesmal waren es zehn Tage Gefängnis. Dann kam die Sache mit dem Marsch. Der Zug, zu dem Antonio gehörte, machte einen fünfundzwanzig Kilometer langen Geländemarsch über Landstraßen. Sie ruhten sich eine halbe Stunde aus, dann kehrten sie ohne Marschordnung auf der Asphaltstraße zurück. Irgendwann setzte Antonio sich auf einen Stein, öffnete seinen Rucksack, holte die Rollschuhe heraus und zog sie an. Blitzschnell überholte er den Zug und rief dem verblüfften Feldwebel zu: «Wir sehen uns in der Kaserne!»
Erstaunlicherweise machte der Feldwebel keine Meldung. Er wusste nicht, was er von Antonio halten sollte, ob er es mit einem Verrückten zu tun hatte oder einfach mit einem notorisch ungehorsamen, launischen Soldaten.
Dann kam ein ernster Zwischenfall. Der Zug übte zum ersten Mal das Werfen von Handgranaten. Es handelte sich um Granaten, die zeitverzögert explodierten. Hatte man den Sicherungsstift abgezogen, musste man die Granate sofort werfen, sonst wäre sie nach wenigen Sekunden in der Hand explodiert. Antonio kam an die Reihe. Er erhielt seine Granate, riss den Sicherungsstift ab, betrachtete sie und wandte sich dann, die Granate noch immer in der Hand, an den Feldwebel: «Und was soll ich jetzt machen?»
«Wirf sie weg, Idiot!!!», schrie der Feldwebel fast im Chor mit den anderen Soldaten, die bereits nach allen Seiten davonrannten, um sich so weit wie möglich von ihm zu entfernen.
Aufreizend lässig warf Antonio die Granate in die Luft, die zwei Schritt von ihm explodierte, ihn aber glücklicherweise unverletzt ließ. Jetzt war eine Untersuchung durch den Psychiater unumgänglich. Vermutlich machte Antonio sich diese Gelegenheit ein bisschen zunutze, Tatsache ist, dass der Arzt ihn für geistig instabil und untauglich für den Militärdienst erklärte.
In den folgenden zwei Jahren bewies Antonio nicht nur seine Untauglichkeit für den Militärdienst, sondern auch für das normale Leben. Er war imstande, während eines Bombenangriffs völlig passiv zu bleiben, ja, er rührte sich nicht vom Fleck, um keinesfalls die Augen von dem abwenden zu müssen, was er gerade las. Das war kein Mut, es war eine Art anarchische Gleichgültigkeit gegenüber den Geschehnissen um ihn herum. Vielleicht ahnte er dunkel, dass er nicht lange leben würde.
Tatsächlich starb er Ende 1945 sehr jung an einem Infarkt, bei dem ihm der Roman Wendemarke von William Faulkner aus den Händen fiel.
Die Beichte
Kurz vor meiner Hochzeit erfuhr ich, dass die Trauung nicht in der Kirche stattfinden konnte, weil ich nicht gefirmt war. Ich war zwar getauft und hatte auch die Erstkommunion empfangen, aber die Firmung war unerlässlich für das Recht auf eine kirchliche Trauung. Da ich in kirchlichen Dingen völlig ahnungslos bin, ging ich zum Pfarrer unserer Gemeinde und fragte ihn, was ich tun musste, um mich von ihm firmen zu lassen. Er sah mich erstaunt an: «Die Firmung wird von Bischöfen, nicht von einfachen Priestern gespendet, das ist eine komplizierte Angelegenheit!»
Zu der Zeit war ich mit einer Theaterregie in Livorno beschäftigt. Das Stück wurde von einem gebildeten und sehr geistreichen Jesuitenpater finanziell unterstützt: Padre Egidio Guidobaldi, ein Hüne, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Normalerweise fuhr ich freitagabends in Rom los und hielt gleich nach meiner Ankunft in Livorno eine Probe ab, wo es dann den ganzen Samstag und Sonntag weiter mit den Proben ging, bis ich am Sonntag spät in der Nacht zurück in Rom war. In Livorno angekommen, berichtete ich Padre Egidio sofort vom Problem meiner fehlenden Firmung. Der Jesuit verzog keine Miene und sagte, er werde sich um alles kümmern. Schon am nächsten Sonntag werde der alte Bischof von Livorno, Seine Exzellenz Piccioni, der ältere Bruder eines der wichtigsten Politiker der Democrazia Cristiana, mir die Firmung spenden. Padre Egidio erklärte mir auch, dass der Bischof eigentlich schon im Ruhestand war und ein jüngerer Bischof jetzt seine Stelle innehatte, aber er wende sich lieber an Piccioni, denn mit ihm würde ich gut zurechtkommen, versicherte er mir.
«Warum?», fragte ich.
«Weil er während des Krieges den Hafenarbeitern beigestanden hat, die alle Kommunisten sind. Wie Sie ja auch.»
Kurz vor meiner Rückfahrt nach Rom teilte Padre Egidio mir mit, dass er mit dem Bischof gesprochen habe. Am nächsten Sonntag erwarte Seine Exzellenz uns in seiner Wohnung. Allerdings sei es erforderlich, vor dem Empfang der Firmung die Beichte abzulegen.
«In Ordnung», antwortete ich. «Ich werde vorher beichten.»
Natürlich dachte ich nicht im Traum daran, zu beichten. Als ich das nächste Mal nach Livorno kam, fragte der Jesuit sofort: «Haben Sie gebeichtet?»
«Ja.» Und ich begann mit den Proben.
Doch bei der Samstagnachmittagsprobe ließ ich mich dazu hinreißen, den Schauspielern eine Szene zu machen und sie wegen ihrer Lustlosigkeit und Schlamperei zu beschimpfen. Mein Zorn war so übermächtig, dass mir wohl auch ein paar Flüche entschlüpften. Padre Egidio, der bei der Probe anwesend war, sagte mir hinterher: «Wenn ich nicht hier gewesen wäre, hätte ich nichts von dem gehört, was Sie gesagt haben – aber leider war ich dabei. Sie müssen noch einmal beichten.»
«Dann nehmen Sie mir die Beichte ab», sagte ich.
«Nein, das tue ich nicht.»
«Warum nicht?»
«Es ist mir lieber, wenn es zwischen uns bei einer reinen Arbeitsbeziehung bleibt.»
«Dann nennen Sie mir einen Ihrer Kollegen.»
«Nein», entgegnete er. «Ich werde Seiner Exzellenz, dem Bischof, sagen, dass Sie morgen vor der Firmung beichten müssen. Er wird Ihnen die Beichte abnehmen.»
Am nächsten Morgen um acht Uhr, es war Sonntag, saßen wir zusammen mit meinem Firmpaten, dem Bühnenbildner Enrico Sirello, in der Privatwohnung des Bischofs, die sich im Haus des Bischofssitzes befand. Der Sekretär Seiner Exzellenz teilte uns mit, dass dieser uns jetzt in seinem Arbeitszimmer empfangen werde.
«Gehen Sie mit ihm, gehen Sie beichten», sagte Padre Egidio lächelnd.
Ich folgte dem Priester. Er klopfte an die Tür, eine Stimme forderte uns auf, einzutreten, ich ging hinein, und der Priester schloss die Tür hinter mir.
Der Bischof saß auf einem Sofa. Mich beeindruckte, dass er, während ich auf ihn zuging, aufstand und mir lächelnd mit ausgestreckter Hand entgegenkam. Wir gaben uns die Hand, er setzte sich wieder und bedeutete mir, mich neben ihn zu setzen. Er war sehr alt, doch sein breites, offenes, fast faltenloses Gesicht flößte sofort Zuneigung ein.
«Seit wann beichten Sie nicht mehr?»
«Seit zwanzig Jahren.»
Ich war zweiunddreißig, das letzte Mal war ich in der Schule zur Beichte gegangen.
Er sah mich an. Sein Blick war bemerkenswert. Mir war, als würden seine Pupillen in meine Augen dringen, um mich gründlich zu erforschen. Und tatsächlich: «Sie sind gläubig?»
Vor diesen Augen konnte ich nicht lügen. «Nein.»
«Warum wollen Sie dann kirchlich heiraten?»
«Ich möchte meinen Eltern und Großeltern keinen Kummer machen …»
«Ich verstehe.»
Er legte sich die Stola um und sagte: «Meinen Sie, Sie können mit mir von Mann zu Mann sprechen, ohne mir etwas zu verschweigen?»
Von Mann zu Mann? Er verdiente eine zustimmende Antwort: «Ja.»
«Gut», sagte er. «Dann beginnen wir mit der Beichte.»
Als er das Kreuzzeichen machte, stand ich auf und kniete vor ihm nieder. Er sah mich überrascht an.
«Nicht doch! Nein! Setzen Sie sich wieder neben mich!» Er legte seine Hand auf meine. «Haben Sie je etwas getan, was Ihrer Meinung nach als eine schwere Sünde gelten könnte, wie Mord, Diebstahl, falsches Zeugnis?»
«Nein, niemals.»
«Haben Sie je Verachtung für einen anderen Menschen empfunden?»
«Nicht bewusst.»
«Wissen Sie», sagte er, «ich glaube, die schwerste Sünde, die man begehen kann, ist, jemanden zu verachten. Auch wenn dieser Jemand etwas getan hat, was uns verbittert, überrascht oder erschüttert hat: Verachtung ist das Letzte, was man für ihn empfinden sollte.»
Ich begriff, dass ich es mit einem außergewöhnlichen Mann zu tun hatte. Er stellte mir keine Fragen mehr, trotzdem begann ich, über mich zu sprechen, über mein Leben, die Gründe für meine Heirat. Ich sagte, dass ich an die Familie glaubte und sofort ein Kind haben wolle.
«Haben Sie vor der Heirat viele Erfahrungen gemacht?»
«Ja, viele.»
«Dann sagen Sie mir: Gab es während Ihrer amourösen Begegnungen je einen Moment, in dem Sie Ihre Partnerin nicht als Frau, sondern als bloßes Objekt Ihres Begehrens angesehen haben?»
Bevor ich antwortete, nahm ich mir etwas Zeit. Ich erforschte mein Gewissen gründlich und sagte dann: «Nein, niemals.»
«Die wirkliche Sünde des Fleisches», bemerkte er, «sind nicht unkeusche Taten, sondern die andere oder den anderen zu einem bloßen Objekt zu machen und ihm jede Menschlichkeit zu nehmen. Das ist die wirkliche Sünde.»
Solche Worte hatte ich noch nie gehört und würde sie nie wieder hören.
Wir fuhren mit unserem Gespräch fort. Gott erwähnte er kein einziges Mal, er sprach immer vom Menschen. Von der Würde des Menschen, die niemals, unter keinen Umständen mit Füßen getreten werden dürfe. Plötzlich begann die Pendeluhr zu läuten. Es war elf Uhr, wir hatten drei Stunden lang ununterbrochen gesprochen, ohne zu bemerken, wie die Zeit verging.
«Ich glaube, Sie haben mir alles gesagt. In fünf Minuten sehen wir uns in meiner Privatkapelle wieder», sagte der Bischof.
Ich ging hinaus. Der Erste, den ich sah, war Padre Egidio, er machte ein sehr besorgtes Gesicht.
«Ich kann Sie nicht ernsthaft bitten, das Beichtgeheimnis zu verletzen», sagte er, «aber verflixt noch eins, was für Sünden haben Sie begangen, dass Sie drei Stunden beim Bischof gewesen sind?»
«Ihnen kann ich es ja sagen», antwortete ich lachend. «Ich bin Mitglied der Mafia und habe viele Morde auf dem Gewissen.»
Der Zeremonie der Firmung war sehr kurz. Man band mir eine weiße Binde um die Stirn, mein Firmpate stand neben mir, der Bischof sprach ein paar Gebete auf Latein, dann ging er zu mir. Ich kniete, er gab mir einen Klaps auf die Wange und sagte, ich solle mich erheben. Die Zeremonie war beendet. Man nahm mir die Binde ab, ich trat vor den Bischof und verbeugte mich tief. Er bückte sich, umfasste meine Schultern und deutete eine Umarmung an.
«Es war ein Vergnügen, dich kennenzulernen», sagte er, vom Sie zum Du übergehend.
Ich bin jetzt neunzig Jahre alt. Dieses dreistündige Gespräch mit Piccioni hat sich mir für immer eingeprägt, und nicht nur im Gedächtnis, sondern vor allem in meinem Herzen.
Antonio Tabucchi
Tabucchi hatte gerade Piazza d’Italia, sein erstes Buch, veröffentlicht, und ich war in Pisa, als ein Freund mich fragte, ob ich den angehenden Schriftsteller kennenlernen wolle. Ich sagte sofort ja, denn Tabucchis Stil, der dem Anschein nach so schlicht, seinem Wesen nach aber so elegant und raffiniert ist, hatte mich sehr beeindruckt. Doch im letzten Moment zwang mich ein unvorhergesehenes Ereignis, das Treffen abzusagen. Von da an las ich alle Bücher, die er nach und nach veröffentlichte, bis zu seinem Meisterwerk Erklärt Pereira. Dieser Roman begeisterte mich: Endlich widmete sich ein italienischer Schriftsteller einem so wichtigen Thema wie der individuellen Freiheit. Ich fragte Bekannte, ob es möglich sei, Tabucchi persönlich kennenzulernen, erhielt aber eine abschlägige Antwort. Er lebte schon seit Jahren nicht mehr in Italien, sondern in Portugal. Als ein Arbeitsauftrag mich nach Lissabon führte, wo ich einen Monat lang bleiben sollte, fragte ich natürlich nach Tabucchi, doch man antwortete mir, er sei im Ausland. Es war wie Fangen oder Verstecken spielen.
Dann schien der Moment endlich gekommen. Bei einem Kongress, den die Zeitschrift «Micromega» während der Turiner Buchmesse veranstaltete, waren wir beide als Redner auf dasselbe Podium geladen. Doch auch diesmal narrte uns das Schicksal: Tabucchi konnte nicht teilnehmen, weil er einen kleinen Unfall gehabt hatte, also sprach er nur am Telefon.
Dann erschienen unsere Namen öfter zusammen in Zeitungen, die uns über die politische Situation in Italien interviewt hatten. Bemerkenswert war, dass unsere Antworten fast immer übereinstimmten, als hätten wir sie vorher miteinander abgestimmt. Eines Tages klingelte in meinem Arbeitszimmer das Telefon, es war Tabucchi. Das Telefonat war kurz und in gewisser Weise sehr seltsam.
«Hallo? Hier ist Antonio Tabucchi.»
Das war wirklich eine große Überraschung für mich.
«Ciao», antwortete ich. «Wie geht es dir?»
«Gut, ich wollte nur mal deine Stimme hören.»
Das verwirrte mich noch mehr, ich wusste nicht, was ich antworten sollte, er sprach weiter. «Ciao, es hat mich gefreut, dich zu hören, bis bald.» Und er beendete das Gespräch.
Etwa sechs Monate lang hörte ich nichts mehr von ihm, bis ich eine Ansichtskarte aus Athen bekam. Darauf stand nur: «Ein Gruß von Antonio Tabucchi».
Im Lauf der folgenden Jahre erhielt ich zwei oder drei solcher Karten aus verschiedenen Städten Europas. Da er nie einen Absender schrieb, wusste ich nicht, wohin ich ihm etwas wie eine Antwort schicken sollte, aber mein Wunsch, ihn persönlich kennenzulernen, wurde immer größer.
An einem Tag im Mai 2011 erhielt ich endlich einen Anruf von Antonio: «In drei Tagen müsste ich in Rom sein, ich werde dir das noch bestätigen. Und sollte die Welt untergehen, diesmal müssen wir uns kennenlernen. Sobald ich in Rom bin, rufe ich dich an, dann vereinbaren wir ein Treffen.»
Mit einer gewissen Unruhe erwartete ich seinen Anruf, der pünktlich kam, aber nur, um mir in betrübtem Ton mitzuteilen, dass sein Vorhaben sich zerschlagen habe. Und so ist Tabucchi für mich ein Freund gewesen, den ich nie persönlich kennengelernt habe.
Nach seinem Tod 2012 gab die Literaturwissenschaftlerin Anna Dolfi unter dem Titel Di tutto resta un poco (Von allem bleibt ein bisschen) ein Buch mit verstreuten Schriften Tabucchis über Literatur und Film heraus. Zu meinem großen Erstaunen las ich in einem Artikel, den Antonio anlässlich des Todes der Verlegerin Elvira Sellerio veröffentlicht hatte, ein Dutzend Zeilen, die sich mit mir beschäftigten: nicht mit dem Schriftsteller, sondern mit dem Menschen und Sizilianer. In diesen Worten, die mich zutiefst rührten, fand ich den Schlüssel für seinen Wunsch, mich kennenzulernen, der ja auf Gegenseitigkeit beruhte.
Und dieser kleine Text, den ich ihm widme, soll ein posthumer Dank für seine Freundschaft sein.
Pino Trupia
Im September 1943, also zwei Monate nach der Landung der Alliierten in Sizilien, kam mir und meinem Freund Ugo La Rosa die Idee, eine Zeitung herauszugeben, die dann die allererste Zeitung des demokratischen Italien sein würde. Für die Genehmigung und das Papier musste man sich an den Leiter des AMGOT wenden, das Allied Military Government of Occupied Territories. Die Abteilung des AMGOT in Agrigent leitete ein Engländer, Colonel Chewin, sein Stellvertreter war Amerikaner, Major Thomson. Alle wussten, dass die beiden sich nicht gut verstanden, und es war auf jeden Fall besser, wenn wir uns mit unseren Bitten direkt an Colonel Chewin wandten, der ein freundlicher und hilfsbereiter Mann zu sein schien.
Nach zwei, drei Tagen des Wartens wurden wir vom Colonel empfangen. Sein Büro war der Raum, in dem vor der Landung der Alliierten der Präfekt gesessen hatte. Ugo und ich schilderten ihm unseren Plan einer Wochenzeitung mit vier großen Seiten, die über die Lage in der Provinz Agrigent informierte und unseren Landsleuten etwas wie die Grundprinzipien der Demokratie nahebrachte. Der Colonel begrüßte das Vorhaben nicht nur und versorgte uns mit dem nötigen Papier, er stellte uns sogar Redaktionsräume zur Verfügung. Er gab uns die Schlüssel für eine Wohnung mitten in der Stadt, die Sitz der faschistischen Gruppierungen an der Universität gewesen war.
Wir nahmen die Räume in Besitz und konnten von dort aus dank der Zusammenarbeit mit unseren ehemaligen Schulkameraden zu fast allen Ortschaften der Provinz Kontakt aufnehmen. Als Erstes baten wir unsere Korrespondenten, uns sofort eine Namensliste aller örtlichen Faschisten zu schicken, die bereits versuchten, sich bei den Amerikanern eine weiße Weste zu verschaffen. Wir erhielten etwa zweihundert Namen und beeilten uns, sie gleich in der ersten Nummer unserer Zeitung zu veröffentlichen, die wir «Küss die Hand» nannten, wie um die kommende Demokratie mit dieser traditionellen Begrüßungsformel zu empfangen.