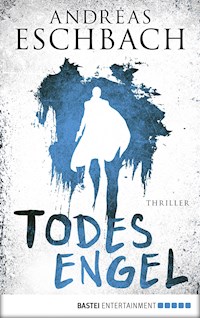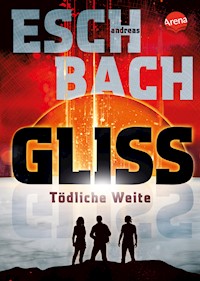
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Draußen wartet die Weite - und sie kann tödlich sein … Ajit weiß, dass er die Stadt Hope niemals verlassen wird. Denn sie ist umgeben vom GLISS, einem Boden, auf dem nichts haftet und nichts gebaut werden kann. Hinter dem GLISS gibt es keinen Ort, keine Menschenseele. Zumindest dachte der 17-Jährige das. Doch als eines Tages ein toter Mann über das GLISS getrieben wird, ist Ajit und seinen Freunden Phil und Majala klar: Die Geschichte ihrer Welt ist eine Lüge und die, die Ajit für seine Familie hielt, tun alles, um diese Lüge zu verteidigen. Die Wahrheit jedoch - die liegt hinter dem GLISS. Mitten in der tödlichen Weite, aus der noch niemals jemand zurückgekehrt ist … Hochspannende All-Age-Science-Fiction aus der Feder von Bestseller-Autor Andreas Eschbach ("NSA - Nationales Sicherheitsamt" und "Eines Menschen Flügel"). "Gliss" erzählt von drei Jugendlichen, die sich ins Unbekannte aufmachen und dabei alles, woran sie je geglaubt haben, aufgeben müssen. "Gliss" ist ein Feuerwerk aus actionreicher Handlung und menschlichen Konflikten vor einer atemberaubenden Kulisse. Für Fans von Frank Schätzing und Cixin Liu und alle Leser*innen ab 14 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Ähnliche
Weitere Bücher von Andreas Eschbach im Arena Verlag:
Aquamarin
Submarin
Ultramarin
Black*Out
Hide*Out
Time*Out
Perfect Copy
Die seltene Gabe
Gibt es Leben auf dem Mars
Das Marsprojekt – Das ferne Leuchten (Band 1)
Das Marsprojekt – Die blauen Türme (Band 2)
Das Marsprojekt – Die gläsernen Höhlen (Band 3)
Das Marsprojekt – Die steinernen Schatten (Band 4)
Das Marsprojekt – Die schlafenden Hüter (Band 5)
Andreas Eschbach
geboren in Ulm, studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik. Mit seinem Thriller »Das Jesus-Video« eroberte er erstmals die Bestsellerlisten. Seither gehört Eschbach mit seinen Romanen, zuletzt »NSA« und »Eines Menschen Flügel«, zu den deutschen Top-Autoren. Seine Romane für junge Leser wie »Black*Out«, »Aquamarin«, »Das Marsprojekt« und »GLISS. Tödliche Weite« erscheinen im Arena Verlag. Andreas Eschbach lebt als freier Schriftsteller mit seiner Familie in der Bretagne.
Weitere Informationen zum Autor unter www.andreaseschbach.de.
Andreas Eschbach
GLISS
Tödliche Weite
Ein Verlag in der
© 2021 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Str. 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Text: Andreas Eschbach
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Coverillustrationen: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© faestock, © rdonar, © Fedorovaolga, © laverock, © Rybin, Dmitriy, © aaltair, © kazoka, © Anna Subbotina)
Lektorat: Anna Wörner
E–Book–Herstellung:
Arena Verlag mit parsX, pagina GmbH, Tübingen
E-Book ISBN978-3-401-80967-0
Besuche den Arena Verlag im Netz:
www.arena-verlag.de
Es war meine Großmutter, die mir das Gliss gezeigt hat. Ich war noch klein, in einem Alter, in dem man Kinder vom Gliss fernhält, trotzdem nahm sie mich eines Tages mit hinab zur Anlegestelle.
Wie aufregend! Vom Fenster aus hatte ich schon oft gesehen, wie die Glisser anlegten, um etwas abzuladen oder mitzunehmen, aber dies war das erste Mal, dass ich das Gliss aus der Nähe sah. Staunend stand ich vor dem Band, das mir ungeheuer breit vorkam, ein Band aus milchig weißem Grau, wie fest gewordener Rauch.
Wir waren allein, die anderen waren alle bei der Arbeit am Wasserloch. Auch der Glisspfad lag leer und verlassen da. Großmutter ließ sich an seinem Rand nieder, mühsam, denn sie war eine alte Frau, und ich hockte mich erwartungsvoll neben sie. »Fass es an!«, sagte sie, während sie es selbst berührte, und so beugte ich mich vor und patschte mit beiden Händen darauf.
Ich weiß noch, dass ich erschrak, weil es sich so glatt anfühlte. Es war, als könnten meine Hände davonsausen, wenn ich nicht aufpasste. Das Gliss war rutschiger als die Steinplatte in unserer Küche, wenn Mutter sie einölte, um Ölkuchen zu machen, und irgendwann rief: »Ajit, bei allen Sternen, nimm die Hände da weg, das wollen wir essen!« Ja, das Gliss war sogar rutschiger als die Seife, die ich manchmal durch die nasse Waschwanne sausen ließ, sobald das Wasser abgelassen war.
Bis auf den heutigen Tag gruselt es mich, Gliss anzufassen. Berührt man es überhaupt je wirklich? Die Hand scheint immer eine Winzigkeit darüber zu bleiben, egal, wie stark man drückt. Vielleicht kann man deshalb auch nicht sagen, ob es kalt oder warm ist; irgendwie ist es keins von beidem.
»Das Gliss bedeckt fast unseren gesamten Planeten, und es ist rutschiger als alles, was wir kennen«, erklärte mir Großmutter. »Daher der Name. Tatsächlich gibt es auf Gliss überhaupt keine Reibung. Wir wissen nicht, wie so etwas möglich ist, aber wir wissen, dass es so ist. Man kann es messen.«
Ich verstand damals nicht, was sie damit meinte und wieso sie es so nachdenklich sagte. Dass das Gliss das große Wunder unserer Welt ist, habe ich erst später begriffen.
»Pass auf, Ajit.« Sie setzte einen Stein auf das Gliss und gab ihm einen Schubs in Richtung der Brücke. Die Brücke ist eigentlich eine Barriere, weil wir die letzte Siedlung im Feuchten Land sind; sie verhindert, dass ein Glisser versehentlich hinaus in die Weite gerät. Aber unter ihr ist freier Raum, und dort rutschte der Stein hindurch, ohne langsamer zu werden.
Ich sprang auf, weil ich sehen wollte, was weiter geschah. Großmutter folgte mir, bedächtig, denn sie lebte damals schon in ihrem neunten Quart. Als wir von der Brücke aus dem davongleitenden Stein nachsahen, sagte sie: »Er wird weiterrutschen, bis er auf ein Hindernis trifft. Und wer weiß, wann das passiert? Dort hinten beginnt die Weite, und wir wissen nicht, ob es da draußen noch einmal Land wie das unsere gibt. Gut möglich, dass der Stein den ganzen Planeten umrundet und am Ende auf der anderen Seite ankommt, in Ostheim womöglich.« Sie deutete dabei hinter sich, in die Richtung, der wir den Rücken zukehrten.
»Auch!«, rief ich und wollte ebenfalls einen Stein auf die Reise schicken.
Aber Großmutter hatte anderes mit mir vor.
»Ich zeig dir was«, sagte sie. Wir gingen zurück zur Anlegestelle. Dort steckte sie mir einen dicken Stein in die Tasche, holte von irgendwoher eine lange Stange – dort liegen immer einige Stakstangen, falls die Glisseure Ersatz brauchen –, hielt mir ein Ende hin und befahl: »Halt dich fest.«
Gewohnt, ihr zu gehorchen, tat ich es, und im nächsten Moment schob sie mich hinaus auf das Gliss. Nicht weit, drei, vier Schritte, die halbe Länge einer Stakstange, aber mir kam es schrecklich weit vor. »Jetzt lass los«, sagte sie, und als ich das trotz meiner Angst tat, war das Erste, dass ich ausrutschte und hinfiel.
»Jetzt komm zu mir!« Großmutter breitete lockend die Arme aus, aber an Laufen war nicht zu denken. Ich schaffte es nicht einmal, mich aufzusetzen. Also versuchte ich zu krabbeln, doch auch das klappte nicht. Immer wieder rutschte ich aus und fiel hin. Schließlich verlegte ich mich aufs Robben, aber ganz gleich, was ich machte, ich kam nicht vom Fleck. Ich strampelte, ruderte, versuchte, die Finger ins Gliss zu krallen, doch ich bewegte mich kein bisschen. Panische Angst erfüllte mich, hier draußen bleiben zu müssen, kaum vier Schritte von meiner Großmutter entfernt, und Tränen liefen mir über die Wangen.
»Ajit!«, rief Großmutter.
Ich strampelte und schluchzte, und hätte ich einen Ton herausgebracht, ich hätte um Hilfe geschrien. So klein ich auch war, verstand ich doch, dass ich nicht von der Stelle kam, weil das Gliss so rutschig war. Und ich verstand nicht, warum Großmutter mir nicht einfach wieder den Stock hinhielt, mit dem sie mich ins Verderben geschoben hatte.
»Ajit«, rief sie wieder. »Hör mir zu. Ich hab dir einen Stein in die Tasche gesteckt, erinnerst du dich?«
Meine Hand schlug wie von selbst auf die Hose, dorthin, wo ich den Stein spürte. »Ja-ha-ha«, schluchzte ich.
»Hol ihn heraus, und wirf ihn dort hinüber!« Sie deutete auf die gegenüberliegende Seite des Glisspfads, wo das Braungras hochstand.
Ich verstand nicht, was das sollte, folgte aber Großmutters Anweisung. Ich warf den Stein mit all meiner verzweifelten Kraft – und etwas Wundersames geschah: Ich bewegte mich! Ohne jede weitere Anstrengung glitt ich in die entgegengesetzte Richtung davon, auf Großmutter zu und vor allem zum Rand des entsetzlichen Glisspfads.
Ich hielt den Atem an, wagte nicht, mich zu rühren, bis ich endlich den Boden erreichte, auf dem man laufen konnte. Großmutter nahm mich hoch und trocknete meine Tränen ab.
Jeder andere Erwachsene hätte mir wahrscheinlich einen Vortrag gehalten, dass ich nun gesehen hätte, wie gefährlich das Gliss sei und dass ich mich davon fernhalten solle, bis ich groß genug war, um den Umgang damit zu erlernen. Doch Großmutter tat nichts dergleichen. Sie kannte mich und wusste, dass ich das alles längst verstanden hatte.
Stattdessen erklärte sie mir: »Als du den Stein mit aller Kraft von dir weggeschleudert hast, hat dieselbe Kraft auch auf dich eingewirkt. In der Physik sagt man, dass du damit einen Impuls auf dich ausgeübt hast, der genauso groß war wie der Impuls, den du auf den Stein ausgeübt hast. Das nennt man das Raketenprinzip. Mit seiner Hilfe sind unsere Vorfahren einst auf diese Welt gelangt.«
Aus irgendeinem Grund musste ich an dieses lange zurückliegende Erlebnis denken, als ich sah, wie Phils große Schwester ihm etwas zuflüsterte und er daraufhin die Augen aufriss.
Was nur heißen konnte, dass es so weit war.
»Sie kommen«, raunte er mir zu. »Lynn sagt, von Knick aus kann man sie schon sehen.«
»Dann los«, gab ich zurück.
Der Saal unseres Gemeindehauses war voll bis auf den letzten Platz und dröhnte von all den Stimmen und dem Geschirrgeklapper. Niemandem würde es auffallen, wenn Phil und ich uns davonstahlen.
Es war die Mannbarkeitsfeier meines Cousins Nagendra, den ich so wenig leiden konnte wie er mich. Nagendra, dem seine Eltern alles reinstopften, weil er ihr einziges Kind war, und der irgendwie auch immer verdammtes Glück hatte: So herrschte heute, an seinem großen Tag, natürlich strahlend schönes Wetter – der Himmel leuchtete in warmem Sandbraun, der Wind wehte ruhig, kein Nebel weit und breit. Auch die Insekten, die uns an manchen Tagen in dichten Schwärmen überfallen, schienen vom Antlitz der Welt verschwunden zu sein.
Zu allem Überfluss sah Nagendra auch noch gut aus. Ich hatte die ganze Zeit vermieden, zu Majala hinüberzuschauen, die ihn nicht aus den Augen ließ. Die starke Majala, wie man sie nannte. Für mich war sie die schöne Majala, und dafür, dass sie in Nagendra verliebt war, hasste ich meinen Cousin am allermeisten.
Und er war sogar schlau. Als er zur Aufnahmeprüfung der Universität zugelassen wurde, habe ich wie viele gedacht: Na, kein Wunder, wo sein Vater der Lehrer bei uns ist. Aber dann hatte Nagendra tatsächlich bestanden, sogar mit Auszeichnung. Und nun würde er, als Erster aus unserem Ort und als einer von wenigen aus dem Feuchten Land, an die Universität von Hope gehen, gleich im Anschluss an die heutige Feier.
Seine Mutter platzte vor Stolz. Sie saß nicht einfach neben ihrem Sohn, sie thronte dort regelrecht, herausgeputzt mit allem, was ihr Kleiderschrank zu bieten hatte. Und sie hatte eigens einen Glisser aus Hope gemietet, der ihren Liebling wohlbehalten in die Hauptstadt bringen würde.
Kurzerhand hatten Phil und ich beschlossen, diesen Plan durcheinanderzubringen. Ich sehe vielleicht nicht so gut aus wie mein Cousin, aber blöd bin ich auch nicht.
Und heute war die Gelegenheit, das allen zu beweisen.
Der Augenblick war günstig. Der immer gut aufgelegte Raùl stimmte gerade ein Lied auf seiner Gitarre an, eine Art Lobgesang auf den größten Helden des gesamten Feuchten Landes, und ich wollte ohnehin nicht sehen, wie Majala begeistert Beifall klatschte.
Phil und ich glitten unauffällig von unseren Stühlen. Mein Herz klopfte heftig, vor Aufregung, vor Anspannung – und vor Vorfreude: Was würden sie gleich für Gesichter machen!
Doch kaum waren wir im Flur, versperrte uns jemand den Weg, zu allem Überfluss niemand anders als meine Mutter!
Sie hatte Namrata im Arm, meine jüngste Schwester, die wie immer quengelte und schniefte. Mutter hatte ihr wahrscheinlich gerade die Windel gewechselt. »Wo wollt ihr denn hin?«, fragte sie und sah mich dabei mit diesem durchbohrenden Mütterblick an, der bis auf den Grund der Seele dringt.
»Wir müssen was erledigen«, erwiderte ich lahm, während Phil nichts sagte. Klar, war ja auch nicht seine Mutter.
»Ihr wisst aber, dass wir Nagendra bald verabschieden müssen? Er ist dein Cousin, Ajit. Egal, ob ihr euch versteht oder nicht, es gehört sich, dabei zu sein.«
»Jaja«, erwiderte ich. Bei allen Sternen, wir hatten es eilig! Wenn ein Glisser von Knick aus zu sehen war, dauerte es nicht mehr lang, bis er bei uns ankam! »Wir werden da sein, versprochen!«
Und wie wir da sein würden!
»Na gut.« Sie ließ uns passieren.
Nun hieß es rennen, das verstand sich ohne ein weiteres Wort. Raus aus dem Gemeindehaus, vorbei an unserem Haus, das auf der anderen Seite der Straße liegt, und … rein ins Buschland. Gut, dass meine Mutter das nicht mehr mitbekam, sie hätte einen Schreikrampf gekriegt. Das Gebüsch, das hier rings um einen mickrigen Wasserriss wächst, hat jede Menge Dornen und kratzige Äste, absolut nicht das Richtige für feine Festkleidung. Ganz davon abgesehen, dass überall Braunbeeren wachsen. Die machen Flecken, die nie wieder rausgehen.
Aber es blieb uns nichts anderes übrig. Die Zeit, uns umzuziehen, hatten wir nicht, und wir mussten ins Buschland.
Das Buschland umschließt nämlich einen der vielen blinden Seitenarme des Glisspfads, und nicht nur das, es verbirgt dessen Ende auch vor neugierigen Blicken. Was gut war, denn dort lag Phils und mein Geheimnis: unser selbst gebauter Glisser.
Er war besser als alle Glisser, die sonst so über die Pfade fuhren, davon war ich felsenfest überzeugt.
Und zwar dank meiner schlauen Erfindung.
Ein Glisser ist im Prinzip ja nichts anderes als ein großer, flacher Holzkasten. Er muss nur schwer genug sein, damit er einem auf dem Gliss nicht unter den Füßen wegrutscht, wenn man sich darauf bewegt. Das ist eine Frage des Massenverhältnisses, hätte Großmutter Neelam gesagt. Auf den meisten Glissern stehen zwei Leute, die ihn antreiben beziehungsweise steuern, indem sie sich mit großen Stangen am Ufer abstoßen.
Was natürlich nur funktioniert, wenn es ein Ufer gibt.
Meistens gibt es eins, Glisspfade sind ja in der Regel eher schmal. Aber manche Abschnitte sind so breit, dass man verloren ist, wenn man liegen bleibt und nur Stakstangen zur Verfügung hat. Von der Keep zum Beispiel, der Strecke zwischen Sonnenblick und Steil, sagt man, sie hieße so, weil Glisseure immer die Luft anhalten, bis sie sie passiert haben.
Gut, auf Gliss bleibt man nicht so leicht liegen. Aber es kommt vor. Zum Beispiel kann einem ein Stein entgegenkommen und einen treffen: Wenn man selber nur langsam dahingleitet – äußerst ratsam beim Glissen –, der Stein aber schnell ist, können sich die Kräfte beim Aufprall gerade ausgleichen, und zack, steht man da.
Irgendwas kann immer unterwegs sein auf dem Gliss. Es wird zwar nie schmutzig, weil ja nichts daran haftet, aber alles, was darauf fällt oder vom Wind darauf geweht wird, bleibt in Bewegung, bis es irgendwo ankommt.
Doch das, so mein Plan, würde nun alles anders werden, dank des Ajit-Chaudari-Glissers!
Wir hatten Frau Guo eine alte Tür abgeschwatzt, als sie ihr Haus hatte renovieren lassen, und mit Holzresten einen breiten Rand draufgenagelt. Majalas Vater, der als Techniker unter anderem für die Windräder zuständig ist, die unseren Ort mit Strom versorgen, hatte uns seinen alten Prüfpropeller überlassen. Das ist ein Gerät, mit dem man die Windverhältnisse an einem Ort prüft, ehe man ein richtiges Windrad aufstellt. Er hatte ein neues, besseres Instrument bekommen, und das alte Ding hatte nur noch bei ihm herumgestanden.
Der Propeller war fix und fertig auf einer Art Turm montiert, komplett mit Gestänge, Zahnrädern und Kette. Ich hatte nur dort, wo das Zählwerk gesessen hatte, einen Handgriff anschrauben müssen, mit dem man den Propeller ankurbeln konnte, und dazu einen Hebel, um den Propellerkopf zu schwenken: Das war ein bisschen kompliziert gewesen, und beinahe wären wir mit unserer Bastelei nicht rechtzeitig fertig geworden.
Aber nun hatte es doch noch geklappt. Als wir, zerkratzt und außer Atem, die letzten Büsche vor dem Versteck beiseitebogen, lag er vor uns, unser Glisser mit Propellerantrieb!
Gut, der Kasten war ein bisschen zu klein und zu leicht, der Propellerturm unnötig hoch, und zu einer Probefahrt hatte es nicht mehr gereicht. Aber vom Prinzip her würde er funktionieren. Daran zweifelte ich keine Sekunde. Wir würden auf dem Gliss fahren, ohne uns am Ufer abstoßen zu müssen, denn wir stießen uns an der Luft ab – und Luft gab es überall!
Ein Gefühl glühenden Triumphes erfüllte mich. Ich sah nicht nur den Glisser, ich sah auch schon die verblüfften Augen vor mir, wenn wir damit gleich an der Anlegestelle auftauchen würden. Nicht nur unser Ort würde da sein, sondern auch noch Nagendras Verwandtschaft, sein Onkel aus Dreibuchen, seine Tante aus Felsbruch und so weiter, alle mit Familie.
Alle, alle würden sie staunen. Und weitererzählen, was sie gesehen hatten.
Das Schönste aber würde sein, dass wir Nagendra anbieten würden, ihn mit unserem Glisser nach Hope zu bringen. Und ganz egal, ob er ablehnte oder annahm, er würde in jedem Fall blöd dastehen und wir die Helden sein.
Wobei ich zugegebenermaßen noch nie in Hope gewesen war. Ist ja eine ziemliche Strecke. Aber verfehlen konnte man es nicht; man musste nur dem Glisspfad lange genug folgen.
»Schnell jetzt!«, keuchte Phil und zupfte sich ein paar klebrige Braunbeerenblätter aus den Haaren, die er seit jeher lang trug und im Nacken zusammengebunden. Nicht gerade ideal in den Büschen. »Das war Halim, der angerufen hat. Lynn sagt, er hat den Glisser erst gesehen, als er schon durch die Keep war.« Halim van der Waal war der Verlobte von Phils großer Schwester. Er wohnte in Knick in einem Haus, von dem aus man beide Arme des Glisspfads überblickte.
Wenn das stimmte, hatte der Glisser inzwischen Sonnenblick passiert, womöglich Knick schon erreicht.
Wir mussten uns wirklich beeilen.
»Das schaffen wir«, erwiderte ich. Wir lösten hastig die Stricke, mit denen wir unser Gefährt gesichert hatten, dann schoben wir es behutsam aufs Gliss. Ich hielt es fest, damit es uns nicht entwischte.
»Vorsicht«, sagte ich, als Phil aufstieg.
»Jaja«, meinte er unwillig.
Ich folgte ihm. Beim Aufsteigen gibt man einem Glisser unweigerlich einen Impuls, sich zu entfernen. In unserem Fall war das in Ordnung, wir mussten ja raus aus dem Seitenarm, hinaus auf den Pfad, und hier im Gebüsch ließ sich der Propeller noch nicht drehen.
Phils Augen leuchteten. Er liebt Abenteuer aller Art und lebt auf, wenn was los ist. Darum passen wir so gut zusammen. Er ist es, der mich anstachelt, etwas zu unternehmen, und ich bin es, der es vorher durchdenkt, was eher nicht Phils Stärke ist.
Oder anders gesagt: Er treibt uns an, und ich bremse. Das ist eine gute Kombination.
Kurz vor der Ausfahrt in den Pfad bekamen wir ein paar stachlige Äste zu packen und manövrierten uns mit dem Bug in Richtung Anlegestelle, wie es sich gehörte.
»Also, los«, rief ich dann. »Dreh den Propeller!«
Und Phil erwiderte: »Aye, Captain!«
Keine Ahnung, wieso er das gesagt hat. Es haute mich richtig um. Captain war der höchste Titel, den es gab; der Titel des Mannes, der das Raumschiff kommandiert hat, mit dem unsere Vorfahren hergekommen sind. Ich war stolz, so angesprochen zu werden.
Wahrscheinlich vergaß ich deshalb völlig, dass es meine Aufgabe war zu bremsen, und befahl stattdessen: »Volle Kraft voraus!«
Und Phil kurbelte los wie ein Wilder.
Der Effekt war ungeheuerlich. Der Propeller wirbelte, und wir schossen vorwärts, atemberaubend schnell. Viel schneller, als ich es je erwartet hätte.
»Phil!«, schrie ich. »Das ist zu schnell!«
»Dürre!«, fluchte er. »Und was machen wir jetzt?«
»Dreh rückwärts! Mach schon!« Die Anlegestelle kam schon in Sicht. Die Anlegestelle und die Barriere am Ende des Glisspfads.
Genau wie die Leute vom Fest, die sich gerade versammelten.
»Rückwärts?«, kreischte Phil. »Was meinst du mit rückwärts?«
»Die andere Richtung!«, drängte ich. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. »Andersherum! Damit der Propeller bremst, bei allen Sternen!«
Endlich hatte Phil begriffen, was ich meinte. Er legte sich ins Zeug und drehte die Kurbel in die andere Richtung.
Doch es war schon zu spät. Ja, sie staunten alle, als sie uns heranrasen sahen. Vor allem aber staunten sie, wie wir an ihnen vorbei und mit vollem Karacho auf die Barriere zubretterten.
Die letzten Momente vor dem Aufprall schienen ewig zu dauern. Ich sah die Leute, wie sie dastanden und uns anstarrten. Ich sah Majala, die Augen weit aufgerissen. Ich sah Tante Disha, wie sie empört aufschrie und den Arm um Nagendra legte, als müsse sie ihren Sohn vor uns schützen.
Und ich sah meine Mutter, das Gesicht voller Enttäuschung und Traurigkeit.
Phil kurbelte immer noch, und obwohl ich wusste, dass es zu spät war, klammerte ich mich an die wilde Hoffnung, er würde es irgendwie schaffen, uns rechtzeitig zum Stillstand zu bringen.
Dann knallten wir mit einem dumpfen Laut gegen die Barriere.
Wir prallten zurück und stürzten um. Propellersplitter schossen durch die Luft. Wir fielen aufs Gliss, rutschten davon. Phil sauste heftig strampelnd in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Ich dagegen glitt auf die der Anlegestelle gegenüberliegende Seite des Pfads zu, und das ganz langsam, sodass alle meine Niederlage sehen konnten, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Handbreit um Handbreit näherte ich mich dem Rand, und ich konnte nichts machen. Gar nichts.
Der Rest war nur noch ein langes, peinliches Aufräumen. Sie holten Stakstangen und sammelten auf, was von unserem Glisser übrig war; die Umrandung war weggebrochen, der hölzerne Boden gesplittert. Als sie alles an Land zogen, brach die Verankerung des Propellerturms vollends ab.
Währenddessen näherte sich von Dreibuchen her der Glisser, den Tante Disha bestellt hatte. Ich sah, wie die Glisseure Phil auffischten und dann näher kamen. Elegant und sicher steuerten die beiden hochgewachsenen Männer ihr Fahrzeug. Sie wollten mich auch auflesen, aber Tante Disha rief grimmig: »Das ist nicht nötig!« Woraufhin die Glisseure nur mit den Schultern zuckten und anlegten.
Es war ein prächtiger Glisser – groß, schwer, mit breiten Sitzen, kunstvoll verziert und in den Farben Hopes lackiert: Schwarz, Orange, Braun. Schwarz für das Weltall, aus dem wir kommen, Orange für die Sonne, die uns bescheint, und Braun für das Land, auf dem wir leben. Doch Phil saß wie ein Häufchen Elend darin und stieg fluchtartig aus, kaum dass sie angelegt hatten.
Ich lag währenddessen immer noch auf dem Gliss und rutschte jämmerlich langsam auf das andere Ufer zu. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, traf meine Hand auf festen Grund. Ich zog mich an Land und stapfte durch das wuchernde Braungras die Böschung hoch. Mit hängenden Schultern wanderte ich in Richtung Barriere, wohl wissend, dass mich auf der anderen Seite heftige Vorwürfe und schmerzhafte Strafen erwarteten.
Schon von hier drüben aus konnte ich sehen, wie Phil von seinen Eltern ausgeschimpft wurde. Bestimmt hielten sie ihm wieder vor, dass sein Vater immerhin der Dorfmeister war und seine Mutter die Hebamme für Letz, Dreibuchen und Knick und deswegen jede Verfehlung ihrer Sprösslinge besonders peinlich – eine Logik, die mir noch nie eingeleuchtet hatte und Phil erst recht nicht. Aber dies war zweifellos nicht der Moment, darüber zu diskutieren.
Mein Vater nahm mich in Empfang. »Junge!«, schnaubte er. »Was soll dieser Unfug?«
»Ein Windrad!«, hörte ich einen der Glisser spotten. »Was haben die gedacht, warum wir das nicht so machen?«
Meine Mutter begegnete mir mit jener erdrückenden Traurigkeit, die sie so oft erfüllt, auch wenn man sie ihr nur selten ansieht. »Ach, Ajit, wie konntest du nur …?«, seufzte sie. »Schau nur, was für ein Durcheinander ihr angerichtet habt! Meine Schwester wird mir ewig Vorwürfe machen.«
In der Tat, es herrschte ein richtiger Tumult. Die einen waren in ihren edlen Jacken und feinen Kleidern damit beschäftigt, die Überreste unseres Glissers zur Seite zu schaffen, andere räumten das Gliss frei, indem sie die Trümmer des Propellers mit Stakstangen wegstießen, und alle waren aufgeregt. Niemand dachte mehr daran, dass wir ein Spalier bilden sollten, durch das Nagendra, der Großartige, huldvoll zu seinem Glisser schreiten konnte. Unvergesslich hatte dieser Augenblick werden sollen – na ja, unvergesslich war er auf jeden Fall. Nur eben anders, als Tante Disha es geplant hatte.
Ich sah Nagendra lachen. Er redete beruhigend auf seine Mutter ein, die mir immer wieder vernichtende Blicke zuwarf. Wahrscheinlich tat ich gut daran, ihr in nächster Zeit aus dem Weg zu gehen. So ungefähr ein, zwei Quart lang. Mindestens.
Das unbeschwerte Lachen meines Cousins war allerdings nur gespielt. Nachdem er sein Gepäck an Bord des Glissers gehievt hatte, kam er zu mir, packte mich bei den Schultern, zog mich ein paar Schritte beiseite, und als uns die anderen nicht mehr sahen, loderte nackte Wut in seinem Gesicht auf.
»Meine Mutter hat die letzten zehn Fluten damit verbracht, diesen Tag und dieses Fest vorzubereiten«, sagte er gefährlich leise. »Und du hast nichts Besseres zu tun, als diese … diese Nummer da abzuziehen? Was bei allen Sternen hast du dir dabei gedacht? Ich sag dir eins, Ajit – wenn du jemals wieder versuchst, mir in die Quere zu kommen, werfe ich dich eigenhändig raus in die Weite, und dann kannst du von mir aus im Höllenloch verschmachten. Ist das klar, Cousin?«
Ich sagte nichts, sah ihn nur an.
»Ob das klar ist, will ich wissen!«, bohrte er nach.
»Ja«, knurrte ich.
»Gut.« Damit wandte er sich ab, setzte wieder sein falsches Lächeln auf, verabschiedete sich von allen und bestieg endlich den Glisser, der ihn von hier fortbrachte.
Wenigstens das.
Das Höllenloch, in dem mich Nagendra verschmachten lassen wollte, gibt es übrigens wirklich. Die meisten Leute halten es für ein Märchen, aber von meiner Großmutter weiß ich, dass es keins ist.
Und sie hat nie etwas gesagt, das nicht gestimmt hätte.
Im Grunde habe ich alles, was ich weiß, von ihr gelernt. Sie war die Einzige, die sich überhaupt mit mir abgegeben hat. Mein Vater arbeitet die ganze Zeit und ist jemand, dem man eh nichts recht machen kann. Bei meiner Mutter ist es ähnlich – kein Wunder bei vier Kindern und einem Haus. Außerdem hat sie ständig Streit mit ihrer Schwester.
Dass es das Höllenloch gibt, hat mit dem Gliss zu tun. Das Gliss bedeckt den größten Teil unserer Welt, und das Besondere ist, dass es völlig eben ist. Überall, an jeder Stelle, die wir kennen, ist es ganz genau gleich hoch. Deswegen ist es auch die Basis der Höhenmessung. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Helle Brocken, der Berg hinter der Siedlung Steil, sei dreihundert Meter hoch, dann bedeutet das, dass seine höchste Erhebung dreihundert Meter über dem Gliss liegt.
Aber nun ist es so, dass unsere Welt der Sonne ja stets dieselbe Seite zuwendet. Die eine Hälfte des Planeten ist also immer beleuchtet, auf der anderen herrscht ewige Dunkelheit. Das Land, das wir bewohnen, liegt in dem schmalen Band dazwischen. Deswegen sehen wir die Sonne immer in derselben Richtung und nur die Hälfte von ihr, mal höher, mal niedriger über den Horizont ragend. Abgesehen von den Flutnächten natürlich, in denen sie ausnahmsweise ganz untergeht und es auch bei uns dunkel wird.
Das ist der größte Unterschied zur alten Welt, der Erde. Wenn die Überlieferungen stimmen, hat sich die Erde innerhalb von vierundzwanzig Stunden einmal um sich selbst gedreht, und man brauchte keine Abendglocke, um zu wissen, dass Nacht ist – man hat es gesehen, weil es einfach dunkel wurde.
»Daher stammen unsere Zeitbegriffe«, hat Großmutter mir einmal erklärt, als ich noch ziemlich klein war. »Die Drehung der Erde um sich selbst, das war ein Tag. Und der Umlauf der Erde um die Sonne, das war ein Jahr. Und ein Jahr hat 365 Tage gedauert.«
»Haben wir auch Jahre?«, fragte ich. Ich war damals nicht nur ziemlich klein, sondern auch noch ziemlich ahnungslos.
Sie wiegte den Kopf hin und her. »Wie man’s nimmt. Unser Planet umkreist unsere Sonne natürlich ebenfalls, aber nach den Zeitmaßen der Erde dauert ein Umlauf nur 9,9 Tage. Das ist zu kurz, um es ein Jahr zu nennen, findest du nicht?«
»Wie nennen wir es dann?«
»Na, überleg mal. Wenn du schlafen gehst, ziehst du den Vorhang vors Fenster, weil es draußen hell ist – außer in der Flutnacht. Und das ist immer die zehnte Nacht, nicht wahr?«
In meinem Kopf knisterte es, als ich anfing zu begreifen. »Eine Flut ist also ein Jahr bei uns?«
»Astronomisch gesehen, ja. Doch wenn wir den Begriff verwenden, meinen wir ein Erdjahr, das fast 37 Fluten entspräche. Eine unpraktische Zahl, finde ich.«
Ich dachte darüber nach. Ein bisschen rechnen konnte ich schon, aber mit 37 malnehmen oder durch 37 teilen, das konnte ich noch nicht. »Wie alt wäre ich denn in Erdjahren?«, fragte ich.
»Hmm«, meinte sie. »Du feierst bald deinen Dreihunderter, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich stolz. »In neunzehn Tagen.«
Sechshundert Fluten nach der Geburt feiert man die Mannbarkeit beziehungsweise bei Mädchen die Fraubarkeit, und dann ist man erwachsen. Die Hälfte davon wird auch gefeiert, bloß nicht so groß, und danach gilt man als halb erwachsen; man ist ein »Halber«, wie manche Leute sagen.
Großmutter zog ihr Notizbuch aus der Tasche und einen Stift und fing an zu rechnen. »Das bedeutet, seit deiner Geburt sind 297 Fluten gekommen. 297 mal 9,9, geteilt durch 365 …« Ihr Stift kratzte über das Papier. »Acht Jahre alt wärst du auf der Erde. Acht Jahre und ein bisschen.«
»Acht Jahre«, wiederholte ich.
Die Zahl kam mir seltsam vor. Das klang so alt! Über einen uralten Menschen sagte man, er lebe in seinem achten Quart.
»Was ist ein Quart eigentlich?«, fragte ich.
»Ein Quart ist ein Viertel von tausend Fluten«, erklärte Großmutter. »In Erdenzeit umgerechnet nicht ganz sieben Jahre.«
»Und du lebst in deinem neunten Quart? Wie alt wäre das in Erdjahren?«
Da tätschelte sie mir den Kopf und sagte: »Lass uns von etwas anderem reden.«
Auch ich wollte ja von etwas anderem reden, nämlich vom Höllenloch. Eigentlich, so hat es mir Großmutter bei einer anderen Gelegenheit erzählt, müssten auf unserem Planeten noch viel wildere Stürme toben, als wir sie erleben: Auf der Sonnenseite ist es ja immer schrecklich heiß und auf der Nachtseite dafür schrecklich kalt. Heiße Luft steigt nach oben, deswegen muss unten Luft nachströmen, und das kann nur kalte Luft von der Nachtseite sein. Doch auf der Sonnenseite wird es nicht ganz so heiß, wie es werden müsste, und auf der Nachtseite nicht ganz so kalt. Man vermutet, dass das am Gliss liegt. Auf alten Aufnahmen aus der Zeit, als sich das Große Schiff unserem Planeten genähert hat, sieht man, dass die gesamte Sonnenseite von Gliss bedeckt ist – damals wusste man natürlich noch nicht, womit man es zu tun hatte –, und es gibt Messungen, laut denen das Gliss an der Stelle, die der Sonne direkt zugewandt ist, tiefer liegt als anderswo.
»Und zwar wesentlich tiefer«, erklärte mir Großmutter. »Über hundert Meter. Das ist gravierend. Weißt du, wieso?«
Ich überlegte. »Weil man nicht mehr rauskäme?«
Sie lächelte dieses kleine, stolze Lächeln, das sie immer zeigte, wenn ich eine Antwort fand, die sie mir noch nicht zugetraut hätte. »So ist es. Stell dir vor, du rutschst über das Gliss, du rutschst und rutschst und wartest darauf, dass endlich wieder Land kommt – aber plötzlich gelangst du an eine Stelle, an der es abwärts geht! Du hast ja nichts, woran du dich festhalten kannst! Also gleitest du hinab und gerätst in eine Kreisbewegung, aus der du nie wieder herauskommst.« Um ihre Worte zu unterstreichen, malte sie mit der Hand Kreise in die Luft, viele Kreise, hörte gar nicht mehr auf. »Da saust du also herum und herum. Du kommst da nie wieder heraus, und du wirst auf dem Gliss auch niemals langsamer. Die Sonne steht über dir und brennt mit ihrer ganzen Kraft auf dich herunter, bis du vertrocknest!« Großmutter faltete die Hände. »Deshalb nennt man diese Stelle das Höllenloch.«
Als Großmutter in ihr zehntes Quart kam, starb sie.
Das war ein Schock. Klar, ich hatte gewusst, dass Menschen irgendwann sterben – aber doch nicht Großmutter Neelam! Doch nicht der einzige Mensch, der mich je ernst genommen hatte! Bei ihr hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass die Dinge, die ich mir ausdenke, einen Wert haben und nicht nur Spielerei sind oder, wie Vater es nennt, Spinnerei.
Sie war eines Tages krank geworden und hatte sich ins Bett gelegt. Belinda McGillis, unsere Medizinfrau, war gekommen und hatte ihr Säfte verordnet, und ich ging davon aus, dass Großmutter bald wieder gesund sein würde, wie immer.
Doch es kam anders. Ein paar Tage später ließ mich Großmutter zu sich rufen, schickte alle anderen hinaus, um mit mir allein zu reden. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie klein und grau im Gesicht in ihrem Bett lag, verschwitzt und mit einer Haut, die aussah wie dünnes Papier. Es roch seltsam in ihrer Kammer, und es war düster, weil der Nachtvorhang halb zugezogen war.
»Ajit«, flüsterte sie mit heiserer Stimme, »ich will dir etwas geben, aber das bleibt unser Geheimnis, ja?«
Ich nickte, worauf sie ein Buch hervorzog. »Das stammt noch von der Erde. Es ist eine Einführung in die Physik, vor allem in die Mechanik. Es hat meiner Urgroßmutter Purnima gehört, die auf dem Großen Schiff geboren wurde. Sie musste ihre Bücher hergeben, als die Universität gegründet wurde, doch das hier hat sie behalten.« Sie reichte es mir. »Es soll von nun an dir gehören.«
»Mir?« Ich nahm es, ziemlich verdattert. »Aber … brauchst du es denn nicht mehr?«
Sie lächelte wehmütig. »Nein, mein Kind. Ich brauche es nicht mehr.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. In meiner Verlegenheit schlug ich das Buch auf und blickte in das Gesicht eines streng dreinblickenden Mannes mit langen, wallenden Locken.
»Ah«, meinte Großmutter. »Sir Isaac Newton. Er hat vor über zweihundert Quart die Grundlagen der Mechanik geschaffen. Ohne ihn wären wir nicht hier.«
Zweihundert Quart! Diese Zahl verschlug mir den Atem.
Großmutter ergriff meine Hand, drückte sie schwach. »Lass es dir niemals wegnehmen, Ajit, hörst du? Versteck es. Lies darin. Versuch zu verstehen.« Sie keuchte. »Vor allem lass dir nicht einreden, dass Träume etwas Schlechtes sind. Du bist ein Träumer, das ist wahr, aber das bedeutet nur, dass du Fantasie hast. Und noch nie ist Großes ohne Fantasie entstanden. Auch die Große Reise war einst nur eine Fantasie.«
»Ja«, sagte ich und musste an meinen Vater denken, der mich wegen meiner Spinnerei, wie er es nannte, manchmal auf eine Weise ansah, dass ich das Gefühl hatte zu schrumpfen.
»Du musst lernen, deine Fantasie mit der Wirklichkeit zu verbinden, Ajit«, flüsterte Großmutter. »Dann wirst du Großes vollbringen, ganz bestimmt.«
Ich nickte. Bedrückt. Ohne zu wissen, warum. »Mach ich.«
»Gut.« Sie ließ meine Hand wieder los. »Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen schlafen.«
Ich verabschiedete mich und schob das Buch in mein Hemd. Später versteckte ich es in meinem Nachttisch unter den Schulsachen.
Am nächsten Morgen sagte uns Mutter, dass Großmutter gestorben sei, und ich sah Vater zum ersten Mal weinen.
Danach geriet ganz Letz in Aufruhr. Großmutter wurde in ein graues Tuch gewickelt, man hob droben auf dem Totenfeld eine Grube aus, und Onkel Prabhu, der in unserem Ort nicht nur der Lehrer, sondern auch der Prediger war, erzählte so einiges über Vergänglichkeit und Hoffnung. Dann legten sie Großmutter in das Loch und schütteten es zu. Ian McGillis, der als junger Mann im Steinbruch von Bleich gearbeitet hatte, schlug später eine Deckplatte mit einem vertieften Kreis und einem erhobenen Stern darin und ihrem Namen: Neelam Das, geb. Kramer.
All das durchlebte ich in einem Zustand äußerster Verstörung. Es kam mir vor wie ein böser Traum, aus dem ich einfach nicht aufwachte. Noch Fluten später brach ich in Tränen aus, wenn mich etwas an Großmutter denken ließ. Dass ich Großmutters Kammer bekam und mir nicht mehr ein Zimmer mit meinen beiden kleinen Schwestern teilen musste – Namrata war noch nicht geboren –, war nur ein schwacher Trost. Jeden Abend, wenn ich schlafen ging, dachte ich an unser letztes Gespräch und versuchte, ihren Rat zu befolgen. Zwar hielten mich immer noch alle für einen Spinner, aber ich gab nicht mehr viel darauf.
Und so ließ ich mich später auch nicht von der Idee abbringen, einen Glisser mit Propeller zu bauen. Ach, ich hätte Nagendra so gern gezeigt, wer von uns der schlauere Kopf war! Schade, dass es so in den Schlamm gegangen ist.
Nach Nagendras Abreise ging das Leben weiter wie zuvor. Ich hätte glatt vergessen können, dass es meinen Cousin überhaupt gab, wäre nicht seine Mutter ständig umhergewandert, um allen zu erzählen, wie prächtig sich Nagendra in Hope machte. Dass die Universität sich glücklich schätzte, einen derart begabten jungen Mann unter ihrem Dach zu haben, und so weiter und so fort. Bla, bla, bla.
Doch außer seiner Mutter redete bald niemand mehr von Nagendra. Auch ohne ihn wurde die Abendglocke geschlagen, wenn es Zeit war, schlafen zu gehen. Auch ohne ihn weckte uns die Morgenglocke. Und wir Kinder gingen zur Schule wie eh und je. Onkel Prabhu war unser Lehrer. Er unterrichtete uns im Gemeindesaal, die älteren Kinder vormittags, die jüngeren nachmittags, und mindestens einmal pro Flut schimpfte er über das schlechte Licht. Der Saal hatte nur schmale Fenster, und elektrische Lampen wurden nun mal dunkler, wenn der Wind, der die Windräder antrieb, nachließ.
Phil und ich saßen im Unterricht nebeneinander, ganz vorne, damit Onkel Prabhu uns im Auge behalten konnte. Majala und Sheena saßen hinten und hatten ständig was zu tuscheln. Chao Ma langweilte sich. Lylou Rojas lernte verbissen, hing an Onkel Prabhus Lippen und schrieb trotzdem schlechte Noten, weil sie vor jeder Prüfung viel zu nervös war.
Nachmittags mussten wir oft auf den Feldern rings um das sonnwärts der Siedlung gelegene Wasserloch mithelfen. Am Tag vor einer Flut steht das Wasser im Loch immer schon so hoch, dass es den flachen Rand bedeckt, und dann muss man die Kanäle sauber kratzen, die es auf die Felder leiten sollen. Dabei werden wir schrecklich staubig, deswegen dürfen wir hinterher ins Wasserloch springen. Natürlich nur unter der strengen Aufsicht der Erwachsenen, die darauf achten, dass die Jungs und die Mädchen auf getrennten Seiten bleiben und wir keinen Unfug anstellen. Viel zu früh scheuchen sie uns dann wieder raus, weil sie selbst ins Wasser wollen.
In der Flutnacht, der einzigen wirklichen Nacht, tritt das Wasser über den Rand und überschwemmt die Felder. Großmutter hat mir einmal erklärt, warum das so ist: Die Bahn, auf der unser Planet die Sonne umkreist, ist kein genauer Kreis. Er kommt ihr in der Flutnacht am nächsten, dabei quetscht sie ihn mit ihrer Schwerkraft ein bisschen – und deswegen läuft das Wasser aus den Wasserlöchern über.
In der Flutnacht ist der Himmel wirklich dunkel, alle schlafen besonders gut, und am nächsten Tag ist keine Schule, weil wir alle auf den schlammigen Feldern arbeiten. Wir graben Abflüsse auf, reparieren beschädigte Dämme und so weiter.
Es macht Spaß, durch den Schlamm zu waten, der bei jedem Schritt zwischen den Zehen hochquillt. Hinterher ist man total schmutzig, aber an ein Bad im Wasserloch ist nicht mehr zu denken: Das Wasser ist nach der Flut ganz trübe und aufgewühlt, außerdem sinkt der Wasserspiegel so schnell, dass man dabei zusehen kann. Es würde einen regelrecht hinabsaugen. Also reinigen wir uns an der Waschschüssel im Hof, und hinterher gibt es frische Kleidung.
Das ist unser Lebensrhythmus.
Die Felder sind rings um das Wasserloch angeordnet: Auf dem einen Feld wird gesät oder gepflanzt, auf dem daneben beginnt alles zu wachsen, auf dem nächsten wächst es schon höher, und das letzte Feld ist mehr oder weniger erntereif.
Jeder holt sich, was er braucht. Richtig geerntet wird nur, wenn eine Bestellung kommt, meistens aus Hope. Es gehört zu den Pflichten von Phils Vater als Dorfmeister, das Telefon zu beantworten, solche Bestellungen aufzunehmen und den Transport zu organisieren.
Das macht immer Spaß. Wir ernten, was bestellt wurde – Blaugurken etwa, Möhren, Sternkraut, Steinrüben, Frissa –, packen alles in Kisten und schaffen sie zur Anlegestelle. Währenddessen telefoniert Herr Taylor mit allen Dorfmeistern von hier bis Hope, wann der Glisspfad frei ist. Wenn das geregelt ist, geht es los. Wir legen ein Brett von der Barrikade aus schräg auf das Gliss und zielen – es muss genau auf Knick ausgerichtet sein, das am Horizont zu sehen ist. Dann klemmen wir es fest und setzen die erste Kiste drauf. Sie rutscht runter und gleitet schnurgerade über das Gliss, den ganzen Pfad entlang, immer weiter und weiter.
Die übrigen Kisten schicken wir sofort hinterher. Zack, zack, zack geht das!
In Knick schieben sie ein großes Rundholz raus, das die ankommenden Kisten in Richtung Sonnenblick umlenkt. Ich würde zu gern mal sehen, wie die Kisten die Keep überqueren, eine hinter der anderen – das muss lustig aussehen! In Felsbruch legen sie noch einmal ein Rundholz raus, ab da ist es dann ein gerader Weg bis Hope.
Sobald die letzte Kiste außer Sicht ist, warten wir gespannt auf den Anruf aus Hope, dass alles angekommen ist. Erst danach dürfen die Glisser wieder fahren.
Manchmal läuft es auch andersherum. Tante Disha hat beschlossen – wahrscheinlich weil sie ohne ihren Sohn nicht mehr ausgelastet war –, ihr Haus umbauen zu lassen. Die Steine dafür, die sie im Steinbruch von Steil bestellt hat, wurden auf dieselbe Weise geliefert. Wir standen alle an der Anlegestelle, als sie angesaust kamen, eine schier endlose Reihe, dicht an dicht. Blöderweise tobte gerade einer dieser Stürme, bei denen man das Gefühl hat, sie wehen allen Sand von der Nachtseite herüber. Aber das ist das Seltsame am Gliss: Der Wind geht irgendwie immer drüber weg. Die Steine ließen sich überhaupt nicht irritieren, blieben schnurgerade auf ihrer Linie.
Wir banden uns Tücher vor Mund und Nase, kniffen die Augen zusammen und klaubten die Steine auf, wie sie kamen. Zum Glück hatte jemand ein zusätzliches Brett vor die Barriere gelegt, sonst wären uns etliche in die Weite entwischt.
Die beiden Maurer, die Tante Disha bestellt hatte, kamen natürlich erst, als der Sturm vorbei war, mit einem dicken Glisser voller Werkzeug. Sie hatten fast zwei Wochen zu tun, ehe Tante Disha zufrieden war und sie wieder ziehen ließ.
Viele trauten sich auch ohne alles aufs Gliss. Wenn Phil von seiner Mutter auf die andere Seite des Pfads geschickt wurde, um Braunbeeren zu sammeln, war er oft zu faul, bis zur Brücke zu gehen; er sprang einfach mit dem Hosenboden aufs Gliss und rutschte ans andere Ufer hinüber, und das mit so viel Schwung, dass er drüben gleich wieder auf die Beine kam.
Oder der kleine Vincente Rojas, der mit einem Jungen in Dreibuchen befreundet war: Es gab zwar einen Fußweg dorthin, aber der war ihm zu lang, also hopste er von der Barrikade aufs Gliss und ließ sich einfach bis zur Anlegestelle tragen.
Die Allercoolste aber war Phils große Schwester Lynn. Ihr Verlobter lebte in Knick, und wenn sie ihn besuchen wollte, schwang sie sich einfach auf den Pfad und sauste über das Gliss davon, und weil es eine lange Strecke war, nahm sie meistens was zu lesen mit!
Ich konnte das alles kaum mit ansehen. Wenn Phil mit seinem Sammelkorb aufs Gliss hüpfte, stellten sich mir alle Haare am Körper auf, und wenn ich sah, wie Lynn, auf dem Rücken liegend und in ein Buch vertieft, durch die Enge bei Dreibuchen davonrutschte, musste ich wegschauen.
Ja, ich hatte Respekt vor dem Gliss. Nicht nur, weil mich Großmutter Neelam damals so erschreckt hatte. Aber irgendwie faszinierte mich das Gliss auch. Ich konnte endlos in die Weite hinausschauen, mich in ihrem geheimnisvollen Schimmer verlieren und mir ausmalen, wie es sein mochte, dort draußen unterwegs zu sein. Ich, der ich in meinem ganzen Leben gerade mal bis zum Markt von Sonnenblick gekommen war! Gerade weil ich das Gliss und sein physikalisches Rätsel nicht verstand, beschäftigte es mich und meine Fantasie.
Es war auch meine Fantasie, die mir half, das schrecklich öde Leben in Letz zu ertragen. Das und die Hoffnung, ich würde eines Tages etwas Unerhörtes entdecken oder eine aufsehenerregende Erfindung machen.
Das Leben ging also seinen gewohnten Gang – bis Tante Disha eines Tages mit seligem Lächeln verkündete, ihr Sohn, der unvergleichliche Nagendra, werde uns die Ehre eines Besuchs erweisen.
Ich muss über Nagendra reden. Darüber, warum ich ihn nicht leiden kann und er mich auch nicht.
Alle denken, es liegt an mir. Denn er, er ist doch so ein netter Kerl!
Bloß weiß ich, dass er das nicht ist. Und ich schätze, weil ich das weiß, hasst er mich.
Als wir klein waren, war ich oft zum Spielen bei ihm. Anfangs war ich begeistert, denn Nagendra hatte die besten Spielsachen: einen Ball aus echtem Leder, Holzfiguren von unglaublichen Tieren der alten Welt – Elefanten, Giraffen, Dinosaurier –, dazu Bausteine aus Holz, genug, um ein ganzes Dorf zu bauen.
Bloß wollte Nagendra nie etwas bauen, er wollte immer nur Captain spielen. Und natürlich war er jedes Mal der Captain. Ich musste sein Adjutant sein, ihm etwas zu trinken bringen oder ihm Luft zufächeln, während er sich über Papiere auf dem Tisch beugte und Sachen sagte wie: »Es muss uns gelingen, die Meuterer zu stoppen, sonst verfehlen wir den Zielplaneten. Das wäre unser Untergang!« Daraufhin mussten wir irgendetwas machen, was ich nie richtig verstanden habe. Wir waren ja noch Kinder, und Nagendra war damals fast doppelt so alt wie ich; klar, dass ich mächtigen Respekt vor ihm hatte.
Wenn es ihm zu viel wurde, sich mit mir abzugeben, zwickte er mich, damit ich weinen musste, und sagte zu seiner Mutter: »Ich glaube, Ajit ist müde und möchte nach Hause gehen.«
Später hat er mir erklärt, warum ihn alle so toll finden: »Du musst jemandem nur das Gefühl geben, dass du ihn toll findest. Das ist der ganze Trick. Nimm Raùl. Der zieht mit den Rentieren über die Wiesen und klampft ihnen auf seiner Gitarre was vor. Aber die klatschen ja keinen Beifall, die gucken ihn nur doof an. Wenn ich komme und sage ›Bitte, Raùl, spiel was!‹, gefällt ihm das natürlich. Besonders wenn ich dann so tue, als hätte ich nie etwas Schöneres gehört. Das mach ich zwei, drei Mal, dann ist er überzeugt, dass ich ein prima Kerl bin.«
»Ehrlich?«, sagte ich. Seine Schlauheit beeindruckte mich – und widerte mich zugleich an.
»Frauen und Mädchen musst du einfach nur Komplimente machen«, fuhr er fort. »Je übertriebener, desto besser.«
Ich war nie dabei, wenn er Mädchen Komplimente machte, aber es entging mir nicht, dass er sie alle um den Finger wickelte. Auch, als eines Tages Majala und ihr Vater nach Letz kamen.
Sie stammten aus Zweiwasser im Ostarm, aus einer Gegend, die man die Getreidekammer nennt. Sie kamen, weil Majalas Vater Techniker ist und wir einen brauchten. Pedro, unser alter Techniker, war gestorben, und sie zogen in sein Haus, das letzte vor dem Grat, neben dem Haus der Witwe Guo.
Und sie kamen nur zu zweit, denn Majala, erfuhren wir, hatte keine Mutter mehr. Das beschäftigte uns alle mächtig, weil sich keiner vorstellen wollte, wie es wäre, keine Mutter mehr zu haben.
Majala gefiel mir auf den ersten Blick. Die anderen sahen in ihr in erster Linie ein tüchtiges Mädchen, das sich mit elektrischem Strom auskannte und Leitungen anschließen konnte. Aber ich mochte sie … nun, einfach so. Ich hätte sie am liebsten immerzu angeschaut, hätte gern einmal ihre Hand gehalten oder ihr Haar berührt.
Mit anderen Worten, ich hatte mich in sie verliebt. Ich war nur zu jung, um das zu verstehen, und zu scheu, um irgendetwas daraus zu machen. Im Gegenteil, ich behielt meine Gefühle für mich. Niemand sollte etwas davon merken, am allerwenigsten Majala selbst.
Doch dann ließ auch sie sich von Nagendra bezirzen. Das war ein schwerer Schlag.
Entscheidend aber war die Sache mit meiner Katze.
Großmutter hatte sie mir von einer Fahrt über Hope hinaus mitgebracht, von einem Besuch bei einer Freundin. Sie hat mir auch erzählt, warum man Katzen mit auf die Große Reise genommen hat. Es sind nämlich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Mäuse an Bord des Großen Schiffes gelangt, und man hat keinen anderen Weg gesehen, mit ihnen fertigzuwerden.
Meine Katze hieß Nova. Sie hatte schwarz-weiße Streifen und schlief bei mir im Bett. Von Devika ließ sie sich streicheln, mehr aber nicht, und Indira war noch zu klein und hatte Angst vor ihr – also war es meine Katze! Einmal verteidigte sie sogar mein Bett gegen meine Schwestern.
Nova fand nichts dabei, aus einem Fenster im Obergeschoss zu springen oder über Hausdächer zu wandern, aber vor dem Gliss hatte sie mächtige Angst – wie gesagt, sie war ganz und gar meine Katze. Ihr Fell sträubte sich, wenn sie auch nur in die Nähe des Gliss kam. Einmal versuchte ich, sie über die Brücke zu locken, doch sie machte nur einen Buckel und fauchte.
Eines Tages, als ich am offenen Fenster über meinen Schularbeiten saß, hörte ich Nova in der Ferne so jämmerlich maunzen wie noch nie. Ich rannte sofort hinaus, um nach ihr zu sehen – aber ich fand sie nicht! Ihre Schreie hallten zwischen den Häuserwänden, doch ich konnte nicht hören, woher sie kamen.
Hektisch raste ich die Straße auf und ab und malte mir dabei schreckliche Bilder aus, wie sie sich irgendwo verfangen hatte oder verletzt war.
Doch die Wahrheit war noch viel schrecklicher.
Irgendwann merkte ich, dass die Schreie aus Richtung der Barriere kamen, und lief dorthin. Unsere Barriere, muss man dazu erklären, ist leicht schräg gebaut. Dadurch kann man vom Ort aus nicht sehen, was sich in der äußersten Ecke auf der anderen Seite abspielt.
Genau in dieser Ecke fand ich Nagendra. Er hatte Nova auf das Gliss geschoben und lachte sich halb tot, wie sie sich abstrampelte und dabei in heller Panik kreischte, weil sie kein bisschen vom Fleck kam. Inzwischen klangen ihre Schreie gar nicht mehr nach ihr, und in ihren Augen schimmerte ein irrer Glanz.
»Was machst du da?«, schrie ich Nagendra an. »Was machst du mit meiner Katze?«
»Ich schau zu, wie sie verrückt wird!«, grölte er. »Ist das nicht lustig?«
Ich stieß ihn weg und holte Nova vom Gliss, aber sie war so außer sich, dass sie mir ihre Krallen in die Brust und den Hals schlug – die Narben sieht man heute noch. Vor Schreck ließ ich sie fallen, woraufhin sie davonraste wie der Blitz. Bevor ich mich auch nur umdrehen konnte, war sie im hohen Braungras verschwunden.
Ich habe sie nie wiedergesehen.
Deshalb verabscheue ich meinen Cousin.
Er hasst mich, weil er Angst hat, ich könnte ihn entlarven. Dabei wüsste ich gar nicht, wie. Niemand würde mir auch nur ein Wort glauben.
Schließlich brach der große Tag an. Phils Vater hatte den Gemeindesaal auf Hochglanz polieren müssen, Tante Disha hatte ihn eigenhändig dekoriert. Es würde ein Festessen geben, für das Raùl eins seiner Rentiere geschlachtet hatte. Meine Mutter backte Braunbeerenküchlein, eine Köstlichkeit, aber irre aufwendig.
Braunbeeren sind eigentlich orangefarben und wachsen überall wild. Sie sind die einzige Frucht, die auf diesem Planeten heimisch und für Menschen essbar ist, aber die Marmelade, die man daraus kocht, ist legendär zäh. Sie ist so klebrig, dass man Dachziegel damit ankleben könnte. Einen Spritzer Braunbeerenmus auf dem Hemd kriegt man nie mehr raus. Die Töpfe, Gläser und Löffel, die man beim Einkochen benutzt, muss man hinterher zehn Tage lang einweichen, ehe das Zeug wieder abgeht. Aber genau das macht Braunbeerenmus so köstlich: dass man den süßen, ganz eigenen Geschmack eine kleine Ewigkeit im Gaumen spürt.
Schließlich kam Nagendra an, kurz vor der Mittagszeit und mit einem gewöhnlichen Lastenglisser, der außer ihm noch fünfzehn Säcke Getreide, Schachteln mit Nägeln und Schrauben und andere Dinge anlieferte.
»Musste das sein?«, rügte ihn seine Mutter peinlich berührt. »Warum hast du keinen … besseren Glisser genommen?«
»Wenn ich meinen Abschluss habe, dann komme ich mit einem Luxusglisser, Mutter«, erwiderte Nagendra milde lächelnd. »Aber noch nicht jetzt, als gewöhnlicher Student.«
»Er ist so bescheiden«, hörte ich Phils Mutter zu ihrem Mann sagen. »Das bewundere ich an ihm.«
Alle, alle waren an der Anlegestelle, sogar ich. Und alle außer mir bekamen glänzende Augen, als Nagendra sie der Reihe nach mit seinem Charme einsülzte, ihnen Komplimente machte oder sie mit lockeren Witzen zum Lachen brachte.
Zu mir sagte er nur: »Na, Cousin? Keine neue Erfindung heute?«
»Du klingst ja richtig enttäuscht«, gab ich zurück.
Er lachte nur.
Wie groß er war! Er sah schon aus wie ein richtiger Mann; ich war fast erschrocken, als ich ihn aus dem Glisser steigen sah. Er und ich waren nur etwa hundertfünfzig Fluten auseinander: Wenn er nun so erwachsen wirkte, hieß das, dass auch meine Kindheit bald vorüber sein würde.
Die Sonnenscheibe stand tief am Horizont, weil die nächste Flutnacht nahte. Deswegen lag der untere Teil des Orts im Schatten, und wir mussten das Licht im Gemeindesaal anmachen. Bevor die Vorspeisen verteilt wurden, hielt Nagendra eine Rede, was alle enorm beeindruckte, denn so etwas kannte man nur von den Offizieren in der Hauptstadt und ähnlich wichtigen Leuten.
Nagendra erzählte von seinem Leben in Hope, wie viel er lernen musste und wie schwer die ersten Prüfungen gewesen waren. Er hatte sie natürlich trotzdem bestanden.
»Mit Auszeichnung!«, rief Tante Disha dazwischen.
»Ja schon, aber da war ich nicht der Einzige«, fuhr mein Cousin weiter fort, den Bescheidenen zu spielen. Nur um sich gleich darauf damit zu brüsten, dass er mit einigen seiner Professoren inzwischen auch privat verkehrte, dass er mehrmals im Haus des Zweiten Offiziers zu Gast gewesen war und sogar den Captain schon einmal getroffen und ihm die Hand geschüttelt hatte.
»Und er hat dich einen vielversprechenden jungen Mann genannt!«, unterbrach ihn seine Mutter wieder. »Das musst du nicht unterschlagen.«
»Also gut, ich unterschlage es nicht«, meinte Nagendra, und natürlich lachten alle.
Ich nicht. Aber ich hörte mir trotzdem an, was er erzählte, und mir wurde siedend heiß klar, dass ich viel zu lange so getan hatte, als gäbe es nur Letz und die nächsten beiden Orte – und als würde mein Leben für alle Zeit so weitergehen wie bisher. Doch das würde es nicht. Auch ich würde bald meinen Sechshunderter feiern, erwachsen sein und entscheiden müssen, was ich damit anfing.
Wobei die Antwort auf diese Frage ganz einfach war: Ich musste ebenfalls an die Universität gehen!
Ich betrachtete meinen so bestürzend erwachsen wirkenden Cousin und fragte mich, ob ich mich auch so verändert hatte, ohne es zu merken.
Im selben Moment flackerten die Lampen und erloschen.
»Oje«, hörte ich Phils Vater jammern. »Der Ofen! Wenn der jetzt kalt wird, fällt der Nachtisch in sich zusammen!«
Und Tante Disha schrie: »Cornelius! Was ist los?«
Cornelius Winter, das war Majalas Vater. Er sagte: »Ich habe so was befürchtet. Der Wind war die letzten Tage schwach. Heute gab’s richtige Aussetzer. Und die Küche braucht so viel Strom!«
»Aber wir haben doch die Schwungräder!«, wandte Nagendras Mutter ein. Sie klang panisch.
Zum Glück hatte ich diesmal nichts damit zu tun, ihr das Fest zu verderben.
»Die Schwungräder sind aber nur eine kleine Reserve«, meinte Herr Winter. »Ich nehme an, von denen haben wir schon seit Stunden gezehrt.«
Phil und ich sahen uns an. »Was für Schwungräder?«, fragte ich, aber er hob nur ratlos die Schultern.
Majala, die neben ihm saß, bekam es mit. Sie beugte sich zu uns herüber und erklärte leise: »Wenn die Windräder mehr Strom erzeugen, als wir brauchen, treiben wir damit drei Schwungräder an, um ihn zu speichern. Das sind die drei grauen Kästen oben am Grat. Wird der Wind zu schwach, treibt man mit den Schwungrädern einen Generator an, um den fehlenden Strom auszugleichen.«
»Und dadurch werden die Schwungräder wieder abgebremst«, sagte ich sofort, um ihr zu zeigen, dass ich keinesfalls schwer von Begriff war.
»Genau. Bloß werden die auch von selbst langsamer, das ist das Problem. Die letzten Tage war nicht genug Strom übrig, um sie anzutreiben, also stehen sie wahrscheinlich längst. Sonst wär das Licht nicht so plötzlich ausgegangen.«
Frau Taylor brachte Kerzen und verteilte sie auf den Tischen. Ihr Mann beriet sich mit jemandem, was sie machen konnten, um das Essen trotz des Stromausfalls warm zu servieren. Für Notfälle gab es einen Holzofen, aber nur einen kleinen. Holz war zu kostbar, um es einfach so zu verbrennen.
Ich war hin- und hergerissen. Einerseits empfand ich hämische Schadenfreude – andererseits hatte ich Hunger!
In diesem Moment hörten wir, wie das Kühlaggregat summend wieder ansprang. Gleich darauf kam das Licht zurück, und alle atmeten auf. Draußen quietschte ein Fensterladen, was er immer tat, wenn der Wind stark blies.
»Wir lassen die Kerzen trotzdem stehen«, entschied Tante Disha.
»Ich stell den Ofen eine Stufe runter«, meinte Phils Vater. »Das reicht allemal.«
Nagendra, der sich die ganze Zeit, in der es dunkel gewesen war, nicht gerührt hatte, sagte: »In Hope haben wir solche Probleme auch oft. Wir haben zwar wesentlich mehr Speicher und mehr Windräder, aber eben auch mehr Menschen, die Strom verbrauchen.«
»Es hat mit den Flutnächten zu tun, sagt man«, warf Belinda McGillis ein. »In den Tagen davor wird der Wind oft schwächer.«
Während alle anfingen, darüber zu diskutieren, ob das stimmte oder nur Einbildung war, fasste ich einen zweiten Entschluss: Ich wollte nicht nur studieren, ich wollte auch etwas erfinden, das von allgemeinem Nutzen sein würde – einen besseren Stromspeicher!
Ich hatte auch schon eine Idee.
Als es für Nagendra Zeit wurde, nach Hope zurückzufahren, wollte Tante Disha, dass wir ihn alle zur Anlegestelle begleiteten. Dazu hatte ich nun absolut keine Lust und stahl mich unter einem Vorwand davon. Es waren ja nur ein paar Schritte über die Straße zu uns nach Hause. Von dort spähte ich aus dem Fenster, um das Spektakel zu beobachten. Was ich besser gelassen hätte, denn so musste ich mit ansehen, wie Nagendra lange mit Majala redete – und sie schließlich küsste!
Der Schlag saß.
Doch er machte meinen Entschluss, an die Universität zu gehen, nur noch stärker.
Bei der Sache mit der Universität gab es nur ein Problem: Wenn ich dorthin wollte, brauchte ich bessere Noten. Viel bessere Noten. Ich würde richtig lernen müssen. Bisher hatte ich den Unterricht nur über mich ergehen lassen, und entsprechend sahen meine Noten aus.
Nagendra hatte den Vorteil gehabt, dass sein Vater zugleich unser Lehrer war. Zwar hatte Onkel Prabhu bei der Benotung seines Sohns bestimmt nicht geschummelt, aber Nagendra hatte sich alles so oft von ihm erklären lassen können, bis er es kapiert hatte.
Welchen Vorteil hatte ich?
Mir fiel das Physikbuch wieder ein, das mir Großmutter vermacht hatte. Ein Buch, das sonst niemand besaß! Wenn darin etwas stand, das sonst niemand wusste, würde ich einen gewaltigen Vorteil haben!
Mit zittrigen Fingern kramte ich es aus der Schublade, in der es seit Großmutters Tod lag. Ich hatte es seither nicht mehr angefasst, und jetzt, da ich es in Händen hielt, musste ich voller Wehmut an sie denken.
Was sie wohl gesagt hätte zu meinem Vorhaben? Ach, ich wusste es genau. »Mach das, Ajit«, hätte sie gesagt und mir die Wange getätschelt. »Du schaffst das!« Mir war fast, als hörte ich ihre Stimme.
Ich musste lächeln.
Zum ersten Mal sah ich mir das Buch genauer an. Es hatte einen harten Einband, auf dem allerlei mathematische Symbole abgebildet waren, Kugeln, die eine Schräge hinabrollten, und Zahnräder, die ineinandergriffen. Ich schlug es auf und begann zu lesen.
Doch meine Hoffnung erfüllte sich nicht. Es standen dieselben Formeln darin wie in unseren abgenutzten Schulbüchern, die so alt waren wie Letz selbst. Alles wurde ein bisschen besser erklärt, auch wenn die Farben der Zeichnungen verblasst waren. Und man erfuhr allerlei über das Leben und Werk großer Physiker, über Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein und so weiter.
Das Buch war toll, aber es würde mir das Lernen nicht ersparen.
Normalerweise hätte ich vor dieser Aussicht aufgegeben. Doch jeden Morgen, wenn ich zum Unterricht ins Gemeindehaus kam, begegnete ich Majala, und jedes Mal, wenn ich sie sah, musste ich daran denken, dass sie Nagendra geküsst hatte. Das ließ etwas in mir auflodern wie eine Flamme: eine wütende Entschlossenheit, auch auf die Universität zu gehen und es meinem widerlichen Cousin zu zeigen!
Und so setzte ich mich Tag für Tag an die Schulsachen. Las Großmutter Neelams Buch gründlich und konzentriert. Versuchte, es wirklich zu verstehen. Fragte Onkel Prabhu, bis ich es kapierte. Machte die Übungen. Alle.
Das blieb nicht unbemerkt. »Sag mal«, meinte Phil bald, »was ist mit dir los? Wirst du jetzt zum Streber?«
Streber, das war ein schlimmes Schimpfwort. In den Verdacht, ein Streber zu sein, durfte man nicht kommen. Nagendra hatte es geschafft, dass es bei ihm immer so aussah, als fiele ihm alles leicht. Wenn es einem leichtfiel, war man kein Streber, und wenn man einfach nur Glück hatte, auch nicht.
»Quatsch«, erwiderte ich also. »Es interessiert mich bloß.«
»Mathe interessiert dich?« Er sah angewidert aus.
»Das ist nicht einfach nur Mathe«, belehrte ich ihn. »Du musst das im großen Zusammenhang sehen.«
»Was für ein Zusammenhang?«
Da half nur eins: Ich begann, Geschichten zu erzählen.
Ich weiß nicht mehr, wie klein ich war, als ich zum ersten Mal hörte, wie jemand behauptete, dass wir von einer anderen Welt stammten. Einer Welt, die völlig anders gewesen sein sollte. Einer Welt, deren Himmel blau war. Mit einer Sonne, die sich über diesen blauen Himmel bewegte, um jeden Abend zu verschwinden und jeden Morgen wieder aufzutauchen. Ein Himmel, von dem manchmal Wasser herabfiel, das man Regen nannte, bisweilen so viel davon, dass es Dörfer und Städte überschwemmte und Menschen darin ertranken. Ja, so viel Wasser soll es auf dieser Welt gegeben haben, dass es riesige Seen, Meere, Ozeane bildete – Wasserlöcher, so groß, dass man nicht vom einen zum anderen Ende schauen konnte!