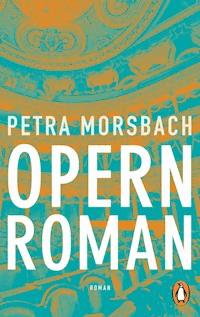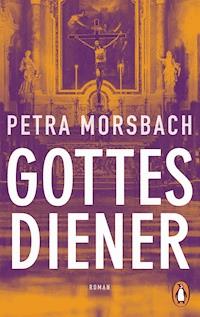
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Irrungen und Wirrungen eines katholischen Provinzpfarrers
Isidor Rattenhuber, geschlagen mit roten Haaren, einem hartnäckigen Stottern und seiner Herkunft aus einem armen, lieblosen Elternhaus, wird Priester, um all dem zu entgehen. In der Liturgie erlebt er Ordnung und Geborgenheit, beim Vorlesen der Heiligen Schrift verliert sich sein Sprachfehler. So wirkt er jahrzehntelang in einer kleinen Gemeinde namens Bodering, lernt innerhalb und außerhalb des Beichtstuhls die Schicksale und Sünden seiner Schäfchen kennen, hadert mit der Einsamkeit und den veralteten Strukturen der Kirche. Und verliert zum Schluss beinahe, was ihm all die Jahre Motor war: den Glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
PETRA MORSBACH, geboren 1956, studierte in München und St. Petersburg. Sie lebt als freie Schriftstellerin in der Nähe von München. Ihre Romane werden von Kritikern hochgelobt, ihr Werk wurde mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet. 2017 erhielt sie für »Justizpalast«, für den sie über neun Jahre lang recherchierte, den Wilhelm-Raabe-Preis.
Petra Morsbach in der Presse:
»Voller Komik und göttlicher Ironie, dabei beseelt von einem unzeitgemäßen existentiellen Ernst … ein begnadeter Roman.«Frankfurter Allgemeine Zeitung
»›Gottesdiener‹ ist ein Beispiel, dass intelligente Bücher nicht wehtun müssen. Man kann sich dabei auch bestens unterhalten.«WDR
Außerdem von Petra Morsbach lieferbar:
Petra Morsbach, Plötzlich ist es Abend Petra Morsbach, Opernroman Petra Morsbach, Justizpalast
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Petra Morsbach
GOTTESDIENER
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2009 by Petra Morsbach Genehmigte Taschenbuchneuausgabe im Penguin Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Der Titel erschien erstmals 2004 im Eichborn Verlag, Frankfurt/Main. Umschlaggestaltung und Umschlagmotiv: www.buerosued.de ISBN 978-3-641-24689-1V001
www.penguin-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Priester:
Hochwürdiger Vater, die heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen.
Bischof:
Weißt du, ob sie würdig sind?
Priester:
Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt;
ich bezeuge, daß sie für würdig gehalten werden.
Aus der Liturgie der Priesterweihe,
Advent
Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, also mach wenig Worte!
(Koh 5,1)
Heute, ausgerechnet am letzten Adventssonntag, hat er einen dummen Fehler gemacht; zumindest sieht es so aus. Nachfragen darf er nicht, also hadert er.
Was ist passiert? Er hat nach der Abendmesse Frau Danninger beleidigt, weil er gereizt und müde war. Zwar hat sie ihn herausgefordert, aber er hätte sich nicht herausfordern lassen dürfen. Frau Danninger ist eine emsige Christin, nichts Schlechtes über sie!, aber sie hat ein unheimliches Gespür für alle Empfindlichkeiten ihrer Mitmenschen, da muß sie einfach losbohren, sie kann nicht anders, und dann saugt sie sich fest. Mittags auf der Straße hatte sie ihn auf die nächste Osterwallfahrt angesprochen, geh, fahr ma doch nächstes Jahr nach Konnersreuth! Er, angespannt vor dem Marathon der Weihnachtswoche, wollte erstens überhaupt nicht mit ihr über Ostern sprechen, zweitens nicht von einer Wallfahrt und drittens schon gar nicht von Konnersreuth. Er sagte knapp: »Hier in Bodering kann man genausogut beten!« und ließ sie stehen. Mehrere Adventstermine standen an: Seniorenweihnacht der Freiwilligen Feuerwehr, ein Ministrantengespräch, Stallweihnacht in Zwam mit Ansprache, Abendgottesdienst. Nach dem Abendgottesdienst aber, als er aus der Seitentür der Kirche auf den verschneiten Friedhof trat, ist Frau Danninger ihn richtig angesprungen: Warum er nicht zur heiligen Resl will? Ob er was gegen die hätte? Den Raucherkrebs von ihrem Schwager hätt’ die geheilt, wär’ das nicht zu ihrer aller Bestem?
Er hätte wissen müssen, daß sie nicht locker läßt. Er war nicht geistesgegenwärtig. Er hatte Hunger und wußte, wenn Frau Danninger das Diskutieren anfängt, hört sie nicht wieder auf, also hat er ihr das Wort abgeschnitten: Sie könne jederzeit nach Konnersreuth fahren, er müsse ja nicht mit. Sie sagte, sie wollten aber alle zusammen ... »Bei uns ist die Kirch leer!«, schnauzte er. »Wenn Ihr hier keine Gemeinschaft findet, findets in Konnersreuth auch keine!«, und das war der schwerste Fehler: daß er »Ihr« gesagt hat. Auf einmal merkte er nämlich, daß sie Zuhörer hatten. Leute waren stehengeblieben, einige, die schon am Tor gewesen waren, drehten wieder um: Sie lassen sich von Frau Danninger ganz gern unterhalten.
Nun standen sie also da in der dunklen, feuchten Kälte, bliesen Atemwolken in die Luft und stampften mit den Füßen. Er musterte die Gruppe rasch: Tatsächlich waren einige notorische Wallfahrer darunter; die schauten verletzt drein. Die anderen hatten sich noch nicht entschlossen, ob sie nur neugierig oder auch vorwurfsvoll sein sollten. Ihm war unbehaglich. Seine Autorität besteht darin, daß sie glauben, er wisse Dinge, die sie nicht wissen und auch nicht wissen wollen; trotzdem oder gerade deshalb aber darf er sie nicht erniedrigen, sonst setzen sie sich zur Wehr, und das ist auch richtig so. Die Empfehlung des Bischofs für solche Anwandlungen lautet, unauffällig auf die Bremse zu treten, denn einerseits soll der Fehlglaube eingeschränkt, andererseits die Volksfrömmigkeit nicht frustriert werden. Er dachte kurz nach und sagte dann: Es sei spät, er sei müde, Weihnachten stehe bevor, danach könne man über Ostern reden. Pfüa Gott. Er verabschiedete sich von allen per Handschlag. Dann ging er zurück in die Sakristei und zog seine Albe aus, hängte sie zusammen mit der Stola in den Schrank, faltete das Schultertuch zusammen und gab es der Mesnerin, die es dankenswerterweise waschen wollte. Er schlüpfte in seine Wolljacke und lief über den Friedhof zum Pfarrhaus, dann die Treppe hinauf direkt in die Küche. Seit halb elf Uhr vormittags hatte er nichts gegessen, ein Termin nach dem anderen, nur vor der Messe war eine halbe Stunde Zeit gewesen, aber da beachtet er die eucharistische Nüchternheit. Jetzt holt er die Aldi-Weißwürste aus dem Kühlschrank, reißt zwei aus der Packung und ißt sie im Stehen. Dann kommt ihm das selbst übertrieben vor, und die anderen drei Würste erhitzt er, während er in der Speisekammer nach süßem Senf sucht, den er nicht findet. Er ißt die heißen Würste ohne Senf, immerhin setzt er sich hin und schabt das Brät mit dem Messer aus der Haut. Er trinkt Malzbier dazu.
Sie sind gutwillige, ordentliche Leute, sagt er sich. Sie sind ihm gewogen und wünschen sein Wohlwollen. Sie würden ihn nie zu etwas zwingen wollen und könnten es auch nicht. Es war ein blöder Moment. Isidor ärgert sich nur über sich, nicht über sie, und um das zu beweisen, macht er sich sofort über alle die wohlwollendsten Gedanken. Er wird ruhiger. Der Abend ist noch lang. Warum sollen sie nicht nach Konnersreuth fahren? überlegt er also. Das wird niemanden von ihnen besser oder schlechter machen, aber vielleicht dem einen oder anderen Mut und Hoffnung geben, und die haben sie alle nötig. Er geht sie rasch in Gedanken durch – Frau Valin, Frau Zwickl, Herrn Pechl und so weiter, alles Leute, die sonst so gut wie nichts miteinander zu tun haben – was ist bloß in sie gefahren? Oder hat er etwas Wichtiges übersehen?
Frau Valin zum Beispiel. Die hieß Willinger, bevor sie vor fünfzig Jahren einen Franzosen heiratete und nach Frankreich zog. Die Ehe scheiterte. Frau Valin arbeitete in Rouen als Bardame, später als Putzfrau. Den Beruf wechselte sie, weil sie ihrem kleinen Sohn ein Vorbild sein wollte. Er war ein einsichtiger und gescheiter Bub, sie konnte ihn zur Arbeit mitnehmen, dort saß er auf dem Perserteppich der großbürgerlichen Wohnung und brachte sich selbst das Lesen bei. Madame und Monsieur, ein kinderloses Rechtsanwaltsehepaar, waren schließlich so vernarrt in ihn, daß sie vorschlugen, ihn zu adoptieren. Er würde eine Ausbildung bekommen, die seinem Talent entsprach, und die großbürgerliche Wohnung sowie das Ferienhaus an der bretonischen Küste erben. Die Bedingung war, daß die leibliche Mutter den Platz räumte. Sie bekam eine Abfindung und kehrte nach Bodering zurück.
Der Sohn erfüllte alle Erwartungen, er wurde Anwalt wie die Adoptiveltern und hat inzwischen selber Kinder; aber er ist auch ein diplomatischer Sohn und schreibt seiner Mutter regelmäßig Briefe. Einmal im Jahr besucht sie ihn und die Enkel im bretonischen Ferienhaus, nie länger als eine Woche zwar, denn erstens will sie niemandem zur Last fallen, und zweitens mokieren sich die Enkel über ihr niederbayerisches Französisch; drittens ist ihr die Bretagne zu windig. In Bodering lebt sie unauffällig in einer Einzimmerwohnung. Sie ist siebzig Jahre alt und krank – Füße, Hüften, Leber. Sie färbt sich die Haare kupferrot und läuft seit Jahren im selben abgewetzten grünen Wollmantel herum, sehr klein, füllig, leicht nach vorn gebeugt, etwas schwankend, weil jeder Schritt sie schmerzt. In der Kirche hat sie immer in der letzten Reihe gesessen und ist nie zur Kommunion nach vorne gekommen. Von solchen Leuten gibt es einige in Bodering: Sie glauben, das Wohlwollen des Herrn verscherzt zu haben, vielleicht fürchten sie auch, vom Pfarrer abgewiesen zu werden, obwohl er sie weder abweisen darf noch will. Trotzig und sehnsüchtig bleiben sie sitzen, während die Gemeinde vorn Schlange steht für die Kommunion, für ihn ist’s fast schlimmer als für sie, so daß er das Gespräch mit ihnen sucht und gelegentlich auch findet. Frau Valin zum Beispiel trappelte wochenlang wie ein verschrecktes lahmes Pferd davon, wenn er sich näherte. Als es ihm gelang, sie anzusprechen, lächelte sie mädchenhaft und irgendwie ergeben mit vom Lippenstift rot gefärbten großen Schneidezähnen und erzählte ihm alles: daß sie Bardame gewesen war, und die Sache mit dem Sohn. Ein bißchen wand sie sich; sie fand sich unwürdig, denn jemand in der Gemeinde hatte gesagt, sie habe ihren Sohn »verkauft«. Sie kämpfte mit den Tränen: Hatte sie ihn nicht wirklich verkauft? Aber was hätte sie ihm bieten können, als Putzfrau und Alkoholikerin? (Obwohl sie nie gern getrunken hat, als Bardame hat sie einfach mittrinken müssen, und jetzt geht’s nimmer ohne, a Berufskrankheit, wissen S’.) Die Adoption war doch das Glück von dem Bub! Und nur ihr Unglück – nein, das auch nicht, denn natürlich war sein Glück auch ihres, oder ...? Und beim Wort »natürlich« kämpfte sie wieder mit den Tränen. Er erklärte, daß er nicht wisse, ob es hier überhaupt etwas zu verzeihen gebe, wenn aber ja, dann habe Gott ihr mit Sicherheit verziehen. Sie lächelte wieder mädchenhaft und machte eine Bewegung, als wolle sie ihm um den Hals fallen.
Frau Zwickl weigert sich aus einem anderen Grund, an der Kommunion teilzunehmen: Sie war früher Nonne und hat den Orden wegen eines Mannes verlassen. Der Mann verließ bald darauf sie, und dann fand sie noch einen Mann. Sie selbst findet, das gehe eigentlich zu weit. Sie will keine Kommunion, weil schon das Verlassen des Ordens eine Art Scheidung gewesen sei, sie wisse, was sie sich und der Kirche schuldig sei und nehme keine Almosen. »Almosen von Gott?« hat Isidor überrascht gefragt. »Ja!« rief sie heftig. Sie ist eine stolze Frau, vielleicht hat sie es deshalb im Orden nicht ausgehalten. Jetzt arbeitet sie als Realschullehrerin in Zwiesel, täglich eine Stunde Fahrt; ihre Schüler hassen sie. Der Kirche aber bleibt sie auf ihre schroffe Art treu. Sie begleitet alle Wallfahrten, »das jedenfalls kann man mir nicht verbieten!« Als er fragte: »Wer v-verbietet Ihnen was?«, wandte sie sich ab. Ihr wirklicher Feind ist ihr Gewissen, glaubt er. Andererseits ist ihr Gewissen von der Kirche geprägt, und da kann etliches schief gehen, er darf ihr nichts vorwerfen. Die kleinen Kämpfe, die sie gelegentlich mit ihm führt, sind nichts gegen ihren Kampf mit sich selbst.
Die Eheleute Zenzi und Baptist Koller wallfahrten seit Jahrzehnten aus Dankbarkeit, weil sie so ein glückliches Paar sind. Sie möchten miteinander mindestens neunzig werden. Jetzt sind sie fünfundachtzig und in einer schweren Krise, die damit begann, daß Zenzi sich ein Bein brach. Vorgestern ist sie zum ersten Mal ohne Gehgerät ein paar Schritte gegangen, da tranken die beiden einen Piccolo auf die nächsten fünf Jahre. Aber am gleichen Abend las Zenzi in einer Zeitschrift etwas über Brustkrebs-Symptome und erschrak, denn eines dieser Symptome traf genau auf sie zu: eine zweieinhalb Zentimeter große Verhärtung, länglich, festgebacken, mit Hauteinziehung. Am nächsten Tag ging sie zum Arzt. Sie muß noch morgen zur Operation ins Krankenhaus; das Geschwür könnte sich öffnen. »Aber mir warn doch dreiasechzg Jahr verheirat’!« sagen sie erschüttert.
Herr Pechl wallfahrtet, um seine Seele zu retten. Er will überallhin. Mit dem Bayerischen Pilgerbüro ist er schon in Rom, Lourdes, Fatima und Jerusalem gewesen, und natürlich begleitet er sämtliche Wallfahrten in Niederbayern, am liebsten Fußwallfahrten. Da singt und betet er unaufhörlich laut, während er in seinem sonstigen Leben nichts sagt. Herr Pechl hat den ganzen Weltkrieg an der Ostfront verbracht, keiner weiß, was er dort erlebt hat, aber danach ist er verstummt. Mit dem Wallfahrten begann er, als er in den fünfziger Jahren ein mongoloides Kind bekam. Warum erst da? Er hatte dieses Kind sofort in ein Heim geben wollen, nur mit Mühe konnte die Frau ihn hindern. Wirft er sich das vor? Oder fühlt er sich durch den behinderten Sohn bestraft für etwas, das er im Krieg getan und dann vergessen hat? Hat die vermeintliche Strafe oder unerwartetes Mitleid die Erinnerung geweckt? Andererseits: Selbst wenn sein Schock nicht von dem herrührt, was er erlitt, sondern von dem, was er getan hat: Wer macht sich nicht schuldig im Krieg? Wer kann schwerbewaffneten, von Jugend und Todesangst verwirrten Buben vorwerfen, daß sie umeinander schießen? Herr Pechl, kurzum, ist einer der verläßlichsten Gläubigen von Bodering, und man sollte nicht fragen, in welche Gräuel er verstrickt war, um es zu werden.
Zu guter Letzt war, gänzlich überraschend, Professor Weikl dabei, der interessanteste und bedeutendste Sohn von Bodering. Wilhelm Weikl hat vor über fünfzig Jahren Bodering verlassen, um in München Biochemie zu studieren, und wurde ein so erfolgreicher Forscher, daß er einen Ruf nach Amerika bekam. Drei Jahrzehnte war er Professor in Princeton, er hat Preise, Auszeichnungen und einen amerikanischen Paß bekommen, seine drei Söhne sind ebenfalls Wissenschaftler an amerikanischen Universitäten.
Als Herr Weikl aber vor fünfzehn Jahren in Rente ging, stellte er fest, daß er überhaupt keine Freunde hatte. Seine Frau, die inzwischen schwermütig geworden war, hatte erst recht keine Freunde, und so kam es, daß beide binnen eines Jahres vereinsamten. Nun reisten sie immer öfter nach Bodering, seine Verwandtschaft besuchen. Das erste Mal hatte der Lokalanzeiger auf Seite eins darüber berichtet, sogar mit Foto, woraufhin ab sofort jeder Herrn Weikl kannte, denn der war ein interessanter, gutaussehender Mann. Herr Weikl war sogar zum Gottesdienst erschienen und hatte mit intelligenter, ironischer Miene gelauscht. Zufällig war es eine sehr gelungene Predigt gewesen, und als Herr Weikl die Kommunion entgegennahm, hatte er Isidor zugelächelt, gewissermaßen zwinkernd: Wir wissen ja, daß es Blödsinn ist, trotzdem gut gemacht, Herr Kollege, nette Folklore! Durch all die Jahre tauchte er seitdem in der Kirche auf, mindestens einmal pro Deutschlandbesuch, hörte konzentriert und skeptisch zu, mit leise zunehmender Sentimentalität. Seit etwa acht Jahren sieht er bedrückt aus, und bei diesem Winterbesuch sogar trostlos. Seine Frau sei kürzlich gestorben, hört man. Jahrelang siechte sie dahin, erst brach sie sich den Fuß, dann bekam sie Diabetes, dann Krebs, dann einen Schlaganfall, und depressiv war sie sowieso. Die Boderinger Verwandten erzählten, daß er bei seinen Besuchen immer öfter in Tränen ausbrach. Die letzten Jahre hatte die Frau in einem Bostoner Pflegeheim gelegen, das fast die ganze Professoren-Pension von achtzigtausend Dollar verschlang, außerdem mußte der Mann jeden Tag mit dem Auto hinfahren und seine Frau füttern – von selber aß sie nichts, und das Personal hatte keine Zeit. Während er sie fütterte, beschimpfte sie ihn – er sei das Schlimmste, was ihr je im Leben widerfahren sei, sie hätte ihm niemals nach Amerika folgen dürfen und so weiter –, und wenn sie konnte, biß sie ihn in den Finger, worauf er jedes Mal weinte.
Auch die Boderinger sind inzwischen ungnädig mit Professor Weikl. Hatte der nicht vor Jahrzehnten seine senile Mutter in einem Deggendorfer Altersheim sich selbst überlassen und ihr gerade mal zu Weihnachten eine Karte geschickt? heißt es. Andererseits war auch die Rede von einem dunklen Geheimnis: Die Mutter war schwierig gewesen, niemand weiß, was vorgefallen ist zwischen Mutter und Sohn. Insgesamt hatte Weikl Glück, er genoß in vollen Zügen das Leben und staunt nun, wie bitter die Neige ist. Nicht ein grausames Schicksal hat ihn gebrochen, sondern das banale Alter. Auf einmal ist er wehrlos gegen Vorwürfe, die jahrzehntelang an ihm abperlten; woraus man schließen darf, daß er auch seine eigene innere Stimme gegen sich hat, und das ist erfahrungsgemäß die härteste von allen, ob mit oder ohne Grund. Denn das Gewissen ist ein gefährliches Tier.
Isidor
Weil er an mir hängt, will ich ihn retten, ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
(Ps 91,14)
Warum ist er Priester geworden? Er wollte gut sein und anderen helfen, hat er vor vierzig Jahren geantwortet. Er wollte sich opfern, hätte er vor zwanzig Jahren gesagt: Was sollte er sonst tun? Er bestand zu 66 Prozent aus Wasser und versprach sich nichts von sich. Heute, da ihn seit dreißig Jahren keiner gefragt hat, würde er wahrscheinlich mit einem Scherz antworten: Was bleibt einem anderes übrig, wenn man Isidor Rattenhuber heißt, rothaarig ist und stottert?
Im Ernst würde er sagen: Die Kirche hat ihn gerettet. Sie bot die Gegenwelt zu seinem trostlosen Elternhaus. Seine Eltern waren keine schlechten Menschen, aber wüst, laut und ziellos. Sie arbeiteten hart auf ihrem kleinen Bauernhof, und wenn sie arbeiteten, schwiegen sie, aber wenn sie nicht arbeiteten, bekämpften sie einander gnadenlos. Das Haus hatte dünne Wände und einfache Bretter zwischen Erdgeschoß und erstem Stock, und wenn die Eltern stritten, klang es für Isidor wie Weltuntergang. Es gibt eine Fotographie vom zweijährigen Isidor, da hat er trübe Augen und eine umwölkte, wie vom Stirnrunzeln muskulös gewordene Stirn.
Er fürchtete vor allem die Unberechenbarkeit seiner Mutter. Sie konnte mit Zärtlichkeiten über ihn herfallen wie eine Naturgewalt und ihn dann tagelang mit Schweigen strafen. Er wußte nie, was er falsch gemacht hatte. Er sehnte sich nach Regeln. Sie beklagte ihm gegenüber den Jähzorn des Vaters, aber wenn der Vater mal friedlich war, mußte sie ihn provozieren. Nur in der Kirche riß sie sich zusammen. Schon als kleiner Bub genoß Isidor, wie die Mutter auf Befehl sich bekreuzigte und das Vaterunser murmelte. Sie unterwarf sich dem Ritus, und Isidor, auf ihrem Schoß sitzend, hatte zum ersten Mal ein Gefühl von Macht. Ihm gefielen die bunten Fenster, das Dämmerlicht, die seltsamen Malereien, die verrenkten Gestalten an den Wänden, der Weihrauchduft, die Nester von Kerzen in den Nischen. Er genoß die geheimnisvolle Ordnung der Messe und sehnte sich danach, ihren Sinn zu verstehen. Er malte Buchstaben ab und fragte verschiedene Erwachsene, was sie bedeuteten. Eine Tante übte mit ihm an Groschenromanen das Lesen und sagte: »Na Isi, bist ja a ganz a gscheiter Bua!«, da hätte er sich am liebsten adoptieren lassen.
Einmal am Heiligen Abend stritten die Eltern derart rasend, daß Isidor dachte, sie bringen sich um (und in allem Entsetzen fand, es wäre vielleicht das Beste so). Die damals schwerfällige, aufgetriebene Mutter floh ins Schlafzimmer und schloß ab, der Vater brüllte auf die Tür ein, und Isidor saß mit klopfendem Herzen allein vor dem Christbaum. Auf einmal hielt er es nicht mehr aus und floh ohne Schuhe über die verschneite, dunkle Straße zur Kirche. Dort fand ihn die Schwester des Pfarrers und brachte ihn ins Pfarrhaus. »D’M-mm-muatta h-h-h-h-h-h-« versuchte Isidor zu erklären – je aufgeregter er war, desto stärker stotterte er, was leider bis heute so geblieben ist. »Scho guat«, antwortete der Pfarrer. »Woaßt eigentlich, Isidor, daß d’ scho da herin gwesn bist?«
Der Pfarrer hatte einmal den vielleicht drei- oder vierjährigen Isidor bei Hochwasser aufgelesen und ins Pfarrhaus getragen. Isidor erinnerte sich nicht, aber er war so elektrisiert, daß er danach Zeugen suchte und befragte. Und zwar hatten seine Eltern den kleinen Isidor wie immer, wenn sie draußen arbeiteten, mit einem Strick ans Tischbein gebunden, damit er nicht weglief. An dem Tag war Hochwasser angesagt. Sie wickelten den Kühen Lappen um die Klauen, damit sie im Stall nicht ausrutschten, dann eilten sie für andere Besorgungen davon. Währenddessen trat die Vils über die Ufer und sprudelte unter der Stubentür herein. Der kleine Isidor an seiner Fessel kletterte auf einen Stuhl, dann auf den Tisch und weinte, und in diesem Augenblick lief eben der Pfarrer vorbei, sah ihn durchs offene Fenster, kam herein und nahm ihn mit. Warum nahm er ihn mit? Hochwasser war im März nichts Besonderes, es stieg selten über zwanzig Zentimeter. Angeblich hat aber Isidor die Hände gerungen und »D’Sintflut! D’Sintflut!« gerufen, da hat sich der Pfarrer zuständig gefühlt. In Isidors erweckter Erinnerung immerhin schwammen Stühle durchs Zimmer und verbanden sich mit anderen Details zu einem Bild von zwingender Gegenwärtigkeit: der abrupte, hinkende Schritt des Pfarrers, die Bugwelle um dessen Knie, der seltsamerweise blaue Himmel, schließlich das Schmatzen, mit dem das schlammige Wasser den Talar freigab. Es wurde Isidors erste, ganz persönliche, köstliche Errettungslegende.
Ihr folgte eine zweite Errettung, die weniger dramatisch, aber eigentlich noch wunderbarer war. Isidor hatte sich wieder ins Pfarrhaus geflüchtet, stumm, finster und verkrampft, und der Pfarrer, der keine Zeit hatte, schob ihn in sein Büro. Isidor blieb fast das Herz stehen, so beeindruckt war er: Eine Regalwand voller Bücher. Der Geruch von Staub und Papier. Und ein Schreibtisch mächtig wie ein Altar, auf dem eine Messinglampe stand, schimmernd wie ein Kelch oder eine Monstranz. In Isidors Elternhaus gab es kein Regal, keine Bücher und keinen Tisch außer dem in der Küche. Auch keinen Stuhl wie diesen gepolsterten Schreibtischsessel mit Armlehnen, breit, ehrfurchtgebietend, einladend. Zögernd setzte sich Isidor auf diesen Stuhl. Hätte ihn ein strafender Blitz getroffen, hätte er das korrekt gefunden, aber er konnte nicht anders. Vorsichtig zog er das Buch, das auf dem Tisch lag, an sich heran, ein rotes mit Ledereinband und Goldschnitt. Er las: »Schott – Meßbuch der Heiligen Kirche« und fühlte sich unbeschreiblich glücklich, als sei er am Ziel. Er lehnte das Buch mit dem Rücken gegen die Tischkante und blätterte versunken darin. »Bist am Lesen, Isidor?« hörte er hinter sich den Pfarrer fragen. »Lies amoi vor!«
Isidor las laut: »Zu Dir erhebe ich meine Seele; mein Gott, auf Dich vertraue ich. Drob werd ich nicht erröten, noch sollen meine Feinde mich verlachen. Denn all die vielen, die auf Dich warten, werden nicht enttäuscht.« Er sah auf, weil er seine Ohren brennen fühlte. Das Zimmer war heller geworden. Er hatte nicht gestottert. Er saß in einem anderen Zimmer. Es war eine andere Welt.
Der Pfarrer blätterte und zeigte mit dem Finger auf eine Stelle. »Und jetzt lies dös.«
»Ihr Kleinmütigen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, unser Gott kommt und erlöst uns.« Jemand sprach direkt zu Isidor, für ihn und über ihn.
Und noch eine Stelle. Isidor las wie in Trance: »In heiliger Gemeinschaft ehren wir dabei vor allem das Andenken der glorreichen, allzeit reinen Jungfrau Maria, der Mutter Jesu Christi, unseres Herrn und Gottes (wie auch Deiner heiligen Apostel und Blutzeugen Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus; Linus, Kletus, Klemens, Xystus, Kornelius, Cyprianus, Kosmas und Damianus ...)« Er stotterte nicht und verlas sich kein einziges Mal. Er war befreit! Er rannte nach Hause, um das Wunder zu verkünden: »I w-war g-g-grad beim Pf-pf-pf-pf-pf-«
»Isidor«, sagte seine Mutter, »schalt dei Hirn ein, bevor daß d’ das Mei aufmachst.«
»Ich bin in die Tiefe des Meeres geraten, und die Flut verschlingt mich!« stieß Isidor hervor.
»Daß d’ ma net damisch wirst«, murmelte sie beeindruckt.
Isidor wußte jetzt, wohin er gehörte. Man hielt ihn nicht mehr für einen Deppen. Er bekam von seiner Tante ein Meßbuch geschenkt, in dem er ungestört lesen durfte. Auch aus anderen Gründen wurde sein Leben leichter: Die Eltern gaben die Landwirtschaft auf. Der Vater lernte um und zog als Fleischbeschauer durch die Dörfer. Die Mutter gebar einen weiteren Sohn, den sie sofort närrisch liebte, so daß Isidor vor ihren Launen sicher war.
Vor allem aber hatte er sich einen neuen Vater erwählt. Pfarrer Stettner hatte seit dem ersten Weltkrieg einen Holzfuß, litt an Gicht und war oft kurz angebunden. Nur das hielt Isidor davon ab, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen. Aber Stettner mit seiner konzentrierten, kraftvollen Ausstrahlung gab auch aus der Ferne ein gutes Vorbild ab. Isidor beobachtete seine überlegte Gestik bei den liturgischen Handlungen, seine Haltung bei Kreuzzeichen, Kniebeugen, Sitzen und Stehen, die knappe Würde seiner Bewegungen trotz – oder wegen – Holzfuß und Gicht. Isidor selbst hätte gern Holzfuß und Gicht in Kauf genommen, um so zu werden.
Erst später begriff er Stettners pastorale Leistung, die symbolisch effektvoll, aber etwas willkürlich war. Stettner versöhnte zum Beispiel zwei befeindete Nachbarfamilien, indem er am Ostersonntag einen Kreidestrich über die Mitte der Straße zog und die Leute mit ziemlich groben Worten nötigte, sich über dem Kreidestrich die Hand zu geben. Nein, sie haben sich danach nicht lieber, erklärte er Isidor, aber jetzt müssen sie sich benehmen. Das leuchtete Isidor ein. Als die Großmutter der einen Familie starb, holte Pfarrer Stettner persönlich die andere Familie zum Begräbnis und ließ weder Ernte noch kranke Kuh als Ausrede gelten. »Damits euch net schämen müßts, wenn ihr die Traudl im Himmel treffts!« – »Im Himmi?« rief die überlebende Großmutter erschrocken. »Jo wos! Is die do aa drint?«
Pfarrer Stettner hat auch beschlossen, daß Isidor aufs Gymnasium gehöre. Isidors Eltern wehrten sich nur fünf Minuten, denn mit dem Buben war eh nichts anzufangen. Mit elf Jahren zog Isidor also ins Benediktinerinternat, erleichtert, dem häßlichen, lärmenden Leerlauf daheim entronnen zu sein, etwas ängstlich, weil er in diesen Tagen überhaupt keinen Satz zu Ende brachte, und auch traurig, weil seine Eltern so gar keine Trauer zeigten. Immerhin waren sie auf eine gewisse ratlose Weise freundlich zu ihm. Die Tante aber sagte laut, daß sie stolz auf ihn sei, und hat ihm jahrelang Päckchen geschickt.
Acht Jahre später besuchte Isidor Pfarrer Stettner, um ihm mitzuteilen, daß er ins Passauer Priesterseminar eintreten wolle. Es war keine leichte Entscheidung gewesen: Er war voller Zweifel, sowohl was das Seminar, als auch was ihn selbst anbetraf, und die Entscheidung hatte durchaus Opfercharakter. Außerdem war er pathetisch gestimmt, weil er eigentlich auf diese Weise ausdrücken wollte, daß er Stettner sein Leben verdanke. »So, zum Pfarrer wuist?« kicherten die Eltern. »Is er denn dahoam? Vielleicht fahrt er grad wieder auf Regensburg, zu de städtischen Bienen?«
Pfarrer Stettner hatte sich Ende der fünfziger Jahre als einer der ersten Dorfhamer ein Auto geleistet, einen VW mit Brezelfenster. Mit diesem VW fuhr er in seinen freien Stunden durch die Gegend, man sichtete ihn mal hier, mal dort, und gelegentlich verschwand er ganz. Soeben war im Dorf das Gerücht aufgekommen, der Pfarrer fahre jeden Montag nach Regensburg in ein Bordell. Isidor glaubte das nicht, wollte aber mit den Eltern nicht streiten, inzwischen fürchtete er ihre Dummheit mehr als ihre Kampfkraft. Schon gar nicht hat er mit Stettner darüber gesprochen; er weiß nicht mal, ob Stettner von dem Gerücht wußte.
Er wunderte sich, als er eintrat, vor allem darüber, wie klein Stettner war: Isidor überragte ihn inzwischen um Haupteslänge. Außerdem war Stettner in Zivil, wodurch er schmaler wirkte, wiewohl immer noch zäh und energisch. Jedenfalls kam Isidor mit seiner Neuigkeit vom Priesterseminar nicht wirklich an. Er hatte natürlich Anerkennung von Stettner erhofft, eine Äußerung der Freude, zumindest Rührung, aber Stettner sagte nur barsch: »Oana muaß as ja mocha!«, und es blieb unklar, ob er damit Isidor meinte oder sich selbst.
Weitere acht Jahre später fand in Dorfham Isidors Primiz statt, seine erste heilige Messe. Es war für Isidor der wichtigste und zugleich traurigste Tag seines Lebens. Der neue Ortspriester, der Isidor empfing und unterstützte, war bereits entschlossen, um einer Frau willen aus dem Klerikerstand auszutreten. Der Tag sollte ein Volksfest werden, weshalb die Messe unter freiem Himmel auf dem Sportplatz stattfand, und alle Vereine kamen auch mit Fahnen und Bannern, aber es war so heiß – dreißig Grad, glühender Wind, stechende Sonne –, daß einige Leute einen Hitzschlag erlitten und von der Freiwilligen Feuerwehr weggetragen werden mußten. Die übrige Gemeinde flüchtete unter das Tribünendach und das Vordach des Geräteschuppens. Erst nach der Messe entdeckte Isidor, dessen schweißgetränktes Schultertuch ihn in den Hals biß wie ein dorniges Joch, unter einem schwarzen Schirm auf einem Klappstuhl Pfarrer Stettner, der aus einem Altersheim angereist und ebenfalls der Ohnmacht nahe war.
Isidor hat Pfarrer Stettner noch einige Male in diesem Kloster-Altersheim besucht. Das lief immer ähnlich ab: Isidor e-e-e-erzählte von seinen Mühen als Kaplan, und Pfarrer Stettner, inzwischen weißhaarig und ausgebleicht, schlief darüber ein. Wenn er erwachte, sagte er: »Merk dir, Isidor: Das eine ist die Theologie, das andere die Pastoral!« Auf diese Weise hat er Isidor, den er durch Regeln errettete, allmählich wieder von den Regeln befreit. Und Isidor, der in der schwankenden Welt leidenschaftlich eine Ordnung suchte, fand sie ausgerechnet durch einen Menschen, das unberechenbarste Wesen überhaupt. Er lernte, seinen Gefühlen zu trauen, weil Stettner ihnen traute. Wie konnte er einem zerrütteten, vor Haß halb wahnsinnigen Paar sagen: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen? Und sollte er wirklich Ehepaaren, die aus Not keine weiteren Kinder wollten, die Kommunion verweigern? Stettner murmelte im Erwachen: »Machst as scho recht, Isidor!«, und Isidor war erleichtert wie nach einer Generalabsolution. Zum Ausklang spielten sie auf Stettners teurem Plattenspieler Barockmusik, und Stettner erzählte vom tiefsten Kummer seines Lebens, daß nämlich Bach evangelisch gewesen war.
Als Isidor seine erste Pfarrei übernahm, hatte er immer seltener Zeit für solche Besuche, und das Telefonieren war schwierig, weil Stettner taub wurde. Eines Tages rief ein Kollege an, er solle ihn vom Pfarrer Stettner grüßen. – »Ach!« rief Isidor erfreut, »Wie g-g-geht’s eahm denn?« – »Er is an dem Tag gstorben.«
Isidor erbte von Stettner ein lückenhaftes Manuskript, das Stettners Kindheit bis zum zwölften Lebensjahr behandelte und mit einem Halbsatz abbrach: »Nachdem es Gott in seiner Güte gefallen hat, mich –« Der Text bis dahin war nüchtern, fast unpersönlich, eher beschreibend als erzählend, mehr Volkskunde als Autobiographie. Stettner war das elfte von dreizehn Kindern gewesen und sehr arm, allerdings auch nicht ärmer als alle anderen. Wovon war die Rede? Hungern und Frieren, mit blutigen Füßen Ährensammeln auf Stoppelfeldern, Knochenarbeit, Husten, Läuse, Schorf. Die schwangeren Frauen gingen mit zur Ernte, und wenn die Wehen einsetzten, legten sie sich in den Weizen und gebaren. Bevor die Altbauern den Hof an die Kinder übergaben, handelten sie aus, wieviel Brennholz fürs Austragshäusl und wieviel Brot und Speck ihnen zustand. Über dem Feilschen ging oft der Familienfriede verloren, sinnloserweise, denn die Bauern kürzten die Rationen in den folgenden Jahren sowieso, bis die Alten verhungerten oder erfroren. Sterbenden hängte man eine Glocke ans Bett, die über eine Schnur mit ihrem Handgelenk verbunden war. Wenn sie in Angst oder Todeskampf an der Schnur rissen, bimmelte die Glocke, und die draußen auf dem Feld knieten nieder und bekreuzigten sich, dann arbeiteten sie weiter.
Isidor selbst hatte einmal Stettner lebhaft, sogar andächtig von seiner Kindheit erzählen hören. Das Manuskript aber war, der Jahreszahl auf dem Deckblatt nach, um 1935 geschrieben worden, woraus Isidor schloß, daß Stettners Erinnerung später vieles abgemildert habe. Daraus leitete er den siebten seiner privaten Leitsätze ab. Isidor hat nämlich Leitsätze, die er in Krisensituationen abruft. Satz eins: Das Heil liegt in der Erkenntnis. Satz zwei: Man muß sich anständig benehmen, auch wenn’s nichts nützt. Satz drei: Alles gleicht sich aus. Satz vier: Die erste Folge eines Fehlverhaltens ist Verdunkelung des Bewußtseins. Satz fünf: Gewohnheit ist stärker als Sexualität. Und so weiter. Die Sätze sind, zugegeben, von stark unterschiedlicher Qualität, aber sie alle sind auf persönliche, manche auf dramatische Weise zu ihm gekommen, und sie helfen ihm immer noch ab und zu. Satz sieben also verdankt sich Stettners Umgang mit seiner bitterarmen Kindheit und lautet: Schmerz unterliegt einer starken Amnesie.
Vormittag
Ist wohl ein Mensch vor Gott gerecht, ein Mann vor seinem Schöpfer rein?
(Ijob 4,19)
Am anderen Morgen, als er in der Küche seinen Frühstückskaffee trinkt, hat Isidor Konnersreuth beinah vergessen. Es ist viertel nach fünf, Schneeflocken wirbeln gegen das schwarze Fenster. Der Wind heult ums Haus, aber drinnen ist es warm und still. Isidor umfaßt das heiße Haferl mit beiden Händen. Gleich, um sechs Uhr, ist Rorategottesdienst in der Nepomuk-Kapelle, der erste von über dreißig Terminen dieser Woche (Buß-, Rorate- und Festgottesdienste in zwei Kirchen und einer Klinik, Erstbeichte der Erstkommunikanten, Krankenkommunion in zwei Pfarreien, Probe für Adventsingen und so weiter). Isidor wird seine Kraft einteilen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dazu gehört zunächst einmal: Nachsicht.
Isidor hat schon vor dreißig Jahren aufgegeben, nach Gerechten zu suchen, denn wenn sich nicht mal in Sodom zehn Gerechte fanden – in einer Stadt, im Heiligen Land, beim Auserwählten Volk! –, was kann man da von Niederbayern erwarten, und dann noch ausgerechnet von Bodering?
Außerdem ist nicht mal er selbst gerecht.
Dies wird seine achtundzwanzigste Weihnacht in Bodering. Er wird es gut machen, obwohl Weihnachten nicht sein Lieblingsfest ist. Zu viel Unruhe in der Gemeinde, zu viel Remmidemmi, Feier- und Genußterror, zu den Festtagen selbst oft Enttäuschung und Streß, weil die Leute zu viel erwarten. Anstatt der Ankunft des Erlösers zu gedenken, reiben sie sich an ihrer Unerlöstheit auf. Isidor spürt die Erwartung wie die Anspannung, er versucht die Leute spirituell aufzuladen, damit sie gelassener und dankbarer miteinander umgehen können, und jedes Jahr erlebt er kleine Erfolge und krasse Mißerfolge.
Immerhin, sie kommen in die Kirche. Er weiß nicht, was in ihnen vorgeht, aber sie wirken ergriffener als sonst. Gelegentlich sagt einer, daß für ihn die Kirche zu Weihnachten am wichtigsten sei. Isidor weiß nicht, ob das als Kompliment gemeint ist. Er selbst freut sich auf Ostern. An dieses Fest knüpft sich sein persönlicher Glaube. Es ist spirituell dramatischer, liturgisch tiefer, äußerlich festlicher, vom Schwung sich verlängernder Tage und der Ahnung des Frühlings erhellt.
Um viertel vor sechs, auf dem Weg in die Sakristei, sieht er unter den ersten Kirchgängern schon Frau Danninger und Herrn Pechl mit Frau und Sohn als eingemummte Schatten durch das Dunkel der Kapelle zustreben und bedauert, daß er gestern so streng war. Später, beim Rorate, sieht er in der letzten Reihe sogar das Ehepaar Koller, das kurz vor der Abfahrt ins Krankenhaus noch den Segen des Herrn erbitten will.
Das gemeinsame Frühstück findet im Empfangszimmer des Pfarrhauses statt. Frau Haberl hat Kaffee in Thermoskannen, Brezen und Butter bereitgestellt. Zwölf Leute sind mitgekommen, und nachdem das Ehepaar Koller sich sorgenvoll verabschiedet hat, wird die Stimmung aus irgendeinem Grund plötzlich heiter, und alle reden über Wallfahrten, lachend wie Abenteurer nach überstandenen Strapazen.
Ein einsamer Höhepunkt war Lourdes. War das schön! Der festliche heilige Bezirk, die vielen ober- und unterirdischen Kirchen und Kapellen! Sie haben gebetet, bis ihnen die Avemarias zu den Ohren rauskamen. Heilige Messe morgens an der Grotte, heilige Messe in der Rosenkranzbasilika, internationale Sonntagsmesse in St. Pius X. mit zwanzigtausend Gläubigen, überhaupt ständig irgendwo Messen in verschiedenen Sprachen. Rosenkranz, Anbetung, Beichte, Sakramentsprozession, Lichterprozession … Kreuzweg nachmittags bei dreißig Grad (hinter ihnen ging eine italienische Gruppe, deren achtzigjähriger Pfarrer im schwarzen Talar ab Station elf gestützt werden mußte), Kreuzweg morgens um sieben bei Dauerregen (als Herr Bayer die Fürbitten vorlas, floß aus der Krempe seines komischen australischen Huts plötzlich ein kleiner Wasserfall in das Gebetsbücherl). Batterien von Kerzen brannten in kleinen Schuppen mit Blechdächern. Tausende blauer Rollstuhlrikschas zogen im Gänsemarsch auf rot angemalten Rollstuhlwegen durch die Stadt zur Grotte … Eine Armee von Rollstühlen führte die Lichterprozession an, und jeweils beim Refrain (»Avé, avé, avé Mariaaa!«) hoben auch diese Schwerkranken ihre Kerzen wie Banner … Am zweiten Tag, erinnerts euch, wie’s geregnet hat? Alle dachten, die Lichterprozession fällt aus, bis fünf vor neun standen sie schlotternd unter ihren Regenschirmen in der Abenddämmerung, und dann versiegte plötzlich der Regen, die Wolken rissen auf, und über der Burg stand ein phantastischer Regenbogen … Ach! Und der schöne Busausflug ins Gebirge hinauf nach Gavarnie, traumhaft: eine kleine Naturarena, umstanden von dreitausend Meter hohen Gipfeln mit ewigem Schnee – kalter Wind, aber klare Sicht, unglaublich! Bei diesem Ausflug waren viele Pilger aus der Steiermark dabei, und die Boderinger erörtern nun kurz, ob das Steirische nicht komisch klinge. Nach vernünftiger Überlegung beschließen sie: nein, aber eigentlich finden sie, doch. Nett warn’s, die Steirer! Einige Behinderte dabei, aber auch die hatten Gaudi. Auf der Rückfahrt verteilte der steirische Pfarrer Gesangsbücher der Alpenvereinsjugend, und während der Bus die Serpentinen hinabkroch, schmetterten die Pilger aus voller Kehle Bergsteigerlieder. Danach erzählte ein Grazer durchs Mikro schlüpfrige Witze, einen nach dem anderen, und sie haben so gelacht, daß sie dachten, den Bus haut’s aus der Kurve. Abends noch mal Lichterprozession, die dritte. Vor der Heimfahrt füllten sie etliche Liter heiliges Lourdes-Wasser in Kanister, Isidor segnete alles vor der Abreise im Hotelfoyer, und zum Abschluß sangen sie – leise, um die anderen Hotelgäste nicht zu stören – »Nun danket alle Gott!«.
Auch Isidor mochte Lourdes. Die freundliche Stadt hat ihm gefallen, das weite, sonnige Land, die anrührende Geschichte der armen Bernadette, zu der die Muttergottes gesagt hatte: »Würden Sie mir den Gefallen erweisen, hierher zu kommen?« Die unfanatische Andacht seiner Leute. Es hat ihm gefallen, als einer von hundertzwanzig Priestern im weißen Meßgewand mit goldener Stola in die internationale Messe einzuziehen. Schön, mal nicht allein zu sein! Schönes Gefühl, für so viele Menschen zu zelebrieren, auch wenn er nie zu seiner Predigt kam, weil jedes Mal wichtigere Geistliche dabei waren. Seine Boderinger schienen das mehr zu bedauern als er. »So is dös bei uns in der Kirch: Ober sticht Unter!« erklärte Isidor vergnügt, und Frau Danninger bemerkte großzügig, sie sei überzeugt, daß Isidors Predigt viel besser gewesen wäre.
Heute, an diesem stockdunklen kalten Dezembermorgen im Bayerwald, kommt Lourdes ihnen allen vor wie ein Traum. Nie waren sie so nett zueinander, nie waren sie sich so einig. »Ach, Herr Rattenhuber!« sagt Frau Haberl schmelzend, »i freu mi ja so auf Konnersreuth!«
Isidor dankt Frau Haberl für ihre Mühe mit dem Frühstück und verabschiedet sich. Er muß noch drei Frauen die Krankenkommunion bringen und für die ganze Woche einkaufen.
Jetzt beschließt er, achtzehn Kilometer weit in die Kreisstadt Dambach zum Einkaufszentrum zu fahren; damit er nicht im Boderinger Kramladen an der Kasse anstehen muß, und damit niemand kommentiert, was er kauft. Er zieht seinen dunkelgrauen Wollmantel an, den Hut, Schal, überprüft schnell den Inhalt der Versehtasche (Ölampulle, Hostiendose, Taschenstola, Leinentücherl), wirft fünf Plastiktüten in den Kofferraum und fährt los.
Der erste der drei Hausbesuche gilt Frau Huber. Frau Huber sitzt nach einem Beinbruch im Bett, fünfundachtzig Jahre alt, ausgemergelt, aber mit leuchtenden Augen. Früher war sie ein Energiebündel, sie schuftete wie ein Pferd und trieb ihre Familie unbarmherzig an. Ihre Kinder liebt sie nicht, aber sie wußte: »I brauch a Tochter für d’ Altersversorgung.« In jeder Familie gibt es den Augenblick, wo alle den Tod des siechen Mitglieds wünschen, sie hören dann auf, etwas anderes vorzugeben, auch Isidor gegenüber. Die Tochter stöhnt: »Wie lang muaß i dös noch ertrong?« Sie fügt hinzu: »I dua mei Pflicht, aber mei Muatta is a Kreiz!« Eine knarrende Stiege führt zum Zimmer der Kranken, einer dunklen kleinen Stube mit dünnen Wänden. Frau Huber sitzt aufrecht im bemalten Bauernbett und strahlt ihm entgegen: »Setzn S’ Eahna her, Herr Pfarrer! Haha!« Sie hat sich angewöhnt, immer munter zu sein. Der Stoff zur Munterkeit fehlt inzwischen, aber ihre Moral ist enorm. Nach der Kommunion sagt sie: »Amen. Haha!« – »Bis boid!« ruft sie ihm nach. »Kemma S’ boid wieda, nachher bet ma mitanand! Haha!«
Die alte Frau Staus zwei Häuser weiter brütet depressiv vor sich hin. Früher war sie Putzfrau im Steigenberger Hotel, »keinen Tag krank, immer im Dienst«. Ihre Knie sind ruiniert, sie kann kaum gehen und wankt durch den Flur auf ihn zu. Aber ihr Kopf ist klar. Isidor betet mit ihr: Vaterunser. Gegrüßet seist du Maria. Psalm 23. Seele Christi heilige mich. Als sie fertig sind, würde Frau Staus am liebsten von vorn beginnen, aber er weiß, wie oft sie auch beten, sie wird vorwurfsvoll bleiben. Ihre Trauer ist bodenlos. »Am liebsten wär i tot. Zwoaraneinzg Jahr, dös is koa Spaß.«
»So vui Leit wärn f-froh drüber«, gibt Isidor zu bedenken.
»Wieso? Es hat ja ois koan Sinn! Die Politiker streiten und streiten, und nix kimmt dabei raus!«
Letzter Besuch: Frau Valery. Die ist wesentlich jünger als die ersten beiden, Mitte Sechzig vielleicht, alleinlebend, und hat ihn zum ersten Mal zu sich gebeten: Sie hat sich auf dem Emmeramfest beim Tanzen den Oberschenkelhals gebrochen, es gab Komplikationen, Monate später läuft sie immer noch auf Krücken. Früher war sie Schneiderin. In den achtziger Jahren spezialisierte sie sich auf extravagante Trachten für Touristen, und seit sie in Rente ist, malt sie auch. Sie war immer lebenslustig, auch in die Kirche kam sie bunt gekleidet. Isidor ahnt, daß sie ihn eher zur Gesellschaft als zur Kommunion gerufen hat; er muß etwas aufpassen, denn sie manipuliert gern, sie ist aufreizend und distanzlos. Wie sagt der Herr? Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, und wen Gott einläßt, darf Isidor nicht rauswerfen. Also reißt er sich zusammen.
Frau Valery also – üppig, geblümter Morgenmantel, blondgefärbtes Haar, rote Krücken – besteht darauf, ihn in der Stube mit Kaffee zu bewirten, und während er mit einer gewissen Ohnmacht ihren feinen Marmorkuchen ißt, erklärt sie, daß sie mit ihm über die Vergänglichkeit sprechen wolle.
Über die Vergänglichkeit?
Ja, alles geht so schnell zu Ende, und da ist eigentlich nicht einzusehen, warum es auch noch so unkomfortabel sein muß. Isidor steigt mit halber Aufmerksamkeit auf das Thema ein (was ist komfortabel, was unkomfortabel, und was dürfen wir vom Leben erwarten?), aber er liegt mit jedem Ansatz daneben, und schließlich kommt Frau Valery zur Sache: Ihr Liebhaber lebe nicht mit ihr zusammen, sie würde das gern ändern. Der Liebhaber ist Peter Greilich, ein wohlhabender Witwer, ehemals Filialleiter der Boderinger Sparkasse; kein Kostverächter, dabei aber konsequenter Kirchgänger und neuerdings Pfarrgemeinderat. Isidor solle doch in seiner Gegenwart zur Sprache bringen, daß es Frau Valery nicht zuzumuten sei, in der Küche zu malen, regt Frau Valery an; Peter habe schließlich so eine große Wohnung! Noch bevor sich Isidor von seiner Überraschung erholt hat, bittet sie ihn, ihre Bilder im Pfarrsaal auszuhängen zum Verkauf. Schon öffnet sie eine große Mappe und zeigt ihm ihre Werke. Die Bilder ähneln einander in Motiv und Ausführung: geflügelte rosa Engel, die auf Christbäumen oder in verschneiten Krippen sitzen. Alle Engel haben eigenartig starre Gesichter mit glasigen Augen. Modelle für sie waren offensichtlich Puppen; Isidor findet eine davon hinter einem Kissen, während Frau Valery auf ihren roten Krücken hinausturnt, um ans Telefon zu gehen, wo sie ihrem Peter sagt, auch der Pfarrer finde, man dürfe ihr nicht zumuten, in der Küche zu malen. An ihrer Reaktion merkt Isidor, daß Peter ihr nicht glaubt, und das ist gut so, da muß er sie nicht zurechtweisen. Er hat nicht gewußt, wie verrückt sie ist. Er verflucht wieder einmal seine Anfälligkeit, sich bewirten zu lassen.
Als Isidor den Wagen aus Bodering hinaussteuert, hängen graue Wolken zwischen den Hängen, die das Hochtal einschließen. Die Straße steigt bis zur Talschwelle etwas an und geht danach in leichten Serpentinen hügelab. Unten sieht Isidor wie einen dunklen See den Fichtenwald liegen, dann wird er von ihm verschluckt. Nach vier Kilometern erreicht er die breite, frisch geräumte Bundesstraße. Nach sechs weiteren verläßt er den Wald und fährt zwischen schmutzigen Schneewällen in die Kreisstadt ein.
Er schiebt seinen Einkaufswagen durch die Kaufhalle und lädt ein, ohne zu überlegen, Hauptsache, es reicht bis nach Weihnachten. Brot zum Aufbacken. Schwarzbrot zur Not. Butter, Aufschnitt, Schmalz, Tiefkühlgerichte, ein Kilo Orangen, Kaffee, Tee, Milch. Gelegentlich grüßen ihn Leute, die er nicht kennt. Er grüßt zurück, keine Zwischenfälle, jetzt steht er schon wieder auf dem Parkplatz und lädt die Tüten in seinen Kofferraum. Dort erst spricht ihn jemand an. Herr Mittermüller aus Bodering.
»Grüß Gott, Herr Pfarrer!«
»Grüß Gott!« antwortet Isidor unbefangen. »Wia geht’s denn oiwei?« fügt er hinzu, weil Mittermüller sich nähert.
Normalerweise antworten die Leute: »Guat, Dankschön«, ziehen den Hut und gehen weiter, es ist nur ein Ritual. Herr Mittermüller aber stellt sich vor Isidor auf und seufzt: »Dankschön, ’s muaß hoit.«
Herr Mittermüller ist achtzig, ein großer, rüstiger Mann mit weißem Schnurrbart. Im Krieg war er Offizier gewesen, nach dem Krieg Vertreter, außerdem jahrelang Boderings bester Vereinsfußballer. Robust. Neben zwei Frauen und vier Kindern hatte er sein ganzes Leben lang Geliebte. Aber jetzt wirkt er angeschlagen. Warum? Wie geht es denn seiner Annette?
»Ja, das ist der Grund, weshalb ich ein wenig klagen muß!« spricht Herr Mittermüller in formellem Hochdeutsch. »Sie versorgt mich nicht mehr!«
Hat sie ihn verlassen?
Annette, zwanzig Jahre jünger als Herr Mittermüller, ist vor rund zehn Jahren seine Haushälterin geworden: Sie kochte für ihn, wusch seine Wäsche und putzte seine Wohnung gegen Entgelt. Als er anfing, mit ihr zu schlafen, hörte er auf, sie zu bezahlen, denn sie war ja jetzt seine Geliebte. Sie bekochte, bewusch und beputzte ihn weiterhin, behielt aber ihre eigene Wohnung und führte auf diese Weise zwei Haushalte.
»An Schlaganfall hot s’ ghobt«, beantwortet Mittermüller die ungestellte Frage. »Auf Krucken lauft s’ grad a so. Meistens liegt s’ nur rum.«
»Wo?«
»Z’Haus. Naa, net bei mir!«
Hat er sie besucht? Kümmert er sich um sie, so wie sie jahrelang sich um ihn gekümmert hat?
»Naa«, sagt er, »dös is vorbei. Dös wird nix mehr mit der Annette.«
Er sieht unglücklich aus. »Aber i hob g’hört, mir machen im Frühling a Wallfahrt?« erkundigt er sich jetzt erwartungsvoll. Isidor erinnert sich, daß Herr Mittermüller auch früher recht gern mitgegangen ist. Seine Annette hatte er im Bus nach Burghausen kennengelernt (wer viel wallfahrtet, wird selten heilig).
Die Erinnerung scheint ihn zu beleben, denn seine Augen beginnen zu funkeln. Er versucht gar nicht, den Gedanken zu verbergen, sondern hüstelt und zwinkert erregt: »Konnersreuth?«
Nachmittag
Alles, was deine Hand, solange du Kraft hast, zu tun vorfindet, das tu! Denn es gibt weder Tun noch Rechnen noch Können noch Wissen in der Unterwelt, zu der du unterwegs bist.
(Koh 9,10)
Zu Hause lädt Isidor seine Einkäufe in den mannshohen Kühlschrank, den er gekauft hat, als ihn im Sommer seine Haushälterin verließ. Sie war seine ältere Cousine, er hatte sie gemocht; eine fremde Frau will er nicht im Haus. Da aber ein Kühlschrank einen lebendigen Menschen schlecht ersetzt, ist Isidor oft mißmutig, wenn er die Fächer füllt.
Er kocht Kaffee und schmiert sich ein Schmalzbrot, den noch lauwarmen Leberkäse ißt er aus dem Papier. Während er Kaffee trinkt, durchblättert er die Zeitung. Nebenbei notiert er auf einem Block Einfälle für die Feiertagspredigten.
Um viertel nach fünf fährt er zur Kurklinik, die zweieinhalb Kilometer außerhalb des Ortes liegt. Es ist bereits dunkel, das Schneetreiben hat aufgehört, aber die Kälte läßt nicht nach, beim Abbiegen schlingert er über gefrorene Matschstreifen. Er fährt in die Tiefgarage, die in den Abhang hineingebaut ist. Der Weg zum Andachtsraum führt durch lange Flure, zwei Treppenhäuser und ein riesiges verglastes Foyer mit wuchernden Zimmerpflanzen. Das Andachtszimmer ist nüchtern – große Fenster, helle Holzstühle mit grauem Stoffbezug. Ein modernes Kruzifix hängt an der Wand hinter dem Altar, etwas seitlich auf einem kleinen Sockel steht eine Madonna im frühgotischen Stil. Im Altar, einem abschließbaren Kasten auf Rädern, liegen Kerzen und Altarwäsche bereit. Isidor breitet das Altartuch über den Kasten, holt Hostienschale, Kelch, Kruzifix, Hostien, Lektionar, Schott und Meßkännchen aus dem Meßkoffer und baut alles auf. Er füllt ein Meßkännchen mit Leitungswasser, das andere mit Traubensaft, den er ebenfalls mitgebracht hat als Ersatz für Wein, den er mit einer Sondererlaubnis des Ordinariats aus guten Gründen meidet. Er zieht Albe und lila Stola an, zündet die Kerze an, öffnet die Tür.
Platz hat der Raum vielleicht für dreißig Personen, und er wird fast voll: Die Menschen kommen in Rollstühlen, mit Gehgestellen oder Gipsbeinen, auf Krücken. Sie beten laut und singen kräftig, entschlossener als sonst: Wer Weihnachten im Krankenhaus verbringen muß, um den steht es wirklich schlecht; deswegen gibt sich Isidor jetzt besondere Mühe, was ihm übrigens leicht fällt, da ihn die Sehnsucht der kleinen Zufallsgemeinde trägt.
Weil sie nicht nach vorne kommen können, geht er durch die Reihen und gibt jedem eine Hostie, sie murmeln: »Amen!« Am Stephanitag wird es vormittags eine Messe im Foyer des Klinikums geben, da werden einige von ihnen weinen.
Er segnet sie. Sie rollen und hinken hinaus. Er wartet, bis der Raum sich geleert hat, und hilft noch einer Oma, deren Krücke sich zwischen den Stühlen verkeilt hat und die prompt in Tränen ausbricht und ihre Sünden beklagt. Isidor versucht, die Oma zu beruhigen, die offenbar ihre Sündhaftigkeit nach dem Maß der empfundenen Strafe einschätzt: ihrer Gebrechlichkeit. Endlich ist die Frau draußen. Isidor schließt die Tür, widersteht der Versuchung, seine von ihren Tränen nassen Hände am Altartuch abzuwischen, zieht Stola und Albe aus, faltet beide zusammen, legt sie in das Köfferchen und packt die Bücher dazu. Kerzen und Altartücher verschließt er wieder im Altarschrank.
Hätte er die Frau nach ihren tatsächlichen Sünden gefragt, wären wahrscheinlich gar keine herausgekommen, überlegt er routiniert, als er den BMW aus der Tiefgarage hinauf in die Dunkelheit steuert. Er staunt nicht selten über die Vorwürfe, mit denen die Leute sich peinigen. Etwa mit einem vor zwanzig Jahren in einem Hotel gestohlenen Handtuch (das sicherlich für etwas anderes steht, aber für was?). Eine alte Frau aus seiner Gemeinde kommt regelmäßig zur Beichte, weil sie einen Vorwurf ihres Sohnes nicht verwinden kann: Sie hätte einmal gedroht, ihn mit dem Gürtel zu schlagen. Hat sie das wirklich gedroht? Sie erinnert sich nicht, weder an den Gürtel noch an die Drohung; nur an den Vorwurf, aber genau besehen nicht mal an den. Vielleicht hat sie alles nur geträumt? Warum? Sie lügt nicht, aber sie hat weder den Willen noch das Talent zur Wahrheit; einzig ihre Qual ist echt. Möglicherweise. Handtuch, Gürtel und Vorwurf sind Symbole, auf die Isidor mit anderen symbolischen Mitteln antworten muß.
Und vielleicht ist das gut so? Isidor hat einmal einen Ausspruch des Philosophen Jaspers gelesen, sinngemäß: Der Mensch sei mehr, als er von sich wissen könne. Damals las er das gern, sozusagen als Mitteilung über eine Art Gratis-Gutschrift. Inzwischen nimmt er das Gegenteil an: Der Mensch ist viel weniger, als er ahnt. Weil er aber auch das ahnt, will er nichts genau wissen und regt sich lieber andauernd darüber auf, wie viel ihm verborgen bleibt. Die menschliche Seele ist eine Trickkiste. Seltsamerweise erleichtert Isidor auch dieses Konzept, vielleicht, weil es ihn auf seine eigentliche Sendung zurückführt und die einzigen Heilmittel, die bleiben, die nämlich, die Gott zu geben hat: Barmherzigkeit. Gnade.
Trotzdem kann Isidor es nicht lassen, das ihn umgebende Leben ständig nach Wert und Würde abzufragen. Dahinter steht ein philosophisches Privatprogramm, das ungefähr so lautet: Wahrheit und Lüge, Ehrlichkeit und Heuchelei, Moral und Egoismus sind unlösbar miteinander verklumpt; wir reiben uns zwischen spirituellen Sehnsüchten und unspirituellen Tatsachen auf; und geklärt wird nichts, nicht mal im letzten Augenblick. Die Zeit geht über alles hinweg und löscht das Bewußtsein aus, bevor auch nur die Fragen richtig gestellt wurden. Isidors Programm nun besteht darin, daß er die Fragen richtig zu stellen versucht. Eine richtig gestellte Frage hat, ebenso wie ein wahres Wort, erlösende Kraft; das muß mit Gott zu tun haben. Und wenn Isidor einmal rechtzeitig die Frage stellt, die unser aller Existenz erfaßt, wird Gott vielleicht antworten. Wie, ist noch unklar. Aber das ist der mystische Hintergedanke. Unnötig zu sagen, daß Isidor sein Programm vor den Kollegen wohlweislich verborgen hält; er fürchtet ihren Spott. Freund Gregor aus der Nachbarpfarrei Dambach nennt Isidors Hang zu Analyse und Bilanz zwanghaft und meint, Isidor mache das, weil er in seiner Freizeit sonst nichts zu tun habe. Und auch das ist nicht falsch. Fest steht: Als Isidor sich das Programm vor dreißig Jahren ausgedacht hat, als er es erstmals vor sich selbst in Worte faßte mit der Zielsetzung, in dreißig Jahren die Lösung zu haben, da lächelte er über seine Bescheidenheit und freute sich über das tiefgelegte Ziel. Heute findet er, daß es Hochstapelei war.
Bodering
Sie sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir.
(Ex 20,19)
Vor achtundzwanzig Jahren hat Isidor die Stelle in Bodering angetreten; weil es von seiner letzten Pfarrei nur zwölf Kilometer entfernt war und aus symbolischen Gründen zu Fuß. Die Boderinger boten an, ihn mit Pferd und Kutsche zu holen, aber das wollte er nicht: Vielleicht würde es ihm in Bodering ja nicht gefallen, und auf welche Weise sollte er gehen, nachdem er mit der Kutsche gekommen war? Das Argument leuchtete den Boderingern ein, und viele begleiteten ihn daraufhin auf seinem Fußmarsch, einige sogar von Anfang an, obwohl der Weg fast durchweg bergauf ging. Immer mehr Leute gesellten sich dazu, so daß in Bodering schließlich fast fünfhundert Leute ankamen, eine Prozession. Die Fußgänger sangen ausgelassen, die übrige Gemeinde erwartete sie mit Böllerschützen, Blaskapelle und Feuerwehr. Isidor saß erschöpft und zufrieden zwischen Bürgermeister und Honoratioren und bekam unablässig Spießbraten und Bier gereicht, während ihn alle persönlich und geradezu zärtlich begrüßten.
Bodering liegt im breiten Hochtal des Grammerbachs, der als kleiner Wasserfall vom Grammerberg herunterspringt. Der fast dreizehnhundert Meter hohe Grammerberg begrenzt das Tal nach Norden, der niedrigere, aus einer Reihe kahler Kuppen bestehende Schattenberg nach Süden; nach Osten und Westen schließt jeweils ein kleiner Paß das Tal. Das Klima ist streng, in der Talsenke gibt es bis in den Juni hinein Frost, und in den früheren strengen Wintern lag der Schnee oft anderthalb Meter hoch. Manche Winter waren so hart, daß Wasserläufe und Hausbrunnen einfroren, die Leute ihre Schuppen nicht verlassen und ihre Toten nicht begraben konnten. Bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein gab es Wölfe und Bären. Wenn die Menschen im Herbst und Winter im Dunkeln zum Gottesdienst gingen, nahmen sie zum Schutz brennende Spanlichter mit.
Die Leute waren bitter arm. Getreide wuchs in dieser hohen Lage nicht, es gab nur ein paar Almen, auf denen im Sommer Vieh weidete. Der Ort lebte von der Forstwirtschaft. Fast alle männlichen Boderinger wurden Holzfäller. Sie lebten mit ihren Familien in Blockhäusern, die im Dreck standen, brachen im Morgengrauen auf, keuchten auf Holzschuhen ein bis zwei Stunden lang in die Wälder hinauf, fällten, entasteten, stapelten die vom Forstmeister markierten Bäume, brachten sie im Winter mit großen Hörnerschlitten zu Tal und kamen spät abends zurück, falls sie nicht über die Woche in Rindenhütten im Wald kampierten. Windwurf und Schneebruch forderten Opfer, der Winterzug mit den schwer beladenen Schlitten war besonders gefährlich. Männer brachen sich die Knochen, wurden von Schlitten überfahren und von Bäumen erschlagen oder erdrückt, einige erfroren im Wald. Einige arbeiteten als Köhler und schwelten in von Hand aufgeschichteten Meilern Holz zu Kohle, die waren tagelang beißendem Rauch ausgesetzt und erkrankten an Haut- oder Lungenkrebs. Nur der Forstmeister, der den Holzabbau organisierte, blieb gesund. Er war der mächtigste Mann des Orts, denn Wohl und Wehe der Region hingen von ihm ab. Er wohnte in einer Barockvilla wie ein kleiner Fürst.
Einzelne Boderinger arbeiteten im Bergwerk des Nachbarorts Grammering, wo seit dem Mittelalter Eisenerz gebrochen und verhüttet wurde. Von denen starben viele an Silikose. Die Grube wurde nach dem zweiten Weltkrieg aufgelassen. Den letzten überlebenden Bergmann hat Isidor noch kennengelernt: Die Boderinger nannten ihn den Staublungen-Clemens. Er lag sommers im Liegestuhl in seinem Garten und rang nach Luft, bis er in Isidors siebtem Boderinger Jahr qualvoll erstickte.
Hundertfünfzig Jahre lang bestand in Bodering ein Benediktinerkloster, das 1803 mit der Säkularisierung aufgehoben wurde. Bildungsmöglichkeiten gab es danach für die Boderinger nicht mehr: Die Verkehrswege waren zu schlecht, die Entfernungen zu groß. Wer studieren wollte und konnte, ging hinunter in die Klöster und Städte im altbesiedelten Land und kehrte nicht zurück.
Die Wende für Bodering kam erst nach dem letzten Krieg, als Bodering für den Fremdenverkehr entdeckt wurde. Die Boderinger hatten immer den Ruf gehabt, hart und ausdauernd arbeiten zu können. Nun wurden sie auch für Flexibilität und Initiative bekannt. Rasch eigneten sie sich das Dienstleistungsgewerbe an. Sie beherbergten zur Ferienzeit Gäste in ihren Wohnungen, während sie selbst in die Keller oder Speicher auswichen, und bauten außerhalb der Saison Häuser mit Gastzimmern und Einliegerwohnungen. Alle Häuser hatten Balkone mit Holzverzierungen und Geranien über die ganze Front. Die Boderinger schnitzten und schreinerten unermüdlich, »die reinsten Holzwürmer« hat Isidors Vorgänger sie genannt. Die Söhne arbeiteten im Winter als Skilehrer. Einige Skihaserl aus Berlin, Belgien und Holland