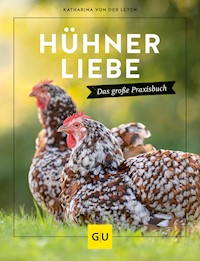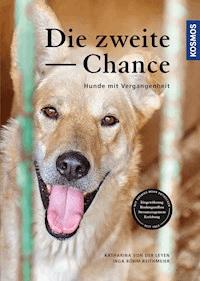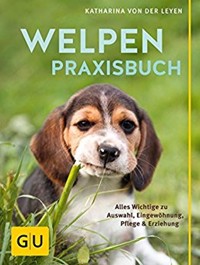9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Locker, sehr komisch und pointiert erzählt Katharina von der Leyen vom Leben ihrer Hunde auf dem Land. Sie genießt Wald und Wild so weit das Auge reicht. Aber sie muss feststellen, dass das Hundeleben zwischen Schafskötteln als Delikatesse und nervösem Federvieh beim Bauern nebenan so manche Herausforderung zu bieten hat. Ein Hundebuch zum Lachen, Schmunzeln und ein bisschen auch zum Weinen – für alle, die Hunde lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können die Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
1
Schwer zu sagen, wann ich auf die Idee kam, aufs Land zu ziehen. Ich war ein überzeugter Stadthundehalter, und plötzlich begann ich, vom Leben auf dem Land zu träumen. Zuerst so, wie man sich vorstellen mag, einmal im Segelboot nach Tahiti zu reisen. Ich hatte nicht vor, mir Hühner anzuschaffen und morgens die Eier einzusammeln (abgesehen davon, dass meine schwarze Großpudelin Luise die Hühner im Nullkommanix erjagt hätte), ich wollte nie Tomaten züchten, Radieschen ernten, Naturkosmetik verwenden und einen Komposthaufen anlegen. Ich vertrage Dr. Hauschka und Radieschen nicht, und wenn ich etwas kompostiere, dann nur aus Versehen in meinem Kühlschrank.
An meinen Hunden lag es nicht. Sie schätzten das Leben in der Stadt durchaus, wo kein Spaziergang dem anderen gleicht; sie mochten den beiläufigen sozialen Austausch mit anderen Hunden, freuten sich über Grillabfälle im Park und genossen es, im Café von Fremden umworben zu werden. Gerade Spaziergänge in der Stadt gehen für Hunde weit über das hinaus, was wir Menschen an der frischen Luft erfahren: Was für uns ein wenig Bewegung an Hauswänden entlang ist, wobei man sich den Wind durchs Haar streichen lässt, ist für den Hund Meter für Meter ein kreatives Ventil, ein Abenteuer für die Seele; es bringt ihn in Kontakt mit seinen Instinkten, also seinen Vorfahren. Wir Menschen können die wahren Dimensionen eines Hundespaziergangs nicht einmal erahnen: Der Hund hat die unglaubliche Chance, an eine Hausecke zu pinkeln, an die Hunde seit einem halben Jahrhundert gepinkelt haben (das muss für Hunde ungefähr so sein, als würden wir jeden Tag im Louvre oder in der Pinakothek spazieren gehen). Kein Hund muss so viel aufs Klo, wie es innerhalb eines Spazierganges den Eindruck macht. Hunde improvisieren. Sie wollen die Gesamtzahl ihrer Rivalen übertrumpfen. Jeder Grashalm ist eine Art Gästebuch, das von jedem Hund der gesamten Nachbarschaft unterschrieben wurde. Jeder Fußabdruck hat eine Bedeutung, jedes Loch, das irgendwo hinführt, oder irgendwann mal irgendwohin geführt hat und jedes kleine Tier – am liebsten ein totes Tier, ölig, gelatineartig oder auch jede Art unidentifizierbarer Glibber, der im Dreck altern durfte und einen unwiderstehlichen Geschmack entwickelt hat. Es gibt viel mehr Essbares, als Menschen sich je erträumen können.
Die Hunde, die damals mein Leben teilten, waren Luise und Ida, eine schwarze und eine braune Großpudelhündin, und Harry und Fritz, zwei Italienische Windspiele vom amerikanischen Typ und damit etwas größer und bunter als ihre europäischen Vettern. Die schwarze Luise war der Anführer der Truppe, der ruhende Pol und personifizierter Beweis dafür, dass echte Anführer mit Ruhe und Souveränität regieren, nicht mit gefletschten Zähnen und Sanktionen. Sie verströmte so viel Adel, dass die meisten Menschen, die sie kennen lernten, kurz geneigt waren, den Hund zu siezen und ihm magische Fähigkeiten zusprachen. Ich dagegen fand häufig, sie sei eher so etwas wie eine Hexe, hochgradig manipulativ und von einem Selbstbewusstsein, das man sonst nur von schönen Frauen kennt, die obendrein auch noch sehr reich sind. Luise war eine Diva mit großem Charme und ausgeprägtem Sinn fürs Wesentliche, die Kinder liebte, ein hervorragender Therapie-Hund war und einen auserlesenen Sinn für Humor besaß. Ida dagegen war wie die kleine freche Schwester von Luise; eine braune, gutgelaunte Hupfdohle und so weit entfernt vom Divatum wie Cindy Crawford von Oleg Popow, dem Clown. Sie war unglaublich vergnügt, besaß im Gegensatz zu Luise nicht den geringsten Jagdtrieb und liebte die ganze Welt. Mein Windspiel Harry trug seinen Namen wegen des Hitchcock-Films „The Trouble with Harry“. Er kam zu mir mit einer massiven Angststörung, die nicht auf irgendwelche Erlebnisse zurückzuführen, sondern leider Teil seiner Persönlichkeit war. Kein Hund kostete mich so viele Nerven wie dieser zarte, empfindliche Sechs-Kilo-Hund, der für unendlich viel Streit mit fremden Menschen sorgte, die sich von seinem hysterischen Gekläffe – einer schrillen Mischung aus „Kikeriki“ und „Tatütataa“ – provoziert und angegriffen fühlten, der aufgrund seiner Angst-Pieselei so viel Küchenrolle verbrauchte, dass wir wahrscheinlich mehrere Hektar Wald auf dem Gewissen haben, und der alle Jahre wieder in genau dem Moment, in dem das Thermometer unter 15 Grad (plus) fiel, begann, dramatisch mit den Zähnen zu klappern und sich mit leidend geschlossenen Augen auf den jeweiligen Weg setzte, ein Bild zum Erbarmen. Gleichzeitig hat Harry mir natürlich unendlich viel beigebracht, obwohl ich immer dachte, ich wisse schon längst alles über Hunde. Ich kenne mich seinetwegen heute hervorragend mit Angst- und Stresssymptomen aus, weiß, welche Hilfestellungen man geben kann und welche Massagetechniken wirken. Es ist doch so: Jeder bekommt den Hund, den er verdient, den er braucht, und der ihn weiter bringt. Darum bekommen so viele Leute, die sich ganz blauäugig und ohne nachzudenken auf das Abenteuer Hund einlassen, oft die einfachsten, unproblematischsten Hunde, während die, die alles richtig machen wollen, solche Hunde erwischen, für die man eigentlich ein Studium in Verhaltensbiologie braucht, auf jeden Fall aber Gelassenheit, Ruhe und die Fähigkeit, den anderen – und sei es der Hund – erst einmal so anzunehmen, wie er ist, und dann mal weiterzusehen.
Inzwischen ist Harry kein Angsthund mehr, nur noch etwas kapriziös und kompliziert – und auch nicht mehr ganz so zart, weil etwas übergewichtig: Er sieht eher aus wie ein Baby-Grauwal. Ich schiebe seinen unmäßigen Appetit darauf, dass er seine Speckschicht eben als Schutzhülle gegen die Unbill des Lebens braucht.
Fritz ist dagegen ein als Windspiel verkleideter Labrador: Nerven aus Drahtseil, selbstbewusst, frech und draufgängerisch, furchtlos und vergnügt. Ich bekam ihn, weil es deutlich war, dass Harry sich nicht genug an den Pudeln orientierte, sondern offenbar seinen eigenen Phänotyp brauchte, um sich wirklich sicher zu fühlen. Fritz, obwohl ein Jahr jünger, nahm Harry buchstäblich an die Hand und half dem Zitteraal, sich in seinem Windschatten dem Leben zu stellen.
2
Der absolute Tiefpunkt meines Daseins als Stadthundemensch begab sich in einer nieselregnerischen Nacht gegen halb zwölf. Ich wartete müde darauf, dass Fritz sich als letzter meiner Vierer-Truppe endlich löste. Er drehte und wendete sich, versuchte es an anderer Stelle, drehte, krümmte und wendete sich wieder. Ich bückte mich schließlich, um genauer nachzusehen, was sein Problem war. Von den Straßenlaternen erleuchtet sah ich etwas weißes, schnurähnliches aus seinem Hinterteil ragen. Ich zog mir einen der Kotbeutel, die man in jeder meiner Jacken-und Manteltaschen, jeder Hand- und sogar jeder Abendtasche findet, nach Art eines medizinischen Handschuhs über die Hand und zog. Das Weiße war lang und gab irgendwie nach, und am anderen Ende war ein rundes kleines Metallstück. Als ich – zu Fritzens unbändiger Freude und Erlösung – endlich das ganze Ding in der Hand hielt, erkannte ich, was es war: Der Träger eines vormals weißen BHs.
In meiner Nähe stand eine Gruppe Teenager, die sich gleichzeitig bogen vor Lachen und schüttelten vor Ekel. „Boah ey, voll eklig!“ quietschte es zwischen Kicher-Gejapse und Gegeneinanderfallen.
Ich versuchte, würdevoll und kultiviert auszusehen, was völlig unmöglich ist, während man einen BH-Träger unbekannten Ursprungs in nicht mehr einwandfreiem Zustand in einer kotbeutelbehandschuhten Hand hält.
Weil man mit Hunden zwangsläufig einen Großteil seines Lebens auf der Straße, im Park oder im Wald verbringt, wird man mit ihnen automatisch zu einer Art öffentlicher Person. Man wird ansprechbar, Fremde bewerten einen anhand des sich gerade mal gut oder schlecht benehmenden Hundes am anderen Ende der Leine. Man wird ständig angesprochen, belehrt, befragt, beurteilt. Wenn man mit Hunden zusammenlebt, begreift man plötzlich, wie es sein muss, mit einem Prominenten verheiratet zu sein: Überall lauern Papparazzi, und (natürlich völlig unwahre) Schlagzeilen wie „Außer Rand und Band: Harry macht, was er will – bekommt Katharina ihn wieder in den Griff?“ sind die Kommentare der Umwelt.
Während ich so da stand mit dem BH-Träger in der Hand und einem Windspiel, dass sich vor Erleichterung über seinen befreiten Darm kaum einkriegte vor Freude, wuchs in mir das akute Bedürfnis nach mehr Privatsphäre. Nach einer Welt ohne Schulbrote, Scherben, Sperrmüll und BH-Träger am Straßenrand (oder wo zum Teufel hatte Fritz das Ding her? Und wer verlor überhaupt irgendwo einen einzelnen BH-Träger auf der Straße oder im Park? Und wie wurde ich dieses Kopfkino jetzt wieder los?).
Es gab diese Gefühle in meinem Leben schon häufiger. Mein Leben lang war ich hin- und hergerissen zwischen den Vorteilen der Stadt – erreichbare Restaurants, sich mal eben mit irgendjemandem im Café um die Ecke verabreden, mal kurz eine Ausstellung ansehen zwischen zwei Terminen – und der Ruhe auf dem Land, Vogelgezwitscher statt Polizeisirenen bei offenem Fenster, Hundespaziergänge, die gleich an der Haustür begannen, ein Kopf, der durch den Spaziergang mit Hund frei und leicht wurde – und nicht auf dem kurzen Weg von meiner Wohnung zum Viktoriapark völlig überladen von Bildern, die mich den ganzen Tag beschäftigten, von dem alten Mann, der zwei Häuser weiter wohnte und immer wieder mit nassen Hosen herumlief, einem Junkie, der vor einer Bäckerei an einen Baum gelehnt auf die Erde rutschte, oder jugendlichen Touristen, denen vor meinen Füßen die Bierflasche aus der Hand rutschte und in tausend Scherben zerbrach, sodass ich nicht mehr wusste, wohin ich mit meinen Hunden treten sollte. „Oh sorry“, sagte der Junge mit betroffenem Gesicht. Das half mir in diesem Moment auch nicht weiter. Und die Typen auf den Schimmeln, die einem die Hand reichen und einen aufs Pferd ziehen, kommen leider nie dann vorbei, wenn man sie wirklich braucht.
Der Traum vom Landleben wurde immer mehr zum Tagtraum, je mehr irrisnnig angespannte Tai-Chi-Ausübende und schnaufende Marathonläufer die Parks für sich beanspruchten. Oder Kampfradfahrer, die pfeilschnell über die Gehwege fegten und für die jedes Bremsen das Eingestehen einer Charakterschwäche war und Hunde Freiwild bedeuteten. Oder jene Sorte humorbefreiter Mütter, die mit ihren technisch hochgerüsteten Kinderwägen mit ihren gleichartig ausgestatteten Freundinnen auf dem Weg zum nächsten Latte Macchiato wie eine Kampfgeschwader-Formation den ganzen Bürgersteig einnehmen und Hundebesitzer als eine Mischung aus bakterienverbreitenden Untermenschen und Kleinkriminellen betrachten. Sollte das Kind wider ihrer ausdrücklich entgegengesetzter Erziehung Interesse an einem fremden Hund bekunden, werfen sie sich vor den Buggy, weil sie offenbar in jedem zitternden Italienischen Windspiel eine reißende Bestie vermuten, während sie gleichzeitig das ohrenbetäubende Gekreisch ihrer empörten Brut für einen Engelschor halten („Ich will den Hund streicheln! ICH WILLICHWILLICHWILL!“).
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich habe Kinder wirklich gerne. Ich habe nur mit manchen Müttern meine Probleme.
Irgendwann ging ich in Kreuzberg, wo ich wohnte, nachts nochmal mit den Hunden auf die Straße für die letzte Runde. Es war halb eins, ich hatte den ganzen Tag geschrieben und war todmüde. Neben meiner Haustür standen zwei Jungs so um die siebzehn. „Guck’ mal, scheiß Pudel“, sagte der eine. „Voll zum Kotzen, die Viecher. Aber guck’ dir die Tussi dazu an. Ey du, was kosten deine Pudel?“ (Ich versichere Ihnen: Meine Pudel sahen niemals aus wie Karikaturen ihrer Art, und ich selber würde so wenig als Mitglied der Jakob-Sisters durchgehen, wie man mir abnehmen würde, die Schwester von Daniela Katzenberger zu sein.) Aber möglicherweise war das der ausschlaggebende Moment, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich weiß es nicht mehr genau.
Tatsache war: Mir wurde die Stadt zu eng – obwohl die beklagte Stadt Berlin war, die so groß ist, dass man von einem Stadtteil in einen anderen durchaus mehr als eine Stunde braucht. Der Verkehr wurde immer wahnsinniger, die Menschen immer gestresster. Ich hatte meine Schwierigkeiten mit den Umgangsformen: Wenn einen auf dem Bürgersteig eine Radfahrerin so laut von hinten anklingelte, dass ich mitsamt meinen Hunden vor Schreck einen Satz ins nächste Gebüsch machte, mir das Ganze aber als rücksichtsvolle Maßnahme verkauft wurde und ich solle mich gefälligst nicht so erschrecken, fiel es mir irgendwie schwer, den fürsorglichen Gedanken dahinter zu entdecken. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, ob es der Stress oder die berühmte „Berliner Schnauze“ war, die daran schuld war, dass man dauernd so flegelhaft angeschnauzt wurde. Was ist eigentlich aus dem allerschlichtesten Imperativ der Weltanschauung geworden: „Seid nett zueinander!“? Man kommt sich vor wie ein veralteter Ur-Sozi, wenn man sich nach solchen Utopien sehnt.
Der Dreck in den Straßen Berlins wurde immer mehr. Berlin ist fest davon überzeugt, dass es an einem Hundekot-Problem leidet, aber ich startete einmal für eine große Sonntagszeitung den Gegenbeweis und hielt genau fest, was da so alles am Straßenrand lag: Glauben Sie mir, die Hundehaufen waren das allerkleinste Problem. Noch dazu wohnte ich in Kreuzberg um die Ecke von gefühlten siebenundzwanzig Jugendherbergen. Das bedeutete, dass vor allem nach heißen Berliner Sommernächten die Gehwege übersät waren von Flaschenscherben, denn Touristen kommen vor allem deshalb nach Berlin, um die dortigen Abgründe zu erleben (was wahrscheinlich ganz im Sinne des damaligen Bürgermeisters war, der seinerseits vor allem als Partymeister von sich reden machte). Ganze Rotten aus jungen internationalen Touristen veranstalteten alkoholgestützte Wanderungen durch Kreuzberg (Motto: „Drinking in the streets of Berlin!“), sodass die Teilnehmer angetrunken und entspannt grölend durch die nächtlichen Straßen zogen, in die malerischen Haueingänge pinkelten und ihre Flaschen klirrend fallen ließen. „Oops, sorry!“ lallten sie, wenn das genau vor meinen und den Füßen meiner vier Hunde geschah, sodass ich mit den Pudeln und den Windspielen weder vor, noch zurück konnte und ich schlicht nicht über die Kapazitäten verfügte, zwei Großpudel und zwei Windspiele gleichzeitig über die Scherben zu tragen. Bin ich Jesus? Wenn ich mich recht erinnere, konnte der auch nur über Wasser laufen.
Der Traum vom Leben auf dem Land erschien mir immer mehr als echte Alternative: Nachts mit meinen Hunden vor die Tür gehen zu können, ohne Gehirn und Mundwerk im permanenten Stand-by auf Retourkutschenbereitschaft zu halten. Einfach mal vor sich hinlatschen zu können, ohne rechts und links nach Gefahren auf dem Bürgersteig Ausschau halten zu müssen.
Ich gebe zu: Meine Landlust hatte etwas von „Unsere kleine Farm“; ich stellte mir meine Hunde vor, die vergnügt und leinenfrei durch Gräser hopsten und ich entspannt hinterher (wenn auch ohne Zöpfe und Rüschenkleid), wie sie im Garten chillten oder sich amüsierten, während ich langweilige Stunden am Computer hockte. Und obwohl ich der Meinung bin, dass man Hunde zum Allgemeinwohl gerade in der Stadt braucht, weil sie Natur in die Stadt bringen und damit die Stadt menschlicher machen, machte ich mich davon.
Gleich vor Berlin beginnt nämlich ein landschaftliches Paradies. Um Berlin herum gab es überall geradezu jungfräulich-unberührte Natur; Landwirtschaft hatte hier nur unwesentlich stattgefunden, und weil die Berliner jahrzehntelang nicht über die Mauer hinaus gekommen waren, konnte auch von Zersiedelung keine Rede sein. Wenn man in Ruhe mit seinen Hunden laufen und/oder trainieren wollte, musste man nur eine halbe Stunde über den Prenzlauer Berg hinaus fahren, und war mitten im schönsten, tiefsten, einsamsten Wald, in dem Kraniche, Fuchs und Störche sich gute Nacht sagten und Rehe wenig zu befürchten hatten. Ich fuhr häufig in die Nähe eines alten Lungensanatoriums aus dem 19. Jahrhundert, eine Art Thomas Mann’scher „Zauberberg“, das seit fünfzig Jahren verlassen in einem eingezäunten Park lag und einen verwunschenen Eindruck machte. Wildschweine, Füchse und Rehe lebten dort friedlich und unbescholten, Fledermäuse und Tauben nisteten unter den alten Dächern. „Da sollte man mal was draus machen“, dachte ich manchmal flüchtig, während ich auf verschlungenen Pfaden mit den Hunden spazieren ging, unbehelligt von Kampfradlern, die sich in Parks, im Grunewald oder am Schlachtensee wie Gurkha und Combat-Man zugleich benahmen. Pfeilschnell ziehen sie ohne Furcht und Tadel ihre Rennmaschinen mit Tundra-tauglichem Crossbikerprofil über die Waldwege. Nichts kann sie aufhalten, am allerwenigsten ein paar Hunde, die verträumt von links nach rechts traben und den Gerüchen der Natur frönen: Die sind für Sportradler nur Sparringspartner, Gegner im bewegten Dschungelcamp des Lebens. Nicht, dass meine Hunde sich derlei Respektlosigkeit gefallen ließen. Harry verfolgte Radfahrer hartnäckig mit ohrenbetäubendem Gekreisch, während Luise, die ich meistens für mein besseres Selbst hielt, einen ganz perfiden Trick anwandte, den sie im Viktoriapark in Kreuberg perfektioniert hatte: Dort gab es Fahrradfahrer, die der Meinung waren, Straßen, Wege und Pfade gehören nun einmal ihnen, und alles, was ihnen im Weg stand, unter die Erde. Stand man zufällig in einer kleinen Gruppe zusammen auf einem Weg und unterhielt sich, fuhren sie nicht etwa bequem auf den sehr breiten Wegen um die kleine Gruppe herum, sondern mitten durch die Unterhaltung durch und so eng an den Hunden vorbei, dass deren Barthaare die Speichen berührten. Luise fand, dass für diese Radler nicht die normalen Maßstäbe der menschlichen Existenz galten. Sie stellte sich mitten auf den Weg, machte einen ganz langen Hals und legte in aller Ruhe ihr perfektes Scherengebiss um die stramme Wade des nächsten Radfahrers, der ihr zu nahe kam. Das Geschrei war jedes Mal groß. Aber Luise bestand bei Fahrrädern auf einer Individualdistanz von mindestens sieben Zentimetern. Ich gebe zu: ich teilte diese Haltung.
Bei irgendeinem Spaziergang an dem alten Krankenhauskomplex vorbei entdeckte ich dann eines Tages menschliche Bewegung auf dem Gelände: Die Gebäude wurden saniert. Wochenlang verfolgte ich die polnischen Bauarbeiter, um herauszufinden, wer das Projekt machte, wann es fertig sein würde, was es überhaupt werden sollte, und ob sie mir mal die Nummer des Bauherren geben könnten. Die Arbeiter verstanden kein Deutsch, hielten mich aber aufgrund meiner offensichtlichen Sprachstörungen (ich versuchte, mich mit einer Mischung aus Deutsch, Englisch und wenigen Brocken Polnisch, die ich aus den Tiefen meines Hirns hervorkramte, irgendwie verständlich zu machen, begleitet von ausladenden Gesten, die mir als Sichtzeichen mit meinen Hunden immer gut geholfen hatten) für eine übergeschnappte Waldhexe und suchten das Weite, sobald sie mich herankommen sahen.
Irgendwann outete sich der Bauherr über ein großes Schild, auf dem das Projekt als Denkmalschutz-Wohnungsbau gepriesen wurde, mit einer glücklich lächelnden Familie darauf und einem gewaltigen, freundlich blickenden Hund neben sich. Obwohl die Hundehaltung auf der ganzen Welt immer mehr erschwert wird mit Verordnungen, Regularien, Steuern, Angstmacherei in den Medien (jedenfalls war das so, bevor sich die Zeitungen darauf verständigten, dass Muslime viel gefährlicher waren als Hunde, die just ab diesem Moment keine einzige Schlagzeile mehr wert waren), sind sie in der Werbung immer noch ein weltweites Symbol für Familienfreundlichkeit und Natürlichkeit. Das Foto auf diesem Schild hatte man offensichtlich einer amerikanischen Agentur abgekauft und nicht bemerkt, dass der große, treuherzig blickende Hund ein American Bulldog war – eine Rasse, die aufgrund ihrer angeblichen Gefährlichkeit hierzulande als so genannter Kampfhund geahndet und mit unglaublich erhöhten Steuern, Wesenstest und Auflagen wie kurzen Leinen und dem Tragen von Maulkörben belegt wird. Wahrscheinlich erschloss sich die Ironie des Familien-Plakates auch nur mir.
Also galoppierte ich nach ein paar Monaten in den ehemaligen Klinikgebäuden treppauf, treppab im Gefolge der Maklerin, die für das Objekt zuständig war. Ich war die Erste, die sich für eine Wohnung interessierte, und hatte die schreckliche Qual der Wahl zwischen bisher achtunddreißig Wohnungen, die alle über unterschiedliche Vorzüge verfügten. Bis auf die Bauarbeiter und deren Maschinerie gab es hier nichts: Keinen Bus, keinen Verkehr, keinen Briefkasten, vorläufig noch keine Nachbarn.
Es war himmlisch.
Meine Freunde dagegen wurden sehr nervös. Sie machten sich Sorgen. Für die meisten Berliner beginnt direkt an der Stadtgrenze eine gefühlte Gefahrenzone, unruchbares Gelände mit verlassenen Geisterdörfern, die letzte Gegend Europas, in der es keinen Starbucks gibt, und wo einem als Cappuccino noch säuerlicher Kaffee mit Schlagsahne serviert wird. Anders als in allen anderen Städten fährt in Berlin fast niemand wochenends aufs Land: Historisch hatten die Westberliner keine Verwandten oder Wochenendhäuser dort; das Äußerste, was der Westberliner vor der Wende an Natur zu sehen bekam, war seine Laube. Eine Ausnahme machen heutzutage jene, die die Uckermark für sich entdeckt haben, eine feine, intellektuelle und recht betuchte Gruppe, eine Art „Toskana-Fraktion“ Berlins, die freitags in ihr Auto steigen und ohne anzuhalten bis zu ihrem Ziel am Ober- oder Unteruckersee durchfahren. Man weiß ja nie, was unterwegs alles lauert.
Als ich also meinem Umfeld Mitteilung machte, ich würde demnächst von Kreuzberg aufs Land ziehen, waren alle um mich herum ins Mark getroffen. Es waren düstere Prognosen, die ich zu hören bekam: „Dann wird man dich ja wohl nie wieder zu sehen bekommen, du wirst völlig vereinsamen“ oder „Und die Neonazis?“ oder „Ich gebe dir zwei Jahre, dann bist du wieder da“ oder „Gibt’s da überhaupt Geschäfte?“
Ich möchte darauf hinweisen, dass meine neue Behausung schlappe 16 Kilometer von Mitte entfernt war. Es zeigt die spezielle Situation Berlins, dass praktisch einen Meter hinter der Stadtgrenze übergangslos ausgeprägtes Landleben inklusive Forstwirtschaft beginnt. Und es macht auch die besondere Situation Berlins deutlich, in dem die Mauer ganz offensichtlich noch fünfzehn Jahre nach deren Fall so präsent war, dass die meisten Leute niemals auf die Idee kamen, eine Landpartie zu machen. Den Spreewald kennen die meisten Zugereisten Berlins bis heute nur aus dem Fernsehen, und die „Spreewald-Krimis“ mit Mord und Totschlag machen ihnen die wirklich sehr schöne Gegend auch nicht sympathischer. Andere verloren sich in Argumenten, dass sie niemals ohne unmittelbare Nähe zu ihrem Lieblingsrestaurant überleben könnten und ihre Teenager nicht ohne Kinos, Discotheken und Einkaufscenter, und was überhaupt mit dem Feierabendverkehr sei?
Keines dieser Argumente hatte irgendetwas mit mir zu tun. Ich hatte keine Teenager im Haus, ich musste mich auch nicht in der Rushhour in den Verkehr werfen, weil ich meistens zu Hause arbeite, und es gab selbst am Stadtrand einen gut sortierten Supermarkt, in dem man Wasabi-Kartoffelchips erwerben konnte. Was wollte ich mehr?
Stattdessen sparte ich von nun an unendlich viel Zeit, weil ich nicht mehr jeden Tag Kilometer um Kilometer zurücklegen musste, um mit meinen Hunden vernünftig spazieren gehen zu können und nicht nur Runde um Runde in zugemüllten Berliner Parks zu drehen.
Das war das einzige Argument, das meine Freunde gelten ließen. „Na klar, die Hunde! Für die ist das natürlich schön.“
Das Leben auf dem Land ist tatsächlich vor allem für mich schön. Habe ich Hunde, weil ich so gerne draußen bin oder bin ich so gerne draußen, weil ich Hunde habe? Die Frage erübrigt sich mittlerweile; mein behundeter Zustand hält schon über fünfunddreißig Jahre lang an. Das große Glück ist: Ich finde schon von Kindesbeinen an so ziemlich die gleichen Dinge großartig, wie meine Hunde auch (abgesehen von dem Wälzen in stinkigen, glibberigen Dingen. So weit gehe ich dann doch nicht). Ich finde nichts schöner, als lange Spaziergänge durch die Landschaft. Ich kann stundenlang irgendwo im Wald herumstehen und Eichhörnchen beim Spielen zusehen, dem Specht zuhören oder in feste Netze eingewickelte seltsame Raupen beobachten, um die herum Ameisen mit ADHS klettern, in der Hoffnung, irgendwo ein Loch in der Netz-Barrikade zu finden, um die hellgelben Raupen anzuzapfen. Und so, wie meine Hunde sich im Sommer in kühle Pfützen oder Ufermatsch legen, um sich abzukühlen, mag auch ich das Gefühl von weichem Modder zwischen den Zehen. Heute früh stand ich eine halbe Stunde in der Sonne und sah zwei verliebten Kolkraben zu, die sich in atemberaubendem Flug in die Tiefe stürzten, mit Trudeln, Schraubenbahnen und heiseren Rufen, mit denen das Männchen um die Gunst seiner Angebeteten warb. Dabei hätten die meisten Kolkraben diesen Aufwand gar nicht nötig, sie leben nämlich in monogamer Dauerehe, bis dass der Tod sie scheidet (auf diese Vorlage jetzt mit einem menschlichen Vergleich zu reagieren, spare ich mir jetzt. Wir wissen alle, was jetzt in Ihrem Kopf passiert). Ich treffe auch gerne andere Menschen und ihre Hunde unterwegs, erfahre interessante Dinge bei diesen Unterhaltungen, beobachte meine Hunde, die fremden Hunde und werde auf meinen Spaziergängen täglich schlauer. Und das ist es doch, was wir vom Leben wollen, oder?
3
Der Umzug aufs Land barg unendliche Überraschungen.
Zuerst einmal musste man sich an diese Stille gewöhnen: Hörte man jemanden im Umkreis von 30 Metern husten, saß man sofort kerzengerade im Bett und konnte nicht mehr einschlafen. Ich hörte Blätter fallen und Vögel flattern und einen offenbar empörten Nachtvogel, der mit lautem „Kiwitt! Kiwitt!“-Geschrei das Leben oder seine Einsamkeit beklagte. Erst mithilfe einer Singvogel-CD konnte ich das Geräusch als Ruf des Waldkauzes identifizieren. Bisher kannte ich nur deren „Huhuuu“ und hielt mich damit, was Tierstimmen betrifft, schon für ziemlich trittsicher. Ich schlief das erste Mal seit 1986 durch, nicht länger gestört von früheren nächtlichen Hof-Situationen wie weinenden Kindern, heimkehrenden Nachbarn, die angetrunken versuchen, ihr Fahrrad anzuketten, solchen, die im Morgengrauen mit Rollkoffern über den Hinterhofasphalt spazieren oder sich zu nachtschlafender Zeit bei offenem Badfenster die Haare fönen. Ich musste mir nach all den Jahren tatsächlich einen Wecker kaufen.
Mein Tagesablauf veränderte sich völlig: Warf ich mich vorher morgens ins Auto, um meine Hunde in einen Park zu chauffieren, spazierte ich jetzt in Gummistiefeln aus meinem Tor und ging ohne Umwege und direkt in den Wald. Ich holte mir keinen Latte Macchiato mehr im Café an der Ecke ab, aber das war schließlich nichts, was meine Espressomaschine nicht auch hinbekam. Statt ständigen Konflikten mit Ordnungsamtbeamten und angeleinten Hunden, die keinen Kontakt zu anderen Hunden haben durften, aus dem Weg zu gehen, stand ich eine halbe Stunde auf einem Weg und sah einem Konflikt zwischen einer Blindschleiche und einem Regenwurm zu, wobei die Schlange versuchte, den Regenwurm quer zu verspeisen, was einfach nicht funktionieren konnte, weil ihr Maul nicht breiter war als der Regenwurm. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihr das klar machen sollte. Selbst dem Regenwurm wurde es irgendwann zu mühselig, woraufhin er sich einfach von einer Körperhälfte trennte. Einkäufe erledigte ich nicht mehr zwischendurch auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo anders, sondern nach sorgfältiger Planung. Das spart übrigens sehr viel Zeit; auf dem Land kann man auch nicht mehr zur Ablenkung „mal schnell“ einen Kaffee trinken gehen oder dreimalhintereinander einen einzelnen Liter Milch kaufen, wenn man in seinem Artikel stecken bleibt. Als Arbeitsverhinderungsmaßnahmen boten sich von nun an ganz andere Möglichkeiten, wie Rasenmähen, Hecken beschneiden oder Clematis anpflanzen.
Andere gingen samstags auf die Friedrichstraße oder nach Mitte, ich ging zum Shoppen in den Baumarkt. War ich bisher gut informiert über die Kollektionen von 7ofallmankind und Bottega Veneta, kannte ich mich bald mit dem kompletten Rasensamensortiment aus und wusste, welche Sorte Dünger mein spezieller Rasen (stark strapaziert, gleichzeitig im Schatten gelegen) bevorzugte – den nämlich, der Hühnerkacke enthält, was gemeinhin als „Guano“ angepriesen wird.Mir machte keiner mehr etwas vor mit Blumenzwiebelpflanzgeräten.
4
Das Haus, in dem unsere Wohnung lag, war das ehemalige Küchengebäude des Sanatoriums und lag direkt am Waldrand. Für die Hunde begann da draußen ein ganz neues Leben. Hatten wir in der Stadt auf dem Weg von der Straße in den zweiten Stock den Großteil von Staub und Sand bereits im großzügigen Treppenhaus abgeschüttelt, verteilten sie nun Waldboden, kleine Zweige, Grünzeug und angetrockneten Matsch geschickt im Flur. Barfuß fühlte sich mein Parkettboden bald an wie ein weicher Waldpfad. Den Sand im Bett verkaufte ich mir als natürliches Körperpeeling – war ich nicht an den Stadtrand gezogen, weil ich naturnäher leben wollte? Meine Hunde sprangen ausgelassen auf dem frisch angesäten Rasen herum und wieder die Stufen hinauf ins Wohnzimmer aufs Sofa, das sie als eine Art Abschussrampe benutzten, um sich wieder die Stufen hinunter in den Garten zu katapultieren. Ich verstand jetzt, warum der „Landhaus-Stil“ immer „shabby chic“ genannt wird – mein grünes Samtsofa, das zahllose Umzüge von Los Angeles nach Hamburg nach München nach Berlin und nun aufs Land schadlos überstanden hatte, wirkte im Nullkommanix schäbig. Bloß nicht mehr so schick.
Der ganze Klinikpark war hoch eingezäunt, um das Wild draußen zu halten, das in den letzten Jahrzehnten die Anlage für sich beansprucht hatte. Nachts gingen wir nun spazieren, ohne uns um Glasscherben, Betrunkene oder den Kreuzberger Pitbull-Besitzer kümmern zu müssen, der stets mit Schlagstock unter dem Arm spazieren ging. Manchmal machte ich die letzte Runde mit den Hunden sogar im Nachthemd; es war ja keiner da, der sich hätte wundern können (ich gewöhnte mir das allerdings wieder ab, sobald mehr Nachbarn in die Häuser einzogen). Statt späten Gästen, die aus Kneipen taumelten, trafen wir nun allerdings auf Kaninchen, Waschbären, die sich fauchend auf den Mülltonnen aufrichteten (was den armen Fritz so erschreckte, dass er den gesamten Abendspaziergang lang bellte und sich immer wieder erschrocken umsah) oder anderes Getier, das ich nicht erkennen konnte, hinter dem die Pudel aber mit Begeisterung her schossen und im Dunkel der Nacht verschwanden. Das legte sich nach kurzer Zeit, als sich die erste Aufregung über die neuen Gerüche und fremden tierischen Nachbarn entspannt hatte.
Es war natürlich viel artgerechter, keine Frage: Wald, Wiesen und ein großer Garten. Letzteren bepflanzte ich mühevoll und lernte nun täglich dazu, welche Pflanzen hundeurinresistent sind, und welche sofort und ohne langes Leiden daran sterben (übrigens ein Ratgeber-Thema, das auf dem Buchmarkt noch völlig unerschlossen ist). Luise, Ida, Fritz und Harry mussten nun im Garten ihre Naturtauglichkeit unter Beweis stellen: Zuerst erschreckte sich Harry, das Italienische Windspiel, vor einem ungefähr daumennagelgroßen Frosch im Gras fast zu Tode, lernte dann aber bald den Umgang mit wilden Tieren aller Arten, lernte Bienen und Hummeln aus dem Weg zu gehen und entwickelte ein erstaunliches Geschick im Fliegenfangen. Die gewonnene Fahrzeit, weil ich nicht mehr quer durch die Stadt in den Grunewald fahren musste, investierte ich nun in intensives Freilauftraining, denn Harry entdeckte bald, dass es viel lustiger war, Rehe statt Fahrräder zu jagen, weil Rehe einen nicht anbrüllen.
Nachdem meine Hunde irgendwann fächerförmig am Horizont verschwunden waren, besorgte ich Scheppleinen in unterschiedlichen Farben. Unsere Spaziergänge wurden zu einer Art Comedy-Serie für alle Jäger des Umkreises, die von ihren Hochsitzen verfolgten, wie ich mit fünf Hunden an bunten, langen Leinen durch Wald und Feld stapfte. Von oben betrachtet musste das aussehen wie eine Art Makramee für Fortgeschrittene.
Schon bald kannten wir alle Rehe beim Vornamen und die Hunde gewöhnten sich an die verwirrende Spurenlage so, wie sie vorher in der Stadt an das Inferno unterschiedlichster Gerüche gewohnt waren. Die Spaziergänge fanden wieder in trauter Gemeinsamkeit statt. Vorsorglich legte ich mir allerdings einen Vorrat des Spätburgunders zu, von dem ich erfahren hatte, dass der Revierförster ihn am liebsten trank.
5
Was Ida, Fritz und Harry aber schmerzlich zu vermissen schienen, waren ihre täglichen Snacks am Straßenrand – die weggeworfenen Schulbrote, die angegammelten Döner, das Erbrochene unter Bäumen. Im Wald gab es derlei nicht. Also kompensierten sie den Verzicht der Straßenrand-Snacks mit kleinen Häppchen aus Marderkacke, Fuchspipi und Hasenkötteln. Außerdem stellten sie fest, dass man sich in verwesenden Kröten genauso gut wälzen konnte wie in vergammelten Schulbroten, wenn nicht besser, und Schafsköttel zwar nicht ganz so abwechslungsreich schmeckten wie der Müll im Park nach einem warmen Sommerabend, aber dafür wurde einem davon offenbar weniger schlecht.
Meine Ex-Stadthunde wurden zu echten Kerlen, denen die Elemente und der Dreck nichts anhaben konnten. Luise und Ida entwickelten eine wahre Leidenschaft für Schlammbäder: Hatten sie im Teich im Stadtpark noch artig am flachen Ufer gekneippt, warfen sie sich nun direkt in den Modder hinein, wälzten sich mit Leidenschaft darin und dekorierten sich anschließend mit Blättern und altem Gras. Es sah aus, als wäre ich mit Camouflage-Pudeln unterwegs. Glücklicherweise konnte ich sie im Garten einfach mit dem Schlauch abspülen.Einfach aussperren, bis sie getrocknet waren, klappte nicht: Als ehemalige Etagenhunde waren sie es nicht gewohnt, sich ohne mich im Freien aufzuhalten. Sie fanden, ihr Platz sei an meiner Seite. Und zwar immer und in jedem Zustand, in guten, wie in schlechten Zeiten.
Unsere Spaziergänge waren lang, ungestört und romantisch. Im Teich schwammen Wildgänse, auf dem Feld standen die Kraniche und schrien nach (ihren?) Frauen, abends sangen sehnsüchtig die Nachtigallen, die Käuzchen riefen, und die Jahreszeiten konnte man riechen. Ich entwickelte eine ungeahnte Ruhe und Gelassenheit, als könne mir nichts mehr jemals etwas anhaben.
Nur bei Luise hatte ich das Gefühl, dass ihr das alles irgendwie nicht genügte. Luise war ein schwarzer Großpudel, wie er in Büchern aus den 50er-Jahren stand: Elegant, selbstbewusst und ein wenig mysteriös; wenn sie trabte, schien sie zu schweben. Sie wälzte sich niemals in scheußlichen Dingen und fraß sie auch nicht, außer, sie waren leicht angebraten. Luise schien zu fürchten, dass sie im Wald verbäuerlichen würde, und sehnte sich nach dem bewegten Leben der Berliner Haute Volée.
Also nahm ich sie mit, als ich mich mit einer Freundin im Berliner Restaurant „Borchardt“ traf.
Das Borchardt in der Französischen Straße in Mitte ist eine Institution. Es ist berühmt für sein Wiener Schnitzel, das angeblich bis zu dessen weltlichen Ende von Honeckers Leibkoch in der Kücheflachgeklopft wurde, und noch berühmter für seine immer wieder illustren Gäste, um die kein anderes Gewese gemacht wird, als um andere freundliche Gäste auch. Ich jedenfalls wurde immer behandelt wie eine Prinzessin, und Luise wie ein Filmstar. Sie legte sich im Restaurant auch nie unter den Tisch wie andere Hunde, sondern saß kerzengerade neben meinem Tisch und beobachtete Gäste und Kellner. Luise hatte – wie die meisten Pudel – eine Art, Menschen konzentriert zu betrachten, dass Ungeübte immer kurz davor waren, ihr die Hand zu schütteln oder sie zu siezen. Joschka Fischer fühlte sich eines Tages von ihrem aufmerksamen Blick offenbar irgendwie ertappt und setzte sich um – so, dass er dem Hund den Rücken zudrehte (dabei galt er als Hundefreund und hatte selbst einen Kangal, der im Grunewald für Angst und Schrecken sorgte, weil er nach Kangal-Art eben nicht daran interessiert war, auf Schritt und Tritt fremden Hunden Hallo zu sagen. Fischer ließ den Rüden irgendwann kastrieren, was natürlich auch nichts nützte).