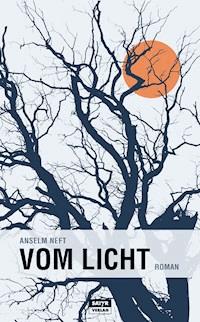Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was als tragikomische Liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem unberechenbaren Thriller, der existenzielle Fragen aufwirft. Ein unkonventioneller Roman - unterhaltsam, tiefgründig, skurril und jenseits aller literarischen Schubladen. Thomas Hell scheint keine Ziele im Leben zu haben. Er ist Mitte zwanzig, intelligent und schlagfertig, aber er braucht Großteile seiner Energie, um sich psychisch im Gleichgewicht zu halten. Dabei kann Thomas nicht sagen, ob mit ihm etwas nicht stimmt oder mit der Welt um ihn herum. Als er die sarkastische Informatikerin Sophie kennenlernt, glaubt er, in ihr die große Liebe und die Lösung seiner Probleme gefunden zu haben. Doch die junge Frau verschwindet mit einem Mal spurlos. Thomas macht sich auf eine immer verzweifeltere Suche, die ihn zu Sophies undurchsichtigem Bruder, dem vermüllten Haus ihrer Mutter und schließlich tief hinein in ein monströses Kaufhaus führt, von dem Thomas hoffte, es nie wieder betreten zu müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Anselm Neft
HELL
ANSELM NEFT
HELL
Roman
ANSELM NEFT
wurde 1973 in Bonn geboren, studierte vergleichende Religionswissenschaften und forschte über zeitgenössischen Satanismus. Er verschliss Berufe vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und verfasste weit über hundert Satiren, Kolumnen und Nachrufe für »Welt«, »Tagesspiegel« und »taz«.
Seit 2005 ist er Mitherausgeber der »Zeitschrift für komische Literatur EXOT«.
Zuletzt erschien von ihm »Die Lebern der Anderen« (Ullstein).
Anselm Neft lebt in Bonn, schreibt an einem neuen Roman und tritt auf Lesebühnen im ganzen deutschsprachigen Raum auf.
Von ANSELM NEFT im Satyr Verlag erschienen:
»Götter, Gurus & Gestörte« (2009)
(Hrsg., zusammen mit Christian Bartel)
1. Auflage März 2013
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2013
www.satyr-verlag.de
Umschlagfoto: © Enrico Verworner, Berlin
Lektorat: Volker Surmann (Mitarbeit: Julia Keil, Jan Freunscht)
E-Book-Ausgabe
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
ISBN: 978-3-944035-12-3
INHALT
TEIL I
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
TEIL II
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
TEIL III
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
TEIL I
1. KAPITEL
Erst war mir übel, dann bekam ich Appetit auf eine Gulaschsuppe im Karstadt-Bistro. Etwa eine Stunde hatte ich mit pochenden Kopfschmerzen auf dem Bett gelegen und die Hubbel betrachtet, die die Tapete durchzogen. Vielleicht nennt man solche Erhebungen auch Bläschen, Nasen oder Buckel. Zumindest konnte ich sie angucken, und es war spannender, als zur fernen blanken, weißen Decke zu schauen, denn wenn ich bei günstigen Lichtverhältnissen die Augen zu Schlitzen verengte, ließ sich aus den Formen dieser Buckel allerlei zusammenreimen. Ich hatte mir vor einiger Zeit angewöhnt, die Wandbilder als Tagesorakel zu deuten. Sah ich zum Beispiel einen Riesen mit Keule, konnte das eigentlich nur Ärger oder jede Menge Arbeit bedeuten. Zierliche Feen mit Flügeln garantierten Spaß und Abwechslung, allerdings war mit ziemlich flüchtigen Vergnügungen zu rechnen. Brüste und pralle Hintern sah ich oft, leider hatte das nicht viel zu bedeuten. An diesem Tag dauerte es lange, bis ich eine Form in dem Gewirr ausfindig machen konnte. Aber am Ende bestand kein Zweifel: Ein Hund hatte sich ins Tapetenmuster gemogelt. Mit dem Hund kam der Hunger auf die Gulaschsuppe.
Ich schleppte mich im Nieselregen von der Bonner Südstadt in die vorweihnachtliche Fußgängerzone und hing in den sich entgegenlaufenden Strömen Tausender von Passanten verkaterten Gedanken nach: Vor drei Wochen war meine Mutter gestorben. Im Krankenhaus hatte ich ihre Hand gehalten, aber ich hätte auch einen toten Seestern halten können. In ihrer letzten Nacht hatte ich mich in ein leer stehendes Bett neben ihrem gelegt, bald im selben Rhythmus wie sie geatmet und dabei gedacht, dass sich das bestimmt später gut erzählen ließe, eine Szene wie aus einem gefühlvollen Film. Auf der Beerdigung hatte ich mit meinem Bruder dumm herumgestanden und die Hände fremder Menschen geschüttelt, zu denen auch mein Vater gehörte, der aber statt der Hand eine verunglückte Umarmung vorzog.
Der späte Samstagvormittag und das nahe Jahresende luden die Fußgängerzone mit Erwartungen auf: Weltuntergang, Pech an der Börse, Glück in der Liebe, Schnäppchen. Mitten in diesem Hexenkessel strahlte mich eine schöne Frau an: endlos lange, ohne Scheu, voller Leben und Zärtlichkeit. Allerdings war sie fünfmal so groß wie ich und blickte von einem riesigen Werbeplakat auf jeden, der sie ansah.
Ich kaufte mir bei einer Kamps-Bäckerei eine Dose Cola und ließ mich schließlich von vier Rolltreppen in die letzte Etage des Karstadt tragen. Dort gab es ein Bistro direkt neben der Gardinen- und Teppichabteilung mit Blick über die Innenstadt, einer sogenannten Lavazza-Bar und einigen ganz passablen Gerichten. Während ich zwischen Kleinfamilien und Rentnern auf einem der Holzimitat-Stühle hing und versuchte, die real vor mir stehende Gulaschsuppe und das Brötchen genauso attraktiv zu finden wie das, was ich mir kurz vorher ausgemalt hatte, beobachtete ich die Leute.
Meine Betrachtung verlor ihre Unschuld, als eine junge Frau ihr Tablett zwischen den besetzten Plätzen hindurch in Richtung Raucherbereich balancierte. Sie war groß, blass und trug die schwarzen Haare als Pagenschnitt, dessen Pony kurz vor den Augen endete. Langsam und konzentriert stellte sie ihr Tablett ab, zog sich den schwarzen Mantel aus, legte ihn sorgfältig über die Stuhllehne und setzte sich dann aufrecht an den Tisch. Sie atmete tief ein und umschloss mit ihrer rechten Hand eine Gabel, um den ersten Bissen von zwei Sahneheringen mit Pellkartoffeln zu nehmen. Diesen ersten Bissen kaute sie sehr lange.
Als sie fertig war, holte sie aus der einen Manteltasche ein Buch und aus der anderen ein Päckchen Tabak. Obwohl ich mich zunehmend zittrig fühlte, stand ich auf, ging an ihren Tisch und sagte: »Hallo. Ich heiße Thomas. Ich möchte dich gerne kennenlernen.«
Sie sah zu mir auf und fragte: »Warum?«
Ich steckte die Hände in die Taschen und sagte: »Warum nicht?«
»Ich wollte eigentlich lesen, aber okay.« Ihre Stimme klang voll, eher tief und ein wenig verschnupft.
Ich setzte mich ihr gegenüber und sagte: »Tut mir leid, ich wollte dich nicht überrumpeln. Ich kann auch noch mal neu vorbeikommen, dann kannst du dich vorbereiten.«
»Schon gut.«
»Was liest du denn?«
»›Das Schloss‹ von Kafka.«
»Ist das die Geschichte, wo ein Mann irgendwo rein will, es aber nicht schafft?«
»Ja, so kann man es zusammenfassen.«
»Na, das ist ja eine ziemlich offensichtliche Metapher.«
»Wofür?«
»Ach komm: Ein Mann will in etwas rein, aber es klappt einfach nicht.«
»Ich glaube, Kafka meint das etwas spiritueller.«
»Hatte Kafka ein erfülltes Sexualleben?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Aha«, sagte ich.
»So ein Blödsinn.« Mit schlanken, geschickten Händen drehte sie sich eine Zigarette, bemerkte meinen interessierten Blick und fragte: »Willst du auch eine?«
Ich nickte und sie schob mir ein Päckchen American-Spirit-Tabak rüber.
»Ich kann nicht drehen.«
Sie zog das Päckchen wieder zu sich und baute mit großer Sorgfalt eine Zigarette für mich zusammen. Mein Blick blieb an einem schwarzen Punkt mitten auf ihrer Nasenspitze haften. Für einen Augenblick konnte ich mich auf die Frage konzentrieren, ob es sich dabei um ein Muttermal oder die unabsichtlich zur Schau getragenen Spuren eines nachlässig gehandhabten Filzstiftes handelte. Das half mir, mich zu sammeln.
»Wie heißt du?«, fragte ich.
»Sophie.«
»Und was machst du so?«
Sophie ließ ein paar Sekunden verstreichen. Vermutlich, damit ich merkte, wie floskelhaft meine Frage geklungen hatte.
»Ich orientiere mich um«, sagte sie emotionslos. »Und du?«
»Ich arbeite in einer Sauna. Putzen, Aufgüsse machen und die Dachterrasse bematten.«
»Bematten?«
»Ja, so Plastikmatten müssen ineinandergesteckt werden, mit Nippeln, bis die einen schönen großen Plastikteppich ergeben.«
»Im Dezember?«
»Ja. Der Chef denkt sich, besser zu früh als zu spät.«
»Und? Was war bisher dein schönstes Erlebnis in der Sauna?« Ihre Frage klang etwas gelangweilt.
»Ich mag das Klatschen, wenn ich einen Aufguss gemacht habe.«
»Wer klatscht? Die Saunagäste?«
»Ja. Du gehst offenbar nicht in die Sauna.«
»Und verbeugst du dich dann?«, überhörte Sophie meine Bemerkung.
»Nein.«
»Aber du fühlst dich gut als Angezogener unter lauter Nackten.«
»Das schon. Ist ja besser als andersrum.«
»Dich wird ja kaum die Bezahlung in den Saunajob gelockt haben.«
»Das würde ich nicht sagen. Neulich habe ich beim Reinigen der Abflüsse ein Zwei-Euro-Stück gefunden. Mitten in einem Zopf, der wie Blattspinat aussah.«
Ein Lächeln huschte über Sophies Gesicht. Endlich steckte sie ihre eigene Zigarette an, nahm einen Zug, blies den Rauch vergnügt in die Höhe und sagte: »Da ist ja alles dabei: mal der umjubelte Star, dann wieder das Aschenputtel, das seinen Lohn aus alten Schamhaaren fischt.«
»Du sagst es. Die Sauna ist eine Charakterschule.«
»Mich würde das runterziehen.«
»Wieso?«
»Ich finde schon bekleidete Leute oft eklig.«
»Das klingt nicht nett. Du könntest in der Sauna eine Desensibilisierungstherapie machen.«
»Nein danke.«
Für einige Augenblicke sagte keiner von uns beiden etwas. Die von ihr gedrehte Zigarette in meiner Hand gab mir etwas Sicherheit. Ich blickte mich um, aber noch bevor ich an einem der anderen Tische etwas entdecken konnte, das zu einem Gespräch hätte führen können, sagte Sophie: »Falls es dich interessiert: Ich programmiere und studiere nebenher Informatik, so hin und wieder zumindest.«
»Das klingt sehr interessant.« Ich ließ in meinem Tonfall offen, ob meine Bemerkung ironisch verstanden werden wollte.
Sophie lächelte matt: »Bevor du deine Klischees bemühst: Ja, ich bin langweilig, leidenschaftslos und lesbisch.«
»Eine leidenschaftslose Lesbe?«
»Und langweilig. Ich interessiere mich nur für Computer.«
»Und kämpfst mit freier Software gegen das böse Microsoft-Imperium und hast das Gesicht von Bill Gates auf deinem Klopapier abgedruckt.«
»Du kennst dich aus.«
»Die langweilige Linux-Lesbe.«
»Machst du was mit Computern?«
»Dazu lässt mir die Sauna leider keine Zeit.«
»Braucht man als Saunamann eigentlich eine Ausbildung?«
»Ich bin Quereinsteiger. Ich habe mich schon ein paar Mal umorientiert.«
»Klingt unstet.«
»Wohin orientierst du dich gerade um? Richtung hetero?«
»Wenn ich mal einen schlauen Mann treffen sollte, denke ich vielleicht darüber nach.«
Obwohl ich mich ein wenig beleidigt fühlte, tat ich weiterhin gut gelaunt und sagte: »Vielleicht hast du dafür nicht mehr viel Zeit. Vielleicht geht die Welt bald unter. Darauf baue ich seit Jahren meine Hoffnung. Endlich Schluss mit diesem Wo-sehen-Sie-sich-in-fünf-Jahren-Gerede.«
»Hoff mal weiter. Aber die Statistik sagt, dass auf hundert Prozent prognostizierte Weltuntergänge null Prozent tatsächliche Weltuntergänge kommen.« Sophie sah auf ihre Uhr und sagte: »Ich muss mal los. War nett, dich kennenzulernen, Thomas.« Sie stand auf und griff nach ihrem Mantel.
»Ja, vielleicht sehen wir uns ja noch mal, bevor die Welt untergeht. Also zum Beispiel bald.«
Sophie schien nachzudenken. Vielleicht lief ein binärer Code durch ihr Hirn, ein verästeltes Gebilde, das schließlich bei Ja oder Nein endete.
»Du weißt, dass das schiefgeht?«, fragte sie, und es klang nicht einmal aggressiv. Wir sahen uns in die Augen. Ihre Regenbogenhäute hatten dasselbe Grün wie die Büchsen des Holsten-Maibocks.
»Wir können mal mit meinem Patenhund spazieren gehen«, sagte sie. »Nächsten Samstag. Wenn du Zeit und Lust hast.«
Ich nickte, verschluckte ein »Patenhunde sind meine Leidenschaft« und ließ mir von ihr Zeit und Ort sagen. Dann nahm sie ihr Tablett und ging durch die Reihen davon.
Den Tag über war mit mir nichts mehr anzufangen. Um mich zu beruhigen, fuhr ich den ganzen Nachmittag mit dem Rad herum. Es wurde bereits dunkel, als ich in den Teil der Weststadt geriet, dem eine Verbrennungsanlage, ein Schlachthof, ein Puff, eine Kläranlage und der Bonner Straßenstrich günstige Mieten bescherten. In immer kürzeren Abständen kamen mir Menschen mit Hunden entgegen. Meistens Frauen. Junge wie alte. Ich suchte die Quelle dieses Hundestroms und fand das städtische Tierheim, an dessen Einfahrt der Straßenstrich begann.
Ich kettete mein Fahrrad an eine Laterne, stellte mich nicht weit vom Eingang des Tierheims auf und wartete. Rauchend beobachtete ich ein junges Mädchen in weißen Strumpfhosen und schwarzen Moonboots, das sich in das Wagenfenster eines Audis mit Kindersitz lehnte. Den Fahrer konnte ich nicht erkennen. Zumindest wurden sich die beiden nicht einig, denn zwei Minuten später fuhr das Auto ohne das Mädchen weiter. Sie tippelte auf und ab. Kam einmal zu mir rüber und fragte nach Feuer. Tippelte dann wieder auf und ab. Von ihr abgesehen kamen ständig Einzelne oder Gruppen von Frauen mit Hunden an mir vorbei. Rein ins Tierheim. Raus aus dem Tierheim. Bello, Bully, Blondi, Chacko, Kirja, Rex, Wulli, Waldi, Wauzi – und die Frauen. Bisher hatte ich mir über Frauen, die Hunde aus dem Tierheim ausführen, noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht war es jetzt an der Zeit.
Eigentlich hatte ich nur eine Zigarette lang warten wollen. Dann aber riss mich die Hundebetrachtung mit, und aus einer Zigarette wurden drei oder vier. Schneeregen setzte ein. Ich stellte mich in die Unterführung und versuchte, der dort stehenden Frau weder das Gefühl zu geben, etwas von ihr zu wollen, noch ihr Konkurrent zu sein. Gerade betrachtete ich ein Plakat mit den halbnackten Männern einer Striptease-Gruppe, da berührte mich etwas an der Wade. Ich schaute nach unten und erblickte eine Art Hund: Das Vieh sah aus wie die dackelgroße Kreuzung zwischen einer Zwergspitzmaus und einem Nacktmull. Ohren wie ausgefranste Chicorée-Blätter, eine Schnauze, die ein halber Rüssel war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, schon einmal einen derartig skurrilen Köter gesehen zu haben. Um den Hals trug er ein Band, an dem Band hing eine Leine, am anderen Ende der Leine stand Sophie und sah mich ernst an.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie leise.
»Ich betrachte Hunde.«
Ihr Blick fiel auf das Plakat, dann wieder auf mich. »Das glaube ich dir nicht.«
»Es stimmt aber.«
»Du hast mir aufgelauert.«
Das Vieh schnupperte immer noch an meinem Bein, als ob ich es mit Hundekot eingerieben hätte. Zwischendurch sah es zu mir hoch. Sophie stand unschlüssig in einem Parka mit Deutschlandfähnchen auf Oberarmhöhe da und blickte unter einer schwarzen Mütze abwechselnd auf mich und den Hund. Ich ging in die Hocke und rang mich dazu durch, den Nacken des merkwürdigen Tiers zu kraulen.
»Armer Hund«, sagte ich. »Armer, armer Hund, hast ein böses Frauchen erwischt. Böse.«
»Tut mir leid«, sagte Sophie plötzlich. »Ich habe mich nur erschrocken. Ich habe gerade an etwas Unangenehmes gedacht und dann stehst du da plötzlich in der dunklen Unterführung. Wir sind doch erst für nächsten Samstag verabredet.«
»Stimmt. Ich bin hier wirklich zufällig hingeraten.«
»Und bist beim Dreamboy-Plakat hängengeblieben?«
»Ist dir das noch nie passiert?«
Sophie schnaubte ein kurzes Lachen in die Winterluft. Dann sagte sie: »Wenn du willst, kannst du jetzt mitkommen.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, beugte sie ihren Kopf zu dem Ding an der Leine und flüsterte: »Oder hast du was dagegen, Vergil?« Wie zu erwarten enthielt sich der Hund jeden Kommentars.
»Hast du den so genannt?«
»Nein, der hieß schon vorher so. Ich hätte ihn auch nicht Vergil genannt.«
Der Hund sah mich aus wässrigen Augen an. Ich hatte das dumpfe Gefühl, er würde gleich anfangen zu heulen. Aber angeblich hatte Vergil ja nichts dagegen, dass ich mit den beiden loszog.
Hinter dem Straßenstrich und einigen Bürobauten aus den Siebzigerjahren begann das Messdorfer Feld, das weiter hinten von einem Eisenbahngleis zerschnitten wurde. Eine Weile sagte keiner etwas. Der Schneeregen ebbte ab, aber ein ungemütlicher Wind griff unter meine Jacke. Andere Menschen mit Hunden kamen des Weges und führten mit uns das immer gleiche Stück auf: Die Tölen beschnüffeln ihre Hinterteile, man unterhält sich kryptisch, den Blick immer auf die Hunde gerichtet.
Unser erstes richtiges Gesprächsthema war Kafkas »Schloss«, das ich allerdings nicht gelesen hatte, sodass ich mir von Sophie den Inhalt und ihre Meinung dazu erzählen ließ. Anschließend kamen wir auf ein paar andere Bücher und schließlich Filme zu sprechen. Während wir redeten, gerieten wir bis nach Messdorf, in dem gerade irgendwelche beherzten Menschen einen Weihnachtsmarkt errichtet hatten. Ein paar Holzbuden warteten mit dem üblichen Plunder, fettigen Crêpes und gepanschtem Glühwein auf.
Sophie blieb an einer Bude stehen, in der Halbedelsteine zum Verkauf angeboten wurden. Ein großer, bärtiger Mann saß hinter ein paar Boxen mit Tigeraugen, Bergkristallen und Amethysten. Außerdem lagen drei dieser aufgebrochenen Steine herum, in denen violette Quarze blinken. Sophie warf einen Blick auf das Sortiment. Ich stand dicht neben ihr. Vorsichtig, sodass sie es nicht merken konnte oder zumindest merkte, dass ich nicht wollte, dass sie es merkt, wanderte mein Blick über das Stück ihres Halses, das nicht durch den Kragen verborgen war, über den Busen, den ich unter ihrem Parka nur erahnen konnte, wieder zurück zu ihrem Hals und weiter hoch zu ihren trotzig geschwungenen Lippen, bis sich mir plötzlich ungefragt die Vorstellung aufdrängte, dass diese Lippen eines Tages unter der Erde zu Kompost zerfallen mussten. Ich nahm Sophies Hand, vielleicht um mir mit dieser Geste selbst Mut zu machen. Ihre Haut fühlte sich zart und kühl an, dann spürte ich ein unangenehmes Kribbeln und ließ los.
»Feierst du Weihnachten mit deiner Familie?« Sophies zusammenhanglose Frage klang wie ein Vorwurf.
»Nein. Meine Mutter ist neulich gestorben, mit meinem Vater habe ich nichts zu tun, und mein Bruder bekommt die Feiertage auch ohne mich rum.«
»Deine Mutter ist gestorben?«
»Am 19. November. Braucht dir nicht leid zu tun.«
»Woran ist sie gestorben?«
»An antibiotikaresistenten Bakterien. Eingeliefert wurde sie vermutlich mit Pseudomonas aeruginosa auf der Herzklappe. Gestorben ist sie aber vielleicht eher an Staphylococcus aureus.«
»Wieso vielleicht?«
»Die Ärzte haben nicht alle das Gleiche gesagt. Da war halt was auf der Herzklappe, die wurde deswegen operiert. Danach hatte das Zeug aber angeblich gestreut und irgendwie auch kurz einen anderen Namen. So ein Arzt im Praktikum hat sich verplappert.«
»Du traust den Ärzten nicht?«
»Na, wenn Krankenhäuser nachlässig in der Einhaltung der Hygienevorschriften sind, kann man sich da infizieren. MRSA. Noch nie gehört?«
»Nein.«
»Methicillin-resistente Staphylococcus-aureus-Bakterien. Vielleicht hast du die Dinger auch auf der Haut. Es dürfen halt nur nicht zu viele werden.«
»Willst du das Krankenhaus verklagen?«
Ich schüttelte den Kopf. Der Gedanke war mir noch nicht gekommen.
»Feierst du denn mit deiner Familie?«
»Ja«, sagte Sophie matt. »Mit meiner Mutter und meinem Bruder. In der Eifel. Da wohnt meine Mutter.«
»Was ist mit deinem Vater?«
»Der hat sich nach zweiundzwanzig Jahren Ehe eine Frau gesucht, die so alt war wie meine Mutter bei der Hochzeit, und hat eine neue Familie gegründet. In München.«
»Wie alt warst du bei der Scheidung?«
»Dreizehn.«
»Ich war zehn. Meine Mutter hat mich gefragt, ob sie sich scheiden lassen soll. Ich habe Ja gesagt, und ein paar Monate später ist mein Vater ausgezogen.«
»Hätte mich auch gewundert, wenn du aus einer heilen Familie gekommen wärst.«
»Wieso?«
»Es ist einfach so«, sagte Sophie. »Wenn ich jemanden interessant finde, hat er mit Sicherheit eine Riesenmacke.«
»Interessant«, sagte ich. »Bei mir ist es genauso.«
»Gut, vielleicht können wir das Drama abkürzen. Was ist dein Problem?«
»Keine Ahnung.«
»Also, warum haben sich deine Eltern scheiden lassen?«
»Vielleicht wegen der Sauferei. Mein Vater ist Alkoholiker.«
»Na siehst du, so was meine ich. Aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Alkoholikerfamilie – das ist doch so ein Standard.«
»Hast du mehr zu bieten?«
»Nicht unbedingt. Mein Vater ist ein Arschloch, meine Mutter hat einen Schaden, und mein Bruder ist so verschlossen, dass ich eigentlich nichts über ihn weiß.«
»Da bin ich auch mehr gewöhnt.«
»Ich habe in der Jugend ein paar längere Gedächtnislücken.«
»Immerhin«, sagte ich. »Und ich musste schon als Grundschulkind zum Psychologen.«
»Aha, weswegen?« Sophie klang aufrichtig interessiert.
»Das ist ein bisschen kompliziert. Es hieß, dass ich manchmal Träume und Realität nicht auseinanderhalten kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff ›Träume‹ wirklich zutreffend ist. Mir kam das wirklich sehr echt vor. Ich war da immer am gleichen Ort.«
»Und jetzt hast du das nicht mehr?«
»Nein. Das hat aufgehört, als ich vierzehn war.«
»Was für ein Ort war das?«
»Ein riesiges Kaufhaus, jede Etage so groß wie eine Stadt. Oder größer. Sollen wir einen Glühwein trinken?«
»Igitt.«
Nach fast zwei Stunden hatten wir Vergil in seinen Zwinger zurückgebracht und standen vor dem Eingang des Tierheims.
»Bleibt es bei nächstem Samstag?«, fragte Sophie.
»Klar«, sagte ich.
»Aber versprich dir nichts davon, okay?«
Nachdem wir uns verabschiedet hatten, übergab ich mich am Wegesrand.
2. KAPITEL
Ich kam gerade noch rechtzeitig nach Hause, um meinen Freund Hermann zu treffen. Er stand zur verabredeten Zeit mit einem Sixpack unterm Arm vor der Tür meiner Wohnung. Wie immer trug er seine etwas zu große Lederjacke, und wie immer war er blass um die Nase. Von männlichen Russen geistert ein Bild durch die Köpfe, oder zumindest durch meinen Kopf: Stämmig sind sie, voller Vitalität, doch ihre Augen blicken melancholisch. Eine eigentümliche Mischung aus Schiffschaukelbremsern und Literaten. Ein Volk boxender Dostojewskis. Hermann kam zwar aus Russland, entsprach auch dem Stereotyp, bestand aber darauf, Deutscher zu sein, ein sogenannter Aussiedler. Bei seinem Aussehen hätte er eigentlich Erfolg bei Frauen haben müssen, aber vermutlich roch er nach etwas, das ihn auf die Rolle des guten Kumpels festlegte. Hermann konnte gut zuhören, also hörte er gut zu. Hermann konnte sich in andere einfühlen, also fühlte er sich in andere ein. Er konnte gute Ratschläge geben, also gab er gute Ratschläge. Mehrmals hatte Hermann die Bekanntschaft von Frauen gemacht, die sich gerade von ihrem Typen trennten. Drei Wochen Umgang mit Hermann und die Frauen sahen einiges klarer und kehrten zu ihren Männern zurück, während Hermann mit dem Gefühl zurückblieb, einerseits alles richtig, andererseits alles falsch gemacht zu haben.
Kennengelernt hatte ich Hermann vor sechs Jahren bei einer gemeinsamen Ausbildung zum Koch. Hermann hat die Sache durchgezogen. Ich nicht. Spaß machte das Kochen schon, nur waren mir die Arbeitszeiten und die dummen, aggressiven Chefs so auf die Nerven gegangen, dass ich mich nach der Hälfte der Zeit nach anderen Jobs umgesehen und davon auch zehn oder elf in Folge gefunden hatte. Hermann hingegen arbeitete seit über vier Jahren in der Mensa am Venusberg und rührte den Medizinstudenten ihr Essen zusammen.
Diesmal war er guter Laune. Ich merkte es an der schwungvollen Art, mit der er das Bier aufmachte und davon trank.
»Ich habe gestern auf dem Sperrmüll fünf Kartons mit Fischertechnik gefunden«, sagte er. »Da hat einer die kompletten Kästen weggeworfen.«
»Schön, dann hast du jetzt was zum Basteln.«
»Basteln. Quatsch. Ich habe alles bei eBay eingestellt. Drei Kästen sind schon weg. Hundertfünfzig Euro. So, jetzt du.«
»Ich habe eine tolle Frau kennengelernt.«
Hermann knibbelte am Etikett seiner Bierflasche. »Was willst du jetzt mit einer Frau? Du solltest über deine tote Mutter nachdenken.«
»Das kann ich auch nebenher. Sie heißt Sophie.«
»Das klingt nicht ganz so schlimm wie Xynthia, aber schlimmer als Veruschka.«
»Ich dachte, du mochtest Veruschka nicht?«
»Mochte ich auch nicht, aber der Name war wenigstens in Ordnung. Hast du eigentlich das Geld von ihr zurückbekommen?«
»Habe ich abgeschrieben.«
»Ich habe dir gleich gesagt: Das gibt nichts als Ärger.«
»Du hast zuerst gesagt, wie super sie aussieht.«
»Stimmt. Deine Mörderbräute sehen auf den ersten Blick immer super aus. Ich verstehe langsam auch warum: Die wollen so verzweifelt gemocht werden, dass sie sich diese spektakuläre Schönheit antrainieren. Die üben vor dem Spiegel, wie man gucken muss, wie man den Kopf hält.«
»Sophie studiert Informatik und arbeitet als Programmiererin.«
»Dann ist sie vielleicht lesbisch?«
»Was für ein blödes Klischee.«
»Also, mein Cousin kannte mal eine Informatikerin, nein halt, die war Ingenieurin.«
»Hermann, ist gut. Ich mach uns Lachsforellen.«
»Sehr gerne. Aber noch mal zu dieser Sophie: Wenn die einen guten Job hat und eine vernünftige Ausbildung, was will die dann mit dir?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Du könntest Hausmann werden.«
»Warum nicht?«
»Du spinnst. Ich weiß schon – gleich sagst du ›Ah, der Hermann, der konservative Wolgadeutsche mit seinem Frauenbild aus dem vorigen Jahrhundert‹, aber ich sage dir, mein Freund, die Frauen wollen noch immer, dass der Mann das Geld verdient. Das sitzt ganz tief.«
»Genetisch, stimmt’s?«
»Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe meine Erfahrungen.«
»Du meinst Beobachtungen, oder?«
»Mach du deine Witze. Du weißt so gut wie ich, es geht um Status. Auch ums Geld, aber vor allem um den Status. Du und ich, wir machen in den Augen der Studentinnen keine respektablen Jobs. Und die Friseusen und Zahnarzthelferinnen, die wollen erst recht, dass du Kohle verdienst. Die wollen sich doch auch nicht nach unten orientieren.«
»Bisher ging es auch so.«
»Ja, weil du auf die Verrückten setzt. Das ist eine Kategorie für sich.«
Ich holte die Forellen aus dem Kühlschrank und begann, sie zu säubern.
Obwohl Sophie in meinen Augen nicht krank wirkte, fühlte sich der Kontakt mit ihr tatsächlich nicht ganz gesund an. Die nächsten beiden gemeinsamen Spaziergänge beunruhigten und verwirrten mich. Auf der einen Seite redeten wir sehr offen miteinander, auf der anderen Seite kam es mir so vor, als stünde etwas zwischen uns, ohne dass ich sagen konnte, ob diese Barriere von ihr oder von mir errichtet worden war. Genauso wenig konnte ich sagen, ob ich Sophie besonders genau oder verzerrt wahrnahm: Im einen Moment sah sie unglaublich gut aus, im nächsten Augenblick wirkten ihre Gesichtszüge schief und so fremd, dass ich mich fürchtete und wegsehen musste. Manche Verliebte reden von Schmetterlingen im Bauch. Bei mir waren es Hornissen.
Zum ersten Mal seit Jahren dachte ich wieder intensiver an das Kaufhaus. Dabei ist das Wort »Haus« etwas trügerisch, denn es handelte sich eher um eine komplett überdachte Stadt, deren Ausmaße mir nicht klar waren. Als Kind war ich phasenweise davon überzeugt gewesen, in den Kaufhausetagen zu leben. Ich konnte dort alles kaufen, auch Superkräfte und Erinnerungen und Freunde und andere Familien, bei denen ich wohnte, während die Menschen, die mich schließlich zum Psychologen brachten, nur in Träumen auftauchten, in denen ich mich ohnehin niemandem verständlich machen konnte. So wunderbar mir das Kaufhaus mit seinen endlosen Möglichkeiten erschien, so sehr war ich manchmal davon überzeugt, dass es sich um ein Gefängnis handelte. Und ich hatte Angst, dass jemand oder etwas in diesem Gefängnis mich zerstören und eine Kopie an meine Stelle setzen wollte.
Der Psychologe konnte mir nicht helfen. Ich konnte seine Hilflosigkeit kaum ertragen und sagte, was er hören wollte, so wie ich auch meinen unwirklichen Eltern erzählte, was sie hören wollten. Mit vierzehn Jahren entdeckte ich, dass es simple Mittel gegen die Gefangenschaft im Kaufhaus gab: Bier, Wein, Schnaps und alles, was Prozente hatte. Schon nach den ersten Besäufnissen verblassten die Kaufhauserlebnisse zu Träumen, und nach einigen Wochen verschwanden sie ganz aus meinem Bewusstsein. Seit meinem vierzehnten Lebensjahr habe ich jeden Tag getrunken, und seit meinem vierzehnten Lebensjahr habe ich das Kaufhausproblem im Griff.
Es gefiel mir gar nicht, dass die Grübeleien über die Beziehung zu Sophie zu Grübeleien über das Kaufhaus führten, und ich war dankbar für jede Ablenkung, auch wenn es sich um die dämliche Arbeit in der Sauna oder die Eröffnung des Testaments meiner Mutter handelte.
Neben mir und meinem Bruder Daniel waren mein Vater und die Schwester meiner Mutter zum Nachlassgericht geladen. Erwartungsgemäß ging die zweigeschossige Wohnung im Speckgürtel von Bonn an meinen Bruder und mich. Auch die mütterliche Lebensversicherung wurde unter uns aufgeteilt, wobei mein Bruder und ich je fünfunddreißig Prozent und meine Tante für sich und ihre Familie dreißig zugeteilt bekamen. Mit wie viel Geld zu rechnen war, wusste ich noch nicht. Das Auto meiner Mutter wurde meinem Bruder zugesprochen, mit der Auflage, es demjenigen aus der Familie zu geben, der es am besten gebrauchen konnte, was am Ende tatsächlich er selbst zu sein schien. Für meinen Vater waren zwei Schachteln mit persönlichen Habseligkeiten vorgesehen, darunter vor allem Briefe und Fotos. Der Schmuck ging wiederum an meine Tante.
Nach dem Termin standen wir vor dem Bonner Amtsgericht herum. Meine Tante verabschiedete sich, mein Vater verwickelte meinen Bruder in ein Gespräch über dessen Pläne, sich als Heilpraktiker niederzulassen. Ich starrte auf seine Hände. Die unpassend kurzen Finger bewegten sich wie die tastenden Auswüchse eines Meerestieres. Der ganze Mann wirkte unruhig und schmächtig und trotz einer bemüht aufrechten Körperhaltung eingefallen und ängstlich. Vermutlich hätte ich ihn mit einem gezielten Schlag zu Boden strecken können.
»Na, dann«, sagte er zum Abschied. »Trotz allem frohe Weihnachten.« Unsere Blicke trafen sich für einen Moment, und ich sah in seinen Augen eine Furcht, die nichts mit mir zu tun hatte.
Einen Tag vor Heiligabend saß ich gegen 10 Uhr abends zu Hause und hörte bei einer Flasche Rotwein Roy Orbison. Bei »In Dreams« stand ich von meiner Couch auf und sah aus dem Fenster und schließlich in die Scheibe, in der ich mich verschwommen spiegelte. Der Regen der letzten Tage war in Schnee übergegangen, dämpfte die Geräusche der Stadt und überzog die parkenden Autos mit einer weißen Schicht.
Wie eine real werdende Sinnestäuschung hörte ich erst undeutlich, dann klarer das Läuten meines Handys aus der Musik herausstechen. Ich drehte den Ton der Stereoanlage herunter und nahm das Telefon in die Hand. Das Display zeigte neben einer bimmelnden Glocke den Namen »Sophie«.
»Kannst du zu mir kommen?«, fragte sie ohne Umschweife.
»Jetzt?«
»Ja, jetzt.« Sophie nannte mir ihre Adresse. Von meiner Wohnung im Bonner Talweg waren das mit dem Rad etwa zehn Minuten.
»Ich warte auf der Straße auf dich, du findest das Haus sonst nicht.«
»Wenn du meinst. Ist denn irgendetwas Schlimmes passiert?«
»Nein, ich möchte nur, dass du zu mir kommst.«
In der Winternacht wirkte die Altstadt wie die Kulisse aus einem Stummfilm. Sophie stand rauchend und sonderbar groß neben einer Laterne. Sie trug einen schwarzen Mantel, Handschuhe und Mütze. Als sie mich sah, legte sie den Kopf ein bisschen schief und lächelte aus dem hochgeschlagenen Kragen heraus. Zur Begrüßung gab sie mir diesmal nicht die Hand, sondern berührte mich kurz an der Seite.
Sie führte mich durch einen Hauseingang, der aber wider Erwarten nicht in einer Diele oder einem Treppenhaus endete, sondern den Durchgang zu einem Hof darstellte. Es gab Holzfässer, Gießkannen, Rechen und eine Schubkarre wie aus Großmutters Nachlass. All das stand in trauter Eintracht auf Kopfsteinpflaster, aus dessen Mitte sich ein dreigeschossiges, gelb angestrichenes, an der Fassade von Efeuranken verdecktes Gebäude erhob, das Sophie als »klassizistisch« bezeichnete. Ein Wohnhaus hinter der Reihe der zur Straße gewandten Häuser.
»Früher war die Straße viel breiter«, sagte Sophie. »Da standen alle Häuser auf der gleichen Höhe wie das hier. Nach dem Ersten Weltkrieg war es eine Ruine. Das neue Haus wurde einfach davor gebaut. Der Swami hat richtig was daraus gemacht. Jetzt wohnt hier so etwas wie ein esoterisches Künstlerkollektiv. Natürlich mehr Kollektiv als Künstler.«
»Ich wusste gar nicht, dass du zu einem esoterischen Künstlerkollektiv gehörst.«
Sophie holte den Schlüssel aus ihrer Manteltasche und schloss die eigentliche Haustür auf.
»Ich bin hier bloß reingeraten. Gute Lage, schönes Haus, schöne Wohnung, guter Preis. Irgendein Haken musste ja dabei sein.«
»Und jetzt musst du Kreistänze aufführen und den Swami als Gottheit verehren?«
»Nein, der findet sich auch ohne meine Huldigung absolut göttlich. Ich muss gar nichts mitmachen. Ich muss mich nur erleuchtet anlächeln lassen.« Sophie führte mich Holztreppen in den dritten Stock hinauf. Dort, hinter einer dunklen Tür in einer hellen Wand, lag ein vielleicht zwanzig Quadratmeter großer, sehr ruhiger Raum. Kaum dass ich ihn betreten hatte, fühlte ich mich ein wenig entrückt.
Der Eingangstür gegenüber befand sich ein Fenster. Aus dem schwarzen Nichts reckten sich die blattlosen Äste eines Baumes fast bis an die Scheibe und vermischten sich darin mit den Spiegelungen eines Deckenfluters und der Kerzen, die auf einem schwarzen Klavier in schlichten Ständern brannten. Das geräumige Bett vor dem Fenster erweckte mit seiner zerwühlten, dunkelroten Bettdecke den Eindruck, Sophie sei gerade erst aufgestanden. Auf einem Nachttisch lag »Das Schloss«. Andere Bücher füllten ein bis zur Decke reichendes Regal, neben dem eine halb geöffnete Tür in ein weiteres Zimmer führte. Bis auf das Blinken einiger Computerlämpchen war es darin dunkel.
Mitten im Zimmer gruppierten sich zwei Kissen um ein niedriges Tischchen mit Bechern, Kanne und Stövchen. Schon kurz nachdem wir uns gesetzt hatten, fühlte ich eine angenehme Müdigkeit in meinen Gliedern. Auf dem Becher, den Sophie mir zuschob, war eine Fantasiefigur zu sehen, eine Art weißes Nilpferd auf zwei Beinen.
»Das ist ein Mumin«, sagte Sophie, als sie bemerkte, dass ich den Becher betrachtete.
»Ein Mumin?«
»Ja. Kennst du die Mumins nicht? Da gibt es doch Bücher drüber und auch eine Zeichentrickserie.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Das war meine Lieblingssendung, als ich klein war. Und der Muminbecher ist mein Lieblingsbecher.«
»Was gefällt dir denn an diesen Mumins?«
»Das kann man schwer erklären. Sie leben im Mumintal und sind ziemlich nett zueinander. Sanft und nobel. Außerdem verbreiten sie keine Hektik.«
»Ganz putzige Gesellen, was?«
»Am besten sind die Hattifnatten. So stumme Spargelgespenster.«
»Das sind keine Mumins, oder?«
»Nein. ›Mumin‹ ist auch keine Volksbezeichnung wie ›Schlumpf‹, sondern ein Familienname.«
»Du meinst also, die Schlümpfe sind ein Volk?«
»Was denn sonst?«
»Es könnte sich auch um einen Stamm handeln.«
»So habe ich das noch nicht betrachtet. Am Ende sind sie sogar bloß eine Familie. Nur dass alle außer Papa Schlumpf gleich alt sind.«
»Und es gibt nur eine Frau.«
»Wie in der Informatik.« Seufzend hob und senkte sie ihre Schultern ein Stück. Dann ballte sie ihre Hände zu Fäusten und sah auf die kleine Flamme im Stövchen. Ich betrachtete Sophies Gesicht von der Seite, ihren Hals, ihre Lippen, ihre von hohen Knochen getragenen Wangen und den schwarzen Punkt auf ihrer Nase, der sich als echt herausgestellt hatte.
»Ich möchte dich etwas fragen«, sagte Sophie, ohne den Blick von der Flamme abzuwenden.
»Nur zu.«
»Du hast von einem Ort erzählt, an dem du als Kind manchmal gewesen bist.«
»Ich war da nicht wirklich, ich habe mir das eingebildet.«
»Warum hat das aufgehört?«
Ich räusperte mich und fragte: »Sag mal, hast du vielleicht eine Flasche Wein da?«
Sophie stand wortlos auf und verließ das Zimmer. Ich betrachtete den Rauch, der von ihrer Zigarette im Aschenbecher aufstieg, und fühlte mich gleichzeitig verlassen und beobachtet, vermutlich, weil ich auch jetzt noch versuchte, mich durch die Augen der Frau zu betrachten, die mich am späten Abend zu sich eingeladen hatte. Als Sophie zurückkam, hielt sie in der einen Hand eine Flasche Rotwein, in der anderen zwei Weingläser und einen Korkenzieher. Sie entkorkte die Flasche, zeigte mir schmunzelnd das Etikett. Ich nickte. Sie schenkte ein. Dann sah sie mich an. Ich zog eine neue Zigarette aus meiner Packung.
»Sag mir, wenn ich zu neugierig bin.« Sophie schob mir das Feuerzeug rüber.
»Schon in Ordnung«, sagte ich. »Ich nehme Medikamente. Das ist der Trick.«
»Seit du vierzehn Jahre alt bist?«
»Ja.«
»Haben die Nebenwirkungen?«
»Bei mir eigentlich nicht.«
»Und hast du schon mal versucht, die abzusetzen?«
»Ja.«
»Und?«
»Keine gute Idee.«
»Du hast Hirngespinste, wenn du keine Medikamente nimmst?«
»So könnte man es sagen.«
»Scheiße.«
»Naja, es ist nicht so, dass ich rumlaufe und Elfen und Einhörner sehe. Ich gehe ins Bett, schlafe ein und bin in diesem Gebäude, und es ist viel echter als ein Traum. Es ist so echt, dass mir nach dem Aufwachen alles ein bisschen unwirklich vorkommt. Also so war das früher, und ich konnte dann manchmal keine richtige Verbindung mehr herstellen.«
»Aber ist das nicht seltsam? So wie du es schilderst, entscheidet eine bestimmte biochemische Verfassung darüber, ob man die Realität wahrnimmt oder etwas, das nicht real ist.«
»Ja, so sieht es aus.«
»Aber wer legt fest, was Realität ist? Wann ist deine Wahrnehmung richtig, und wann ist sie falsch?«
»Offenbar gibt es da eine gesellschaftliche Vereinbarung.«
»Und worauf gründet die?«