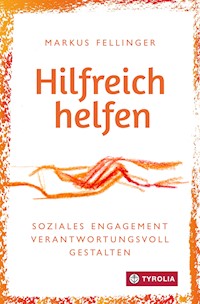
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kompetent und reflektiert Hilfe leisten Ein Leitfaden für alle im sozialen Engagement Im täglichen Leben Hilfe zu leisten ist richtig und nötig, aber nicht immer fraglos "gut". Hilfe kann ambivalent erlebt werden und sogar ugesunde Machtgefälle schaffen oder Burnouts fördern. Markus Fellinger, evangelischer Pfarrer und Gefängnisseelsorger, fragt nach den Bedingungen für "hilfreiches Helfen" und fasst diese in zehn übersichtliche Kriterien zusammen. Dafür nutzt er seine langjährige Erfahrung in Sozialarbeit, Beratung und Supervision. Der Theologe sieht ein grundsätzliches Angewiesensein auf andere und den Drang zu helfen als menschliche Wesensmerkmale. Mit der biblischen Geschichte vom "barmherzigen Samariter" veranschaulicht er das "hilfreiche Helfen". Das Buch lädt ein, sich unbewusste Mechanismen des Helfens bewusst zu machen sowie eigene Grenzen und die des Gegenübers wahrzunehmen. Lyrische Texte des Autors, die von berührenden Begegnungen mit Menschen im Gefängnis zeugen, bereichern seine praktischen Überlegungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARKUS FELLINGER
Hilfreich helfen
SOZIALES ENGAGEMENT VERANTWORTUNGSVOLL GESTALTEN
„Die geöffnete Hand steht für die Frage ,Was willst du?‘ und lässt sich beim Helfen führen. Ein Prinzip, das ich aus meiner Arbeit mit taub-blinden Menschen kenne.“
Johannes Fellinger, Bruder des Autors, illustrierte den Umschlag des Buches. Er ist Primararzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und Künstler.
Nachhaltige Produktion ist uns ein Anliegen; wir möchten die Belastung unserer Mitwelt so gering wie möglich halten. Über unsere Druckereien garantieren wir ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit: Wir lassen ausschließlich auf FSC®-Papieren aus verantwortungsvollen Quellen drucken und verwenden Farben auf Pflanzenölbasis. Wir produzieren in Österreich und im nahen europäischen Ausland, auf Produktionen in Fernost verzichten wir ganz.
Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“
© 2023 Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck
Umschlaggestaltung: Tyrolia-Verlag, Innsbruck
Layout und digitale Gestaltung: Tyrolia-Verlag, Innsbruck
Druck und Bindung: FINIDR, Tschechien
ISBN 978-3-7022-4101-8 (gedrucktes Buch)
ISBN 978-3-7022-4126-1 (E-Book)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tyrolia-verlag.at
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Bischof Michael Chalupka
Persönlicher Zugang
Was versteht man unter dem Begriff „helfen“?
Kapitel I – Der helfende Mensch
Das Angewiesensein des Menschen
Der Drang zu helfen
Liebe und Macht
Motivationskonglomerat (oder: die Endlichkeit des Helfens)
Kapitel II – Die Beispielerzählung vom „barmherzigen Samariter“ als Vor-Bild des Helfens
Vorbemerkung
Nächstenliebe
Die Wahrnehmung
Die „Verunreinigung“ und Belastung
Kompetenz
Der Auftrag
Das Loslassen
Die Kooperation
Der eigene Weg
Kapitel III – Zehn Kriterien für hilfreiches Helfen
Vorbemerkung
1. Die Liebe zu sich selbst
2. Eigene Kompetenz und ihre Grenzen wahrnehmen
3. Hilfe und Dank annehmen können
4. Sich als Helfer helfen (lassen)
5. Ressourcen kennen und in Anspruch nehmen
6. Unterscheidung von Mitgefühl – Mitleid – Liebe
7. Reflexion eigener Bedürfnisse
8. Das Verständnis von „stark“
9. Vom Sich-überflüssig-Machen und von möglicher Konkurrenz
10. Hilfe durch Hilfsverweigerung und Ziehen von Grenzen
Fazit
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort von Bischof Michael Chalupka
Wer ist mein Nächster? Der Begriff der Nächstenliebe verführt zu Spekulationen, wie nahe einem der, den es zu lieben gilt, denn sein soll. Dass das Nahe mehr geliebt wird als das Ferne, entspricht der Alltagserfahrung, wenn sich in der Liebe der Mutter zum Kind oder jener zwischen Mann und Frau Liebe und Nähe vereinen. Aber Jesus fragt seine Zuhörer im Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“: Wer war dem Überfallenen der Nächste? Wenn Jesus den als vorbildlich darstellt, der einem fremden Überfallenen spontane Hilfe zukommen lässt, während dies ein Priester und ein Einheimischer verabsäumen, dann bekommt „Nächstenliebe“ einen viel weiteren Horizont. Die Frage ist nicht, wer ist uns nah, sondern sind wir bereit, selbst zum Nächsten zu werden? Wer war dem verletzten Menschen im Straßengraben der Nächste? Nächstenliebe ist keine Abstandsmessung, sondern eine Aufgabe, der sich Christinnen und Christen täglich aufs Neue stellen. Wir können uns die Nächsten nicht aussuchen. Weil sie uns aussuchen. Weil wir selbst die Nächsten werden können im Ernstfall. Nächstenliebe ist keine Abstandsmessung, sondern eine Standortbestimmung.
Jesus sitzt im Tempel gegenüber dem Gotteskasten und schaut den Menschen zu, wie sie ihre Gaben hineinlegen. Erst Reiche, dann eine arme Witwe. Sie legt die sprichwörtlich gewordenen zwei Scherflein in den Kasten. So viel sie eben geben kann. Jesus kommentiert das mit den Worten: „Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt.“ Jede und jeder hat etwas zu geben. Das Geben ist in den jungen christlichen Gemeinden nicht mehr den Königen und Beamten vorbehalten, die durch Wohltätigkeit ihre Macht zeigen. Etwas zu geben zu haben, gehört zur Würde des Menschen. „Gott beschenkt uns, damit wir im Rahmen unserer Möglichkeiten selber Schenkende werden können“, so formuliert der evangelische Theologe Miroslav Volf eine zentrale christliche Lebenshaltung. Alle gaben von dem, was sie hatten – die Reichen mehr, die Ärmeren weniger. Aber alle gaben etwas. Der Wert des Gebens, der sonst nur den Vermögenden vorbehalten war, wurde zu einem verbindenden Wert aller. Und auch Solidarität und Nächstenliebe, die unter den Armen lebendig waren, wurden zu Werten aller, der Habenichtse und der Wohlhabenden. So kam es zu einem Ausgleich. So helfen wir einander.
Michael Chalupka
Bischof der evangelischen Kirche A.B. in Österreich
Persönlicher Zugang
Bereits der Titel meines Buches „Hilfreich helfen“ suggeriert, dass Helfen an sich nicht unproblematisch ist. Wahrscheinlich haben wir alle schon Erfahrungen gemacht mit einer gut gemeinten Hilfe, die so ganz und gar nicht hilfreich war. Helfen ist eine sehr besondere Form von Beziehung, in der viele Komponenten zusammenspielen. Im vorliegenden Buch möchte ich einige Facetten der helfenden Beziehung aufzeigen. Viele Aspekte der Hilfeleistung und der Hilfe im Allgemeinen bleiben dabei unberücksichtigt. Mir geht es um die Dynamik in dieser Beziehung, wenngleich andere Aspekte (diakonische, soziologische, politische etc.) naturgemäß mit hereinspielen.
Persönlich bin ich auf mindestens vier Ebenen vom Thema so betroffen, sodass es mir zum Bedürfnis wurde, es einer eingehenden Reflexion zu unterziehen:
Erstens bin ich von Kindesbeinen an damit befasst, da in meiner Herkunftsfamilie durch die Gehörlosigkeit meines Vaters und durch eine sehr ausgeprägte Tradition der Hilfsbereitschaft auf der Seite meiner mütterlichen Vorfahren das Thema stets im Raum stand.
Zweitens habe ich selbst helfende Berufe gewählt. Mein erstes Studium war Sozialarbeit. Über diese bin ich dann zur Theologie und in den Pfarrberuf gekommen, durchaus auch davon motiviert, hier eine Schnittstelle von verschiedenen Ebenen der Hilfe vorzufinden, von der seelsorgerlichen über die soziale bis hin zur politischen. Ich habe diesen Beruf immer gerne ausgeübt. Er hat mir die Erfüllung gebracht, die ich mir erhoffte, auch weil „helfen“ für mich Sinn stiftend ist und so wesentlich zum Glück beiträgt – so wie ich es verstehe. Seit nunmehr fast zehn Jahren bin ich als evangelischer Pfarrer für die Seelsorge in sieben sehr unterschiedlichen Justizanstalten in Niederösterreich zuständig und bin als solcher täglich in sehr vielschichtigen, sicher aber auch helfenden Beziehungen und dies in einem sehr speziellen Kontext. Ich bin selbst ein Helfer mit all den Facetten (und noch vielen mehr), die im Folgenden beleuchtet werden. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema und das Formulieren dessen, was meine Erfahrung so wesentlich prägt, haben mir in meinem Selbstverständnis geholfen und den Blick geschärft.
Drittens beschäftigt mich eine Beobachtung aus meiner Seelsorge-Praxis in den Haftanstalten besonders: Wider Erwarten begegnen mir überdurchschnittlich viele Insassen und Insassinnen, die in irgendeiner Weise glaubhaft „nur helfen“ wollten. Sie sagen etwa: „Ich wollte ihn ja nicht im Stich lassen …“, „Er tat mir so leid.“ und Ähnliches. Sie beschreiben sich selbst als „Helfer“. So z. B. die sogenannten „Driver“ während der großen Flüchtlingsbewegung 2015, die sich – auch angesichts der Flüchtlingsnot – bereit erklärten, für einen gewissen Betrag als Chauffeur über die Grenze zu dienen, während diejenigen, die das Geld abkassiert haben, in sicheren Gefilden blieben. Ich vermute, es sind mindestens so viele „Helfer“ inhaftiert wie Menschen mit einer starken kriminellen Energie. Immer wieder höre ich einander ähnelnde Beschreibungen von helfenden Lebensstilen: Man habe sich ja immer um alle gekümmert und so weiter. Auch finde ich dieses „helfende“ Verhalten mit seinen positiven und problematischen Schattierungen in der Lebensgemeinschaft der Inhaftierten wieder. Es reicht von tiefer Solidarität bis zu einem ausbeuterischen Gehabe und Abhängigkeitsverhältnissen. „Helfen“ ist eines der gängigsten Themen im Zusammenleben in Gefängnissen.
Viertens bin ich als Supervisor, Trainer und Berater im Non-Profit-Bereich tätig, also in Kontexten wie Krankenhaus, Obdachlosenarbeit, Hospiz, Notfall- und Telefonseelsorge und in der Ausbildung im Beratungsumfeld. In dieser Rolle gilt es, in erster Linie Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen schnell und präzise zu erkennen und zur Sprache zu bringen. Naturgemäß ist hier die helfende Beziehung das Leitthema, gerade im Bereich der Seelsorge, in der das Tun und die Aktion sehr oft völlig zurückgenommen werden müssen und das Helfen im radikalen Verzicht auf eine Handlung, also im Mit-Aushalten und schweigenden Begleiten besteht. Helfen ist gerade hier ganz auf eine Beziehungsebene reduziert. In diesen Fällen des Helfens wird etwas deutlich, das allen anderen helfenden Beziehungen, die mehr äußere Handlungen beinhalten, zugrunde liegt: Es geht um eine Haltung, ein achtsames Da-Sein.
Ich habe das Thema in mehreren Vorträgen, Workshops und Studientagen im Bereich von Diakonie und Caritas bzw. Ausbildung und Kirche auch vor dem Hintergrund ehrenamtlicher Arbeit eingebracht und vor allem das letzte Kapitel „Zehn Kriterien für hilfreiches Helfen“ vor diesem Hintergrund entwickelt.
Das vorliegende Buch hat drei Hauptteile: Nach einer anthropologischen Betrachtung wird nach einem Vor-Bild des Helfens gefragt, das ich im Gleichnis des „barmherzigen Samariters“ finde. Schließlich folgen Kriterien, die dazu beitragen sollen, in der Praxis in verschiedenen Kontexten den Blick zu schärfen.
Dass ich meinen Text nicht in durchgehend inklusiver Form formuliert habe, bitte ich mir nachzusehen. Es spiegelt nicht mein grundsätzliches Anliegen für inklusive Sprache wider, sondern ist schlicht der Schreib- und Lesbarkeit geschuldet. Ich bitte, das jeweils andere Geschlecht mitzudenken.
Was versteht man unter dem Begriff „helfen“?
„Helfen“ ist grammatikalisch ein Verb, ein Tätigkeitswort. Ich vermute, dass die meisten spontanen Assoziationen zum Verb „helfen“ auf eine Tätigkeit zielen und einen Helfenden und einen, dem geholfen wird, im Blick haben. Es ist also ein Beziehungsgefüge zwischen einer aktiven und einer passiven Person. Der deutsche Duden stellt allerdings eine zweite Bedeutung daneben, die eher von beschreibender Natur ist, wie etwa „es hilft“.
Bedeutungen von „helfen“:1
1. jemandem durch tatkräftiges Eingreifen, durch Handreichungen oder körperliche Hilfestellung, durch irgendwelche Mittel oder den Einsatz seiner Persönlichkeit ermöglichen, [schneller und leichter] ein bestimmtes Ziel zu erreichen; jemandem bei etwas behilflich sein, Hilfe leisten
2. im Hinblick auf die Erreichung eines angestrebten Zieles förderlich sein, die Durchführung einer bestimmten Absicht o. Ä. erleichtern; nützen
Im Titel dieses Buches „Hilfreich helfen“ stecken beide Bedeutungen: zum einen das Beziehungsgefüge „helfen“, zum anderen wird angedeutet, dass dieses Verhältnis zwischen Geben und Nehmen sich nicht einfach selbst reguliert. Ob „es hilft“, im Sinne von „einem Ziel förderlich sein“, hängt von vielen Faktoren ab und muss erst evaluiert werden – und zwar vonseiten der Person, die Hilfe empfangen hat. Sie allein kann es, im Sinne eines Feedbacks, beurteilen, weil sie auch das Ziel des Helfens war und ist.
Schon bei der ersten Annäherung an die Begrifflichkeit kommt ein Unbehagen auf, spiegelt sich doch sofort ein Gefälle innerhalb dieser Beziehung wider. Da ist das helfende Subjekt in seiner Freiheit und dort das empfangende Objekt in seiner Abhängigkeit. Allein diese Spannung lässt ahnen, wie vulnerabel diese Beziehung ist und wie sehr es einer inneren Haltung und eines reflektierten Bewusstseins bedarf, die äußere Unausgewogenheit der Abhängigkeiten auszugleichen. In seiner bemerkenswerten Schrift „Partnerschaftliches Helfen“ plädiert Ulrich Bach für eine anzustrebende Zielvorstellung, „das ,für‘ durch ein ,mit‘ zu ersetzen, das heißt: wir bezeichnen es nicht als unser Ziel, für den anderen zu sorgen, sondern mit ihm zu leben“2. In meiner Arbeit als Gefängnisseelsorger erlebe ich es immer wieder, dass dieses Miteinander einer aufrichtigen und wertschätzenden Begegnung das eigentlich Hilfreiche ist. Geben und Nehmen fließen oft ineinander. Wie dies im folgenden Gedicht zum Ausdruck kommt:
Seelsorgebesuch bei Mustafa (im Gefängnis)
ich bin müde
ich besuche mustafa
draußen knallt eine eisentür,
stimmengewirr
ein beamtenschlüssel klirrt
wir sitzen vor dem aquarium
schweigen mit den fischen
es ist still
draußen wird debattiert
telefoniert
es ist still
ich hole atem im schweigen der fische
im schweigen mit mustafa
wir holen atem
es ist gut
Helfen ist bei Weitem mehr als äußeres Handeln, es ist auch Arbeit mit und in sich selbst. Das gilt sowohl für den Helfenden als auch für den, der Hilfe empfängt. Gleichzeitig ist das „Helfen“ aber im Menschen als Beziehungswesen angelegt, wie es Joachim Bauer im Kontrast zur Darwin’schen Durchsetzungstheorie eindrucksvoll aufgezeigt hat.3 Demnach zielen die neurobiologischen Motivationssysteme auf Beziehung ab: „Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr, wie vom anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben von positiver Zuwendung und – erst recht – die Erfahrung von Liebe.“4 Das heißt, die Motivation zum Helfen liegt nicht in einem äußeren Imperativ, nicht in Ethik und Moral, Anstand und Sitte begründet, sondern ist geradezu als Veranlagung dem Menschen innewohnend. So kommen Heinz Rüegger und Christoph Sigrist in ihrem Buch „Helfendes Handeln im Spannungsfeld theologischer Begründungsansätze“ unter anderem zu dem Fazit: „Helfendes Handeln ist keine christliche Spezialität, sondern ein allgemeinmenschliches Phänomen. (…) Menschen ist (naturwissenschaftlich gesehen) von ihrer evolutionsbiologischen Entwicklung oder (theologisch gesprochen) von der Schöpfung her eine Disposition zu sozialem Verhalten und zu Empathie eigen.“5 Sie ist weder gut noch schlecht, sondern in sich ambivalent: Sie birgt gleichzeitig ein – von Spiegelneuronen6 bewirktes – Mitgefühl sowie auch ein Bedürfnis nach Anerkennung, unter Umständen ein nicht gerade uneigennütziges Machtbedürfnis. Umso deutlicher obliegt es der Reflexion, den Impuls zu helfen so zu qualifizieren, dass er „hilfreich“, also dem Ziel nützlich und dem Gegenüber gerecht wird. Dieser Aufgabe möchte sich das vorliegende Buch stellen.
Zu helfen ist zutiefst menschlich und steht damit auch dem umfassenden Helfen Gottes gegenüber. Dies gilt es vor dem Hintergrund biblischen Sprachgebrauchs insofern zu betonen, als das griechische Wort sozein (das auch das hebräische jaschá wiedergibt) in der Lutherbibel in der Regel mit „helfen“ übersetzt wird, im Wesentlichen aber „retten“ meint und somit in der Hand Gottes liegt. „Die enge Beziehung von ,helfen‘ und ,retten‘ weist auf etwas für den Glaubenden Grundlegendes: Alles Helfen-Können gründet in der vorausgehenden rettenden Hilfe Gottes. Weil mir und sofern mir geholfen ist, kann ich helfen.“7 Vor diesem Hintergrund bleibt menschliches Helfen eben menschlich auch im Sinne von „begrenzt“. Der Mensch ist nicht zuständig für die allumfassende Hilfe des Heilwerdens. Sein Helfen bleibt in einem begrenzten Rahmen. Zum einen sind die Möglichkeiten des Menschen begrenzt, zum anderen sind auch die Helfenden selbst bedürftig und angewiesen. So wird auch die eingeschränkte Hilfe des Menschen durchlässig für eine umfassende Hilfe über den menschlichen Horizont hinaus. Der französische Chirurg Paré (gest. 1590) bringt es auf den Punkt: „Der Arzt behandelt, Gott heilt.“8
Kapitel I – Der helfende Mensch
Das Angewiesensein des Menschen
Kaum ein Lebewesen kommt so unfertig auf die Welt wie der Mensch. Ein Säugling ist nicht nur auf Nahrungszufuhr angewiesen, sondern auch auf umfassenden Schutz und Zuwendung. Bis zur selbstständigen Überlebensfähigkeit eines Menschen braucht es eine lange Zeit. Allein bis alle physischen Voraussetzungen für das Überleben ausgebildet sind, vergehen Jahre. Wer in der ersten Zeit seines Lebens keine positive Bindungserfahrung gemacht und wenig Zuwendung erhalten hat, wird ein Leben lang davon geprägt sein. Seiner Umwelt ausgeliefert lernt das Kind von dem, was es wahrnimmt und was ihm widerfährt. Lernt es Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wärme und Liebe, wird es psychisch „gut genährt“ und selbst bindungs- und beziehungsfähig werden. Das Kind ist vollständig abhängig davon, was es bekommt.
Dieses vollkommene Angewiesensein des Menschen ist nicht sein Mangel, sondern gehört meines Erachtens zu seiner Würde, denn es ist ein unverwechselbares Wesensmerkmal. Das ganze menschliche Leben ist darauf ausgerichtet und erfährt unter anderem genau in diesem Angewiesensein eine Bestimmung. So auch Ulrich Körtner: „Hilfsbedürftigkeit widerspricht nicht der Würde des Menschen – theologisch gesprochen: seiner Gottebenbildlichkeit – sondern gehört zum Wesen des Menschenseins, weil es zu seiner Endlichkeit gehört.“9 Dies gilt nicht nur für den Beginn des menschlichen Lebens, sondern in ähnlicher Weise auch für dessen Ende. Der alte Mensch wird mit aller Wahrscheinlichkeit im Ausmaß seiner zunehmenden Gebrechlichkeit wieder auf fremde Unterstützung und Hilfe angewiesen sein, um sein Überleben zu sichern. Diese sich steigernde Hilfsbedürftigkeit wird sehr oft als Verlust erfahren und als Mangel an Gesundheit, Beweglichkeit und Orientierung, als Einschränkung. Je älter die Menschen werden, desto länger kann die Lebensphase der besonderen Hilfsbedürftigkeit dauern. In einer Zeit, in der Freiheit, Selbstbestimmtheit und Gesundheit als besondere Werte vermittelt werden, kann der Mangel gerade an den – diesen Werten entsprechenden – Fähigkeiten auch als beschämend und erniedrigend erfahren werden.
Umso deutlicher ist entgegenzuhalten: So sehr die grundsätzliche Hilfsbedürftigkeit zur Würde des heranwachsenden Menschen zählt, so sehr darf sie auch am Ende seines Lebens nicht nur als Mangel, sondern auch als seine Würde verstanden werden. Dies gilt es zu betonen, da die Idee, dass Hilfsbedürftigkeit zur menschlichen Würde zählt, dem subjektiven Empfinden kaum entspricht. Auch wirkt diese Sichtweise einer konsumorientierten Propaganda entgegen, die uns ständig mit der Darstellung unversehrten Lebens als Lebenserfüllung konfrontiert. Es wird indirekt suggeriert, dass ein Leben, in dem Maß, in dem es auf Hilfe angewiesen ist, an Wert verliert. Die Werte der Selbstständigkeit, Mündigkeit und das Verständnis von Freiheit als Gestaltungsmöglichkeit des Lebens, die seit der Aufklärung mit gutem Recht unser Dasein bestimmen und in die Pflicht nehmen, werden mit zunehmender Gebrechlichkeit unerfüllt bleiben. Eingeschränkt zu sein, geht vor diesem Hintergrund sehr leicht mit einem subjektiven Gefühl von Versagen einher. Gegen dieses beschämende Erleben ist es mir ein Anliegen, die Angewiesenheit des Menschen am Ende des Lebens als seine Würde zu postulieren. Angewiesenheit und Würde gehören zusammen, zählen sie doch beide ganz zur „Geschöpflichkeit“ des Menschen. Dies hat weitreichende Konsequenzen nicht nur in der psychologischen und seelsorgerlichen Begleitung von Menschen, sondern auch und ganz besonders in den entsprechenden Bereichen der Sozialethik und der Sozialpolitik.
Vor diesem Hintergrund ist auch das vierte Gebot des Dekalogs10 zu verstehen, in dem aufgefordert wird, „Vater und Mutter zu ehren“. Obwohl es zunächst um die Versorgung geht, könnte „ehren“ auch verstanden werden als „sich der gegebenen Würde von Vater und Mutter gegenüber zu verhalten“. Es zielt weit über die reine materielle Versorgung hinaus, die man ja auch anders zum Ausdruck hätte bringen können. Das hebräische Wort kabad bedeutet „groß machen“, „Gewicht geben“ und schließt die Übersetzungsmöglichkeit „ehren“ beziehungsweise „würdigen“ oder „Würde geben“ mit ein.
Das Alter hat in unseren Breiten seine immanente Würde weitgehend verloren. Auch ein alter Mensch hat nicht mehr an sich, also allein aufgrund seines Alters, eine spezifische Würde, sondern muss sich erst als würdig erweisen. Das war früher und ist in vielen Kulturen anders. Man mag das verschieden bewerten. Eines aber ist klar: Mit dem Verlust der Würdigung des Alters wird die Jugendlichkeit umso mehr idealisiert und geehrt. Mit ihr verbindet man vor allem Schnelligkeit, Dynamik und praktische Fertigkeit. Es erinnert an ein Lied, das Helmut Qualtinger in den 1970er-Jahren – in der Blüte der Moderne – gesungen hat: „Der Halbwilde“. Da heißt es unter anderem: „I fohr jetzt jeda Limosin vor, schließlich liebt da Mensch von heit den Sport. I hab zwor ka Auhnung, wo i hinfohr, dafür bin i gschwinder dort.“11 Die Methode siegt über den zu vermittelnden Inhalt, Rhetorik wird zur geschliffenen Sprechfertigkeit, die manche Aussage eher verschleiert als klarlegt oder auch ohne Aussage ist.





























