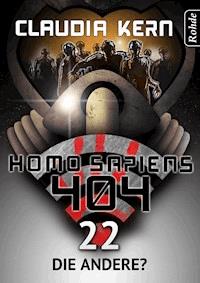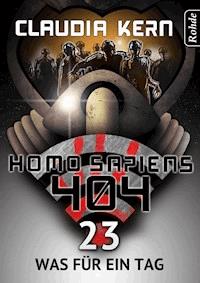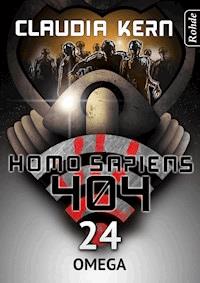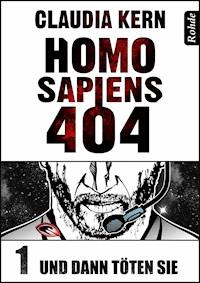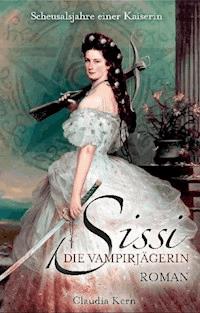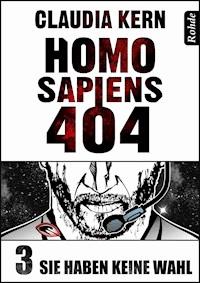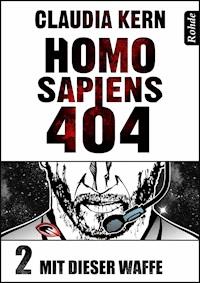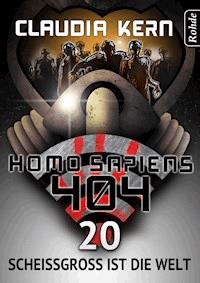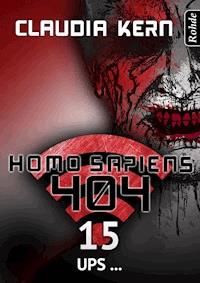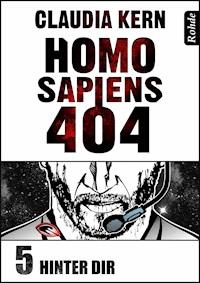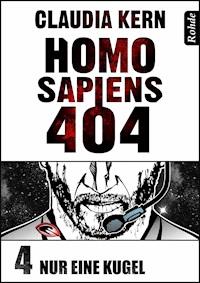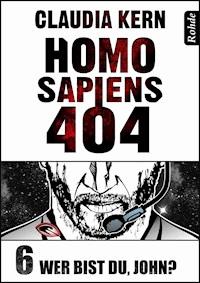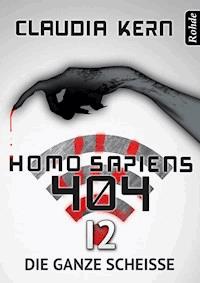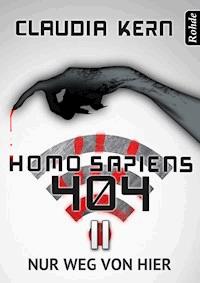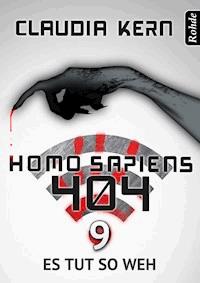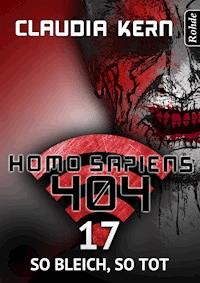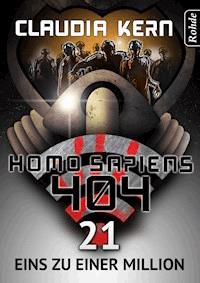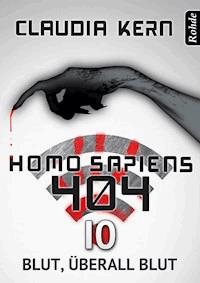
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rohde, Markus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Homo Sapiens 404
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dies ist die zehnte Episode der Romanserie "Homo Sapiens 404". Scania - eine halb fertige, nie zu Ende gebaute Raumstation der Menschen tief im All. Der Name geistert auf einmal durch das Internet, aber alle Versuche, den Grund dafür herauszufinden, scheitern. Kipling überzeugt die Besatzung der Eliot, dieser Station einen Besuch abzustatten. Dass sich das als eine seiner schlechteren Ideen herausstellt, verrät bereits der Titel. Über die Serie: Einige Jahrzehnte in der Zukunft: Dank außerirdischer Technologie hat die Menschheit den Sprung zu den Sternen geschafft und das Sonnensystem kolonisiert. Doch die Reise endet in einer Katastrophe. Auf der Erde bricht ein Virus aus, der Menschen in mordgierige Zombies verwandelt. Daraufhin riegeln die Außerirdischen das Sonnensystem ab und überlassen die Menschen dort ihrem Schicksal. Die, die entkommen konnten, werden zu Nomaden in einem ihnen fremden Universum, verachtet und gedemütigt von den Außerirdischen, ohne Ziel, ohne Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Episode 10
Blut, überall Blut
Claudia Kern
Digitale Originalausgabe
Homo Sapiens 404 wird herausgegeben vom Rohde Verlag
Rohde Verlag, Auf der Heide 43, 53757 Sankt Augustin
Verleger & Redaktion: Markus Rohde
Autorin: Claudia Kern
Lektorat: Susanne Picard
Covermotiv & -gestaltung: Sebastian Lorenz
Copyright © 2013 by Rohde Verlag
ISBN 978-3-95662-022-5
www.claudia-kern.com
www.helden-in-serie.de
www.rohde-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Die Autorin
Lesetipp des Verlags
»Wenn man alles haben kann, ist nichts mehr absonderlich. Das ist die große Lehre des Internets. Die andere lautet: Wenn alle es haben wollen, ist es wahrscheinlich voller Malware, Trojaner und Viren. Und ich habe eben versehentlich >die große Leere des Internets< geschrieben, was es seltsamerweise trifft. Denn wenn man alles haben kann, gibt es auch nichts mehr zu entdecken, nur zu ergoogeln. Umso erstaunlicher, wenn man auf ein Wort trifft, es googelt und das Internet schweigt. Das ist das Necronomicon der Gegenwart, das Geheimwissen, das nur Blut erkaufen kann.«
– Nerdprediger Dan, ASCII-Zeichen für die Ewigkeit
1
Mit einem Knopfdruck schaltete Rin die Triebwerke ab. Die James K. Polk stürzte in die Tiefe. Es wurde still auf der Brücke, weder Kipling noch Lanzo sprachen Rin an. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass sich beide an den Armlehnen ihrer Sitze festhielten. Das grüne, blinkende Licht, das den eingehenden Funkspruch eines der drei Abfängjäger angezeigt hatte, erlosch. Die Jockeys an Bord schienen erkannt zu haben, dass die Besatzung der Polk nicht mit ihnen reden würde. Noch hingen ihre Schiffe reglos am Himmel. Das abrupte Manöver hatte die Piloten überrascht.
Das wird nicht so bleiben, dachte Rin, während sie den Höhenmesser betrachtete. Die Polk hatte sich in neuntausend Meter Höhe befunden, als sie von den Jockeyschiffen abgefangen worden war, der Fall zurück zur Oberfläche würde rund drei Minuten dauern.
»Positionslichter und Scheinwerfer aus«, sagte Rin. Sie schloss die Hände fest um die Joysticks.
Kipling beugte sich vor. »Sind aus.«
Auf dem Bildschirm war Schwärze zu sehen und das kalte Funkeln der Sterne. Die Messungen der Scanner wurden in 3D-Modelle übertragen, die in dem kleinen Monitor in Rins Konsole zu sehen waren. Sie zeigten einen vollkommen flachen Untergrund. Die Polk fiel dem Ozean entgegen.
»Nur um das Offensichtliche auszuschließen«, sagte Kipling. »Die Polk kann nicht tauchen, oder?«
Rin schüttelte den Kopf. Auf ihrem Monitor sah sie, dass die drei Abfangjäger ihre Positionen verlassen hatten. Sie hatten ihre Triebwerke nicht abgeschaltet und kamen deshalb rasch näher. Ihre Lichter tauchten nun auch auf dem Hauptbildschirm auf.
»Können ihre Scanner uns sehen?«, fragte Rin.
»Nein«, sagte Lanzo. »Wir geben kaum Wärme ab und keine Helligkeit. Deshalb haben die Jockeys die Scheinwerfer eingeschaltet.«
Deren Licht strich über die dichten Wolken unterhalb der Polk. Sie sahen aus wie graue Gebirge. Rin drückte die Nase des Schiffs nach unten. Es schoss auf die Wolken zu. Die Joysticks zitterten in ihren Händen. Turbulenzen schüttelten die Polk durch.
»Wir sind aus der Zielerfassung der Jockeys raus«, sagte Kipling. Er klang erstaunlich ruhig. »Sie können nur noch auf Sicht schießen.«
Und das taten sie im gleichen Moment. Ein bläulich leuchtender Plasmabolzen raste einige Dutzend Meter an der Polk vorbei und verlor sich in der Dunkelheit.
Lanzo stieß laut den Atem aus. »Und ich hatte gehofft, dass sie uns lebend wollen.«
Rin antwortete nicht. Sie konzentrierte sich auf die Joysticks und das Gefühl, das sie ihr für das Schiff vermittelten. Ohne Triebwerke reagierte die Polk noch schwerfälliger als sonst. Es kam ihr fast so vor, als müsse sie das Schiff mit reiner Muskelkraft steuern, so sehr widersetzte es sich jeder ihrer Bewegungen.
Sie hatten die Wolkendecke fast erreicht. Rin wusste nicht, wie tief sie herunterreichte. Sie hatte auf dem Weg nach oben nicht darauf geachtet. Kurz bevor das Grau über dem Schiff zusammenschlug, riss sie die Joysticks mit aller Kraft nach hinten.
Die Nase der Polk hob sich langsam, schwerfällig, widerwillig. Das Metall der Tragflächen knirschte unter der Belastung. Graue Schlieren, durch die immer wieder das Licht der Jockeyschiffe fiel, rasten auf dem Bildschirm vorbei.
Komm schon, dachte Rin. Sie zog an den Joysticks, bis ihre Arme schmerzten und warf einen Blick auf den Höhenmesser. Die Fallgeschwindigkeit nahm ab, die Polk stabilisierte sich. Wie ein Segelflugzeug glitt sie nun durch die Wolken, getragen vom Wind und ihrer eigenen Geschwindigkeit.
»Sehr Star Trek II«, sagte Kipling. »Kirk gegen Khan im Mutara-Nebel. Wie lange–«
Ein Plasmabolzen schoss diagonal am Bug der Polk vorbei, dann ein zweiter aus der gleichen Richtung. Unwillkürlich stellte sich Rin Männer vor, die mit Speeren im trüben Wasser nach Fischen stießen.
Kipling räusperte sich und wischte sich nervös die Hände an seiner Hose ab. »Wie lange noch, bis du die Triebwerke einschalten musst?«
»Ein paar Minuten vielleicht.« Rin sah nicht auf. Ihre Blicke glitten zwischen dem Höhenmesser und den Sensorenanzeigen hin und her. Die Polk fiel immer noch, aber deutlich langsamer als zuvor. Die Jockeyschiffe irrten hinter und über ihnen durch die Wolken.
»Sie haben keine Ahnung, wo wir sind, oder?«, sagte Lanzo. Er hatte sich in seinem Sitz vorgebeugt, hielt sich mit einer Hand an der Konsole fest und tippte mit der anderen etwas ein. »Waffensysteme sind online.«
»Was ist mit der Zielerfassung?«
»Würde ich nicht riskieren.« Kipling beugte sich nun ebenfalls vor. »Das Signal ist sehr stark. Eventuell könnten sie uns darüber orten.«
»Okay.« Das hatte Rin befürchtet. Sie drückte die Joysticks zur Seite und brachte die Polk in eine langgezogene Rechtskurve. Die Geschwindigkeit nahm ab, das Schiff sackte nach unten. Einen Augenblick lang fühlte sich Rin beinahe schwerelos, dann drückte ihr Gewicht sie wieder in den Sitz.
Aus der Kurve wurde ein Halbkreis. Die Jockeyschiffe verschwanden kurz vom Monitor, als die Scanner sie in den Wolken verloren. Nur Sekunden später blinkten sie wieder. Rin zuckte zusammen. Eines der Schiffe befand sich unmittelbar vor ihr. Sie konnte auf dem Bildschirm sogar das Licht seiner Triebwerke sehen.
Lanzo schoss.
Zwei Plasmabolzen, kleiner und schmaler als die der Jockeys, rasten auf das Triebwerklicht zu. Der Abfangjäger machte einen Schlenker nach links. Einer der Bolzen verschwand in den Wolken, doch der andere traf sein Ziel.
Rin hörte einen gedämpften Knall. Die Explosion riss die Wolkendecke auf. Wasser, Metall und Kunststoff verdampfte in einem gewaltigen, gleißend hellen Feuerball. Trümmer rasten an der Polk vorbei, einige schlugen gegen den Rumpf. Die Druckwelle warf das Schiff herum. Es überschlug sich mehrfach, die Sicherheitsgurte schnitten tief in Rins Schultern. Dann, auf einmal, klatschte Regen auf die Außenkameras. Die Wolkendecke befand sich über der Polk, ein aufgewühlter Ozean unter ihr.
Ein Knopfdruck und die Triebwerke heulten auf. Das Schiff raste auf die Wellen zu. Rin riss an den Joysticks. Metall knirschte, das Deck bebte unter ihren Füßen, die Tür zur Brücke öffnete sich und knallte gegen die Wand.
Auf dem Bildschirm sah sie, wie brennende Trümmer in den Ozean stürzten. Die Nase der Polk hob sich Zentimeter um Zentimeter, aber das Wasser kam immer näher. Die Wellen wogten hoch, so als wollten sie das Schiff verschlingen.
Wir sind zu schwerfällig, dachte Rin. Das schaffen wir nicht mehr.
Trotzdem zog sie weiter an den Joysticks. Sie konnte nichts anderes tun. Die anderen beiden Abfangjäger hefteten sich an die Polk.
»Ihre Zielerfassung ist aktiviert«, rief Lanzo über das Dröhnen und Donnern hinweg. »Wir–«
»… springen«, unterbrach ihn Kipling. Seine Finger flogen über die Tastatur seiner Konsole. »Das ist unsere einzige Chance.«
»Ohne Sprungtor? Bist du verrückt? Was ist, wenn wir in einer Sonne landen oder mitten im Nichts?«
»Was ist, wenn wir hierbleiben?«, schrie Kipling zurück.
Wellen trafen die Unterseite des Schiffs. Es fühlte sich an, als führe man über Kopfsteinpflaster. Rin hatte die Polk nicht mehr unter Kontrolle. Das Schiff trudelte und drehte sich zur Seite. Seine rechte Tragfläche berührte fast schon das Wasser. Die Steuerung reagierte nicht mehr.
»Spring!«, rief Rin.
Und die Polk sprang.
2
Ein dumpfer Knall.
Auckland drehte im Laufen den Kopf und sah, wie sich weit entfernt über dem Ozean die Wolken rot färbten.
»Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße?«, fragte Arnest neben ihm. Sein Atem ging stoßweise, aber noch hielt er mit. Er wusste ebenso wie Auckland, dass sie sich nicht ausruhen konnten. Die Jockeys auf ihren Flugsauriern schwärmten immer weiter aus, suchten nun nicht mehr nur zwischen den Hügeln nach Ryn’Nels Angreifern, sondern auch am Strand. Lichtkegel strichen über den Sand. Mit jedem Kreis, den die Saurier am Himmel zogen, kamen sie näher. Auckland hörte bereits ihr Krächzen.
»Eine Explosion«, sagte Auckland. Er dachte an die Polk.
Arnest sah ihn an. Regen und Schweiß liefen ihm über das Gesicht. »Ich weiß, dass das eine kack Explosion war. Ich will wissen, was da explodiert–«
Ein zweiter Knall, so scharf, als hätte jemand direkt neben Aucklands Ohr in die Hände geklatscht, aber gleichzeitig so leise, als käme er von der anderen Seite des Planeten. Es war der seltsamste Laut, den er je gehört hatte.
»Und was für eine Scheiße war das jetzt?«
»Keine Ahnung.« Auckland warf einen Blick auf die Flugsaurier. Sie schwärmten nicht mehr aus, sondern hingen beinahe reglos am Himmel. Das Geräusch schien auch sie zu verwirren. Der Wind trug Stimmen zu ihm herüber, Worte in einer fremden, guttural klingenden Sprache. Nur einen Moment später wandten die Jockeys sich gleichzeitig ab und flogen auf die Hügel zu, die den Strand einrahmten. Ihr Flügelschlag wirkte hektisch, fast schon panisch.
Das kann nichts Gutes bedeuten.
»Ey, Auckland, das Meer ist weg.«
»Was?« Er drehte sich um. Obwohl Dunkelheit und Regen die Sicht erschwerten, sah er, dass das Wasser zurückgewichen war, so als herrsche plötzlich Ebbe. Sie waren dicht am Meer entlang gelaufen, um nicht so tief im Sand einzusinken, doch nun trennten sie zwanzig Meter, vielleicht auch mehr vom Wasser.
Ein Rauschen mischte sich in das Prasseln des Regens. »Lauf«, sagte Auckland.
»Ich lauf schon die ganze scheiß Zeit.«
»Dann weißt du ja, wie’s geht. Zu den Hügeln. Komm!«
Er zog Arnest hinter sich her. Das Rauschen wurde lauter.
»Was ist denn los?«, rief Arnest.
»Tsunami.«
»Scheiße.«
Arnest riss sich aus Aucklands Griff los und zog an ihm vorbei. Er war vielleicht nicht der Schlauste, aber wenn er ein Problem erst verstanden hatte, löste er es kompromisslos und entschlossen. In diesem Fall war das Problem ein Tsunami, die Lösung Weglaufen und das tat er so schnell, dass Auckland gerade noch mithalten konnte.
Kurz dachte er darüber nach, zu Ryn’Nels Haus zurückzukehren und in den oberen Etagen Schutz zu suchen. Doch er entschied sich dagegen. Die Hügel waren nicht weiter entfernt als das Haus und es war möglich, dass Ryn’Nel nicht mehr allein war.
Auckland drehte den Kopf und wischte sich den Regen aus den Augen. Weit entfernt sah er etwas, das wie ein weißer Strich in der Dunkelheit aussah. Es zog sich an der ganzen Bucht entlang.
Eine Schaumkrone, dachte er. Die Welle schwappte heran. Er wusste nicht, wie hoch sie war, aber dass die Schaumkrone weit über der normalen Wasseroberfläche zu hängen schien, machte ihn nervös. Das Rauschen war jetzt lauter als der Regen.
»Halt erst an, wenn es nicht mehr höher geht«, rief er darüber hinweg.
»Ich bin nicht blöd«, rief Arnest zurück. »Kipling hat mir Tsunami Shark 2: Blood Water gezeigt. Ich weiß, was hier abgeht.«
Der Regen hörte schlagartig auf. Wind drückte in Aucklands Rücken. Die Wolkendecke riss auf und enthüllte ein endloses, funkelndes Meer aus Sternen. In ihrem Licht sah Auckland die Hügel, die vor ihm aus dem Sand ragten und sanft anstiegen. Das hohe Gras, das sie bedeckte und im Wind hin und her wogte, wirkte grau. Zwischen ihnen schimmerten weiße Felsen hindurch.
Der Boden unter ihm stieg an und wurde fester. Muscheln und Steine bohrten sich in seine nackten Fußsohlen. Sein Hemd klebte ihm am Körper. Er spürte, wie sich seine Wadenmuskeln verkrampften. Vor ihm stolperte Arnest über einen Felsen und stürzte in den Sand. Hinter ihm krachte es. Wasser schwappte über seine Füße. Es war eiskalt.