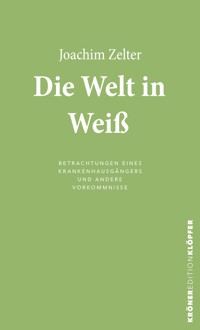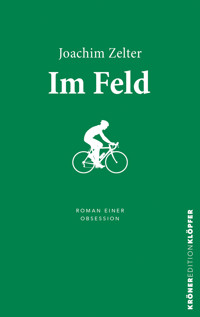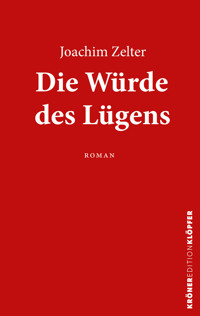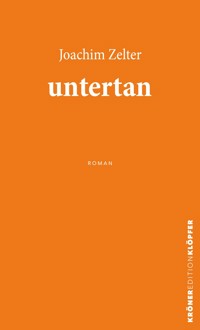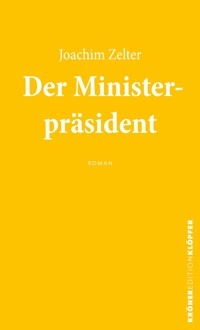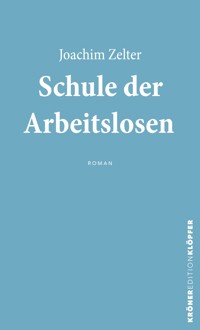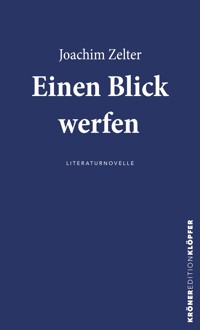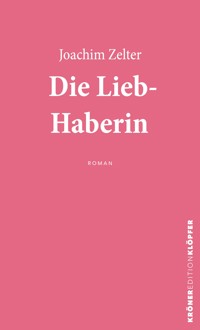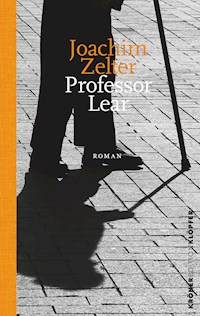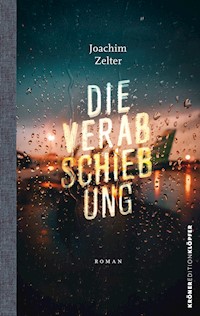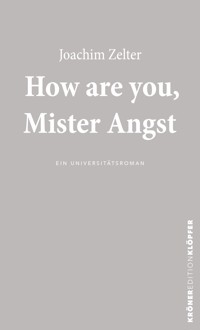
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»How are you,Mister Angst?« - erzählt von der Universität und den Menschen, die in ihr reüssieren oder untergehen, von der Einsamkeit der Professoren und ihrer Studenten, besonders aber von dem Juniorprofessor Konrad Monteiro, dem der Sinn seiner akademischen Tätigkeit abhanden gekommen ist. Aus heiterem Himmel, als er gerade meint, mit einem unhaltbaren Vortrag seinen akademischen Selbstmord zu begehen, da tritt eine nie gesehene Frau auf ihn zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Ähnliche
Joachim Zelter
How are you,
Mister Angst?
Roman
KrönerEditionKlöpfer
»Unser Leben gründet sich auf eine Auswahl von Fiktionen. Unsere Schau der Wirklichkeit ist bedingt durch unsere Position in Raum und Zeit. So beruht auch jede Interpretation der Wirklichkeit auf einer einmaligen Position. Zwei Schritte nach Osten oder Westen, und das ganze Bild verschiebt sich.«
Lawrence Durrell, Balthazar, The Alexandria Quartet (London und Boston: Faber & Faber, 1968).
* * *
Vielleicht hatte ich schon aufgehört zu atmen. Mein Mund lag betäubt auf einem Kissen. Draußen schien die Sonne, während Kinder in einem benachbarten Garten spielten. Ich lag kalt, steif und schwer schon seit Stunden in meinem Bett, hinter zugezogenen Vorhängen und geschlossenen Fenstern. Ich war nur noch ein Bild. Nicht mehr von dieser Welt. Wie verglast. Ein Hinterglasbild. Oder wie in einem Aquarium. Die Fernbedienung des Fernsehapparats steckte noch in meiner Hand, die kalt und in einem seltsamen Weiß neben mir lag. So als gehörte diese Hand schon nicht mehr zu mir. Sie war nur noch ein letztes, vergebliches Klammern – nach einer Fernbedienung.
Durch die Ritzen der Jalousien flimmerten verstaubte Sonnenstrahlen. Sie leuchteten in kleinen Rechtecken gegen die Wand an meinem Bett, das immer kälter wurde. Ich lag in Kindheitserinnerungen, während in der Wohnung über mir ein Baby schrie. Ich versuchte es – in Gedanken – zu beruhigen. Später hörte ich auf meiner Terrasse Geräusche. Jemand klopfte gegen die Glastür. Mein Name wurde gerufen, mehrere Male, in der Stimme meines Kollegen, McMurphy, der mich, wie fast jeden Dienstag während der Semesterferien, zu einer FlascheBier aufsuchen wollte. Es stand bereits in meinem Kühlschrank. Er wollte dringend mit mir sprechen, wirkte anders als sonst. Weit entfernt von seiner sonstigen Jovialität. Fast ein wenig kleinlaut und besorgt. Ich hörte es an seiner ertrinkenden Stimme. Es ging ihm nicht gut. Er rief meinen Namen mehrere Male. Seine Rufe klangen wie Hilferufe. Er klopfte gegen das Glas der Terrassentür. »Bist du da!?« Er glaubte es an der Art der herabgelassenen Jalousien zu erkennen, dass ich daheim war. Wo sollte ich sonst sein. Er ging in die Knie und blickte mit verrenktem Kopf in die Wohnung. Der Blick ging von unten nach oben. Als er mich entdeckte, sah ich in seinen Augen blankes Entsetzen. Er sprang auf und wich zurück. Ich hörte einen leichten Aufruf, etwas Ähnliches wie »O Gott!« Dann seine davoneilenden Schritte. Sein Entsetzen war überdeutlich. Womöglich war er schon auf dem Weg zu sich nach Hause, um einen Ersatzschlüssel zu holen – für meine Wohnung. Ich lag und wartete. Allmählich wurde es dunkel. In der Wohnung neben mir wurden Jalousien herabgelassen – ungewöhnlich bedächtig und rücksichtsvoll. Ich wartete weiter. Kein Arzt. Kein Geräusch eines Schlüssels an meiner Tür. Kein McMurphy. Auch kein Hausmeister, den er hätte rufen können. Ich verstehe seinen Schrecken. Ich verstehe, wie sehr mein Anblick ihn schockiert haben muss. Ein Starrbild und ein Schreckbild. Dazu der Anblick zahlloser Tablettenschachteln auf dem Fenstersims und Nachttisch. In erschreckender Deutlichkeit. Schlaftabletten: in allen Farben, Varianten und Formen, die ich mit einem Male genommen hatte. Aus dem Nichts. Ich verstand also seine Bestürzung – und wartete weiter.
Ich war ruhig, nicht obenauf, aber im Großen und Ganzen ruhig, nicht einmal müde. H
Mein Zustand erschien mir weniger ein Einschlafen als vielmehr ein langatmig umständliches Erwachen. Als ob ich nach langem Schlaf allmählich aufwachen würde. Sonst nichts. Für einen kurzen Augenblick lehnte ich mich zurück, mit dem Gedanken: Sich einfach, aus dem Nichts, der Welt zu hinterlassen. Oder sollte ich sagen: überlassen?
Mein Telefon klingelte – nur einige wenige Male, dann brach der Anrufer ab. Ich lag nun in aller Dunkelheit. Die Fernbedienung des Fernsehers glitt aus meiner Hand, der Fernsehapparat schaltete sich an, also lag ich kaum anders als sonst und schaute fern – bis in den frühen Morgen. Dabei dachte ich an meine Jugend, an eine Schulfreundin, die nahezu unbemerkt an einer seltenen Krankheit gestorben war. Nach den Sommerferien war sie nicht mehr zurückgekommen. Sie starb innerhalb weniger Tage, aus heiterem Himmel. Ich erinnerte mich nun an ihre frühen Brüste, an ihre ständig wechselnden T-Shirts, die sie in den Pausen auf der Toilette aus- und wieder anzog. Ich erinnerte mich, wie sie sich mit langen Armen im Unterricht meldete, nein, sich reckte und streckte. Wenn sie aufgerufen wurde, sagte sie: »Darf ich bitte aufs Klo.« Einmal saß sie ausdrücklich neben mir. Melanie, sie hieß Melanie.
Während ich an sie dachte, gingen mir die zahlreichen Angelegenheiten durch den Kopf, die es nun wohl zu erledigen galt: die Benachrichtigung des Seminardirektors und der Fakultät und anderer Ämter ... Ein Marathon an Erledigungen! Mehr Bürokratie als zu den schlimmsten Lebzeiten. Unzählige Telefonate, stupides Warten, Weiterverbundenwerden, die Ungläubigkeit mancher Kollegen, Bescheinigungen, Überweisungen, Nachzahlungen ... Zuallererst galt es, sich mit der Universität in Verbindung zu setzen. Die Semesterferien gingen zu Ende. Das Sommersemester rückte näher und näher. Gutachten mussten geschrieben, Hausarbeiten und Klausuren korrigiert werden. Meine Studenten warteten dringend darauf. Ein Ersatzlehrender musste bestellt werden. Mündliche wie schriftliche Prüfungen verschoben werden! Wenn das überhaupt noch möglich war. Meine Augen schielten zum Schreibtisch: die Klausuren des letzten Wintersemesters. Sie lagen überdeutlich auf einem großen Haufen. Bitte! Ich hörte den Tonfall heller Stimmen, die Stimmen meiner wenigen Studenten. Sie fragten nach ihren Arbeiten: nach einem ersten Eindruck oder gar Ergebnis. Jede einzelne Klausur eine Welt für sich. Sie warteten – schon seit mehr als einem Monat. Bitte! Ich durchdachte die Möglichkeit wenigstens einer flüchtigen Korrektur, aus dem Augenwinkel, mit einigen groben Randbemerkungen wie: Gut, Besser, Immer Besser ... Weiter so! Frei assoziierende Korrekturen, die mir durch den Kopf gingen, während ich überlegte, auf welchem Weg man den Studenten die Klausuren wieder zurückgeben könnte – wenn schon nicht zurückgeben, so doch wenigstens ein Ergebnis übermitteln. Man könnte die Noten auf ein Blatt Papier schreiben und mit einer einzigen Generalunterschrift beglaubigen. Es ist durchaus möglich, Klausuren oder Hausarbeiten zu korrigieren, ohne sie wirklich zu lesen. Wer weiß das besser als ich. Ich wähle einzelne Sätze, an denen ich einhake, durchaus nicht negativ als vielmehr frei assoziierend, derart, dass dieser Satz einer Hausarbeit an einen ähnlichen Satz eines Dichters oder Philosophen erinnert, der wiederum die Gedanken anderer Dichter oder Philosophen berührt, und so weiter und so fort – Kettensätze freundlicher Rückmeldungen für die Bemühungen meiner Studenten. Jede ihrer Hausarbeiten ist Teil einer frei assoziierten Weltgeschichte. Das Telefon klingelte. Diesmal länger. Der Anrufer brach nicht ab. Er ließ seinen Anruf deutlich klingeln und weiterklingeln. Mein Anrufbeantworter schaltete sich ein. Meine Stimme klang nicht anders als sonst, gesund und freundlich: Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf Band. Ich werde Sie zurückrufen.
Wie verglast. Ein Starrbild hinter Glas. Ich lag aufgebahrt auf meinem Bett und erlebte meinen Atem. Erlebte – was für ein Wort. Was für ein Wort: ERLEBTE. Ich klammerte mich an dieses Wort.
Später hörte ich den vertrauten Atem meiner Kollegin: Frederike Tarnart! Einführung in den E-Mail-Roman. Text und Hypertext. Medienvorlesungen. Und andere Vorlesungen. Wer sonst? Wenn nicht jetzt, dann spätestens in einer halben Stunde. Frederike Tarnart. An jedem Wochenende, während der Ferien, und auch während des Semesters: das Telefon und Frederike Tarnart. Ihr Atem ist nicht einfach nur Atmen als vielmehr Luftholen vor umfassenden Angelegenheiten – Angelegenheiten von größter Bedeutung: Semesterpläne, Stundenpläne, Raumbelegungspläne, Ersatzpläne ... Kein Tatbestand, kein Gespräch, keine Unterrichtsminute ohne irgendeinen Plan. Jahrelang telefonierte sie mich aus dem Bett. Sie spricht keine wirklichen Nachrichten, sondern Gedanken. Gedanken zu diesem und zu jenem. Bist du da? Sie duzt mich. Wir alle duzen uns. Bist du da? So als ob sie immer und zu jeder Zeit mit meinem Dasein rechnen könnte. Bist du ...? Ja, ich bin ... Selbstverständlich bin ich da. Und selbst wenn ich nicht da bin, spricht sie so, als wäre ich da, unbedingt.
Einmal, vor Monaten, war ich spät nachts nach Hause gekommen. Ich war betrunken gewesen, in Erwartung am nächsten Tag frei zu haben, und ich hörte, als ich zurückkam und mich ins Bett fallen lassen wollte, Frederike Tarnart auf dem Anrufbeantworter, mit der ewigen Frage: Bist du da? Dann teilte sie mir mit, ein Gastprofessor aus Amerika habe sich für einen Vortrag am nächsten Morgen angekündigt. Meine Anwesenheit sei dringend erwünscht. Ob ich eine kurze Einführung halten könnte? Eine Einführung zu dem Forschungsgebiet dieses Professors. Ich hatte keine Ahnung von seinem Forschungsgebiet. Ich kochte Kaffee, versuchte wieder nüchtern zu werden, kroch hinters Bücherregal und suchte mir Fachbücher zusammen ... Bis eine viertel Stunde vor Beginn des Vortrages arbeitete ich an dieser Einführung, in immer verzweifelteren Wendungen und Formulierungen und provisorischen Repliken auf Sätze, die der Professor irgendwann einmal geschrieben hatte. Zum Beispiel der Satz: »Every understanding is a misunderstanding.« Wie wahr. Ich kam gar nicht dazu, meine einführenden Worte zu sprechen. Der Gastprofessor verspätete sich. Und kein Mensch wollte bei seiner Ankunft irgendetwas von einführenden Worten wissen. Man behandelte meine Notizen fast schon als Aufdringlichkeit. All das nur wegen eines achtlos eingeschalteten Anrufbeantworters.
Und nun, einmal mehr, mitten in den Semesterferien wieder die Stimme Frederike Tarnarts: »Konrad? Bist du da?« Sie war sich völlig sicher, dass ich gar nicht anders konnte, als immerzu dazusein. Ihre erhobene Stimme erklang in meinem Zimmer, so als würde sie auf- und ablaufen, meine Bücherregale inspizierend. Einen Moment lang glaubte ich, eine Bewegung meiner linken Hand zu spüren. Sie habe eine Mitteilung zu machen. »Eine sehr wichtige Mitteilung ...«Nach jedem Satz ließ sie eine Pause, so als könnte ich mich jederzeit entschließen, das Telefon abzunehmen. Sie lief immer noch auf und ab. Schließlich legte sie auf. Sie war verärgert.
Ich lag in völliger Dunkelheit; der Fernseher hatte sich ausgeschaltet. In meinem Kopf überschlug ich einige Noten für die Seminarscheine. Ich ersann Noten für mündliche Prüfungen, die noch gar nicht abgehalten waren, aber unbedingt noch abgehalten werden mussten, noch in diesem Monat. Note auf Note, Student um Student. Ich arbeitete an einer Art Testament, ein zensurisches Testament guter und bester Noten, die ich meinen Studenten zum Abschied hinterlassen wollte. Ein Feuerwerk herausragender Noten als Ermutigung. Was mehr kann ein Dozent der Welt hinterlassen als Noten – Noten und Grüße und Worte an die Fachschaftsvertreter: Sie mögen den Studenten und ihren Eltern ausrichten, sie seien gute Eltern, ihre Töchter und Söhne seien gute Studenten: intelligent, aufgeweckt, begabt, auf einem guten Weg, auch ohne mich.
Als das Telefon wieder klingelte, war es heller Tag. Es sprachen die Stimmen einiger Kollegen auf meinen Anrufbeantworter – unter ihnen auch die Sekretärin des Seminardirektors: »Herr Monteiro? Sind Sie da?« Warum ich nicht zurückriefe? Wo ich sei? Ob es mir nicht gut gehe? Bitttelefonate wachsender Sorge: Ob ich krank sei? »Bitte melden Sie sich!« Es gehe um eine wichtige Anfrage ... Eine Frau Wenturis aus Berlin habe bei ihr angerufen ... Sie habe angefragt, ob ich für einen Vortrag zur Verfügung stünde ... Ein literarisch-akademischer Vortrag über die Dichter und Denker unserer Stadt ... Noch in diesem Sommersemester ...
Die Universität sie nimmt keine Ende. Sie ist endlos. Sie klingelt weiter und weiter und weiter. Mit der allergrößten Willensanstrengung versuchte ich, mich millimeterweise dem Telefon zu nähern. Immer noch hoffte ich auf McMurphy, meinen liebsten Kollegen. Er ist mehr als nur Kollege. Wir sind fast Nachbarn. Vielleicht auch Freunde. Warum er nicht einfach den Ersatzschlüssel holte und zu mir kam. Doch keine Spur, kein Geräusch von McMurphy.
* * *
Formulierungen für eine Todesanzeige, die mir durch den Kopf gingen. Wie könnte eine solche Todesanzeige lauten: Wir Kollegen / Studenten trauern um unseren geliebten Dozenten ... Er verstarb völlig unerwartet / viel zu früh ... In kurzen, behutsamen Sätzen geschrieben, in einer stillen Ecke der Zeitung veröffentlicht. Die Schrift einfach und zurückhaltend. Eine Geste an die Kollegen und an die ganze Universität. Wenigstens das. Wie klein die Todesanzeige auch sein mag. Er verstarb völlig unerwartet / viel zu früh ... Mit Verlaub gefragt: Welcher Tod käme nicht zu früh? Welcher Tod könnte von sich behaupten, gerade zum rechten Zeitpunkt zu kommen, auf die Minute pünktlich? Dies nur nebenbei.
* * *
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war Frau Wenturis am Telefon. Sie sprach ohne Umschweife auf den Anrufbeantworter: Ob ich zu Beginn des Sommersemesters für einen Vortrag zur Verfügung stehen würde, ein literarisch-akademischer Vortrag über die Dichter und Denker unserer Stadt. Sie zählte einige Dichter und Denker auf und fragte mit großer stimmlicher Deutlichkeit, fast so, wie meine Kollegen mich fragen würden: »Haben Sie Lust? Haben Sie Zeit?« Sie sprach mich mit dem Professorentitel an, obgleich ich strenggenommen – gar nicht Professor bin. Ich glaube, ich hörte auch das Wort Überfall. Damit leitete sie ihre Frage ein: »Herr Professor, verzeihen Sie die Störung, aber ich habe einen Überfall auf Sie vor.« Wie gut ich dieses Wort kenne. Wer immer ein solches Wort in den Mund nimmt, er möchte mit der nackten Wahrheit eines solchen Wortes herunterspielen, dass es sich in der Tat um einen Überfall handelt.
Sie machte eine kurze Pause, so als gewährte sie mir Bedenkzeit, dann hinterließ sie ihre Nummer. Einige Stunden lang blieb das Telefon still. In einem entfernten Garten hörte ich einen Rasenmäher. Später saß ich für einen kurzen Augenblick aufrecht. In Reichweite des Schreibtisches. Dann lag ich wieder. Mein Gesicht blieb zum Schreibtisch geneigt. Auf einem Blatt Papier entdeckte ich einige Satzfragmente: Manche werden posthum geboren. Oder: Nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen. Für einen Moment war ich ohne Raum und Zeit. An meinem Schreibtisch fand ich mich wieder, über die Seminararbeiten meiner Studenten gebeugt, in rasenden Korrekturen ihrer Arbeiten, die ich mit euphorischen Randbemerkungen umrankte: Hervorragend! Famos! Brillant! Ich schrieb mit meinem Grünstift; der Rotstift war unauffindbar. Ich strich nicht durch, ich strich nicht an. Ich korrigierte nicht, sondern bestätigte, untermauerte, unterstützte, nahm einzelne Sätze an die Hand, führte sie zu einem guten Ende. Jede Arbeit ein Happy End. Niemals korrigierte ich so schnell, so bestimmt, so begeistert, an einem einzigen Nachmittag.
Zwischendurch kamen einige Faxe, die ich nebenbei bearbeitete – gefolgt von einem weiteren Anruf Frederike Tarnarts: Ob es mir nicht gut gehe? Und sie fügte hinzu, als wäre es nun eine Gewissheit. »Ich ... Ich hatte ja keine Ahnung«, sagte sie (ihre Stimme wirkte verlegen), »dass es dir nicht gut geht. Wie konnte ich das wissen?« Sie war ernsthaft betroffen, fragte in den kleinsten Worten: Und? Wie? Wann? Sie habe der Sekretärin des Seminardirektors Bescheid gegeben. Frederike Tarnart sprach von Genesung. Bis zum Beginn des Sommersemesters sei es noch einige Zeit hin. Sie sprach allen Ernstes von Genesung. Behutsam legte sie den Hörer auf. Sie legte den Hörer auf, so als trippelte sie auf Zehenspitzen aus meinem Zimmer mit der Botschaft an die draußen Wartenden: Er schläft jetzt. Er hat Fieber. Er ist auf dem Weg der Besserung. Sie behandelte meinen Zustand wie eine Temperatur, eine vorbeiziehende Grippe. Typisch Frederike.
* * *
Am nächsten Tag überschlugen sich die Anrufe: die Universität, eine Studentin und erneut Frau Wenturis aus Berlin. Mit überschwänglicher Stimme rief sie meinen Namen. Ich hatte das Telefon abgenommen. Mit einem plötzlichen Ruck hatte ich das Telefon abgenommen. Sie wirkte hierüber fast verwirrt, sprach mit einem leicht ungläubigen Ton: »Sie haben das Telefon abgenommen. Sie haben wirklich das Telefon abgenommen.« Sie fragte mich, wie es mir gehe. Ich antwortete: »Danke, besser.« Auch sie sprach von einer vorbeiziehenden Erkältung. Ihre Ahnungslosigkeit betörte mich. Als ob das Leben unter allen Umständen weiterginge, in welchem Zustand auch immer, dank ihrer liebenswerten Ahnungslosigkeit, dank ihrer Anfrage. Sie erklärte mir, dass sie von Berlin aus telefoniere. Sie leite dort einen Literaturzirkel. Es werden in diesem Zirkel Bücher gelesen ... Sie fügte hinzu: nicht einfach nur gelesen, sondern regelrecht analysiert und interpretiert. Kaum anders, als man das an einer Universität machen würde, mit richtigen Referaten und Hausarbeiten. »Sie kennen das ja, Herr Professor.« Wie jedes Jahr plane dieser Lese- und Literaturzirkel eine Studienfahrt an die Örtlichkeiten der in diesem Zirkel behandelten Dichter und Denker. Ob ich für einen Vortrag zur Verfügung stehen würde. Sie vermied das Wort Stadtführung, doch letztendlich wollte sie eine Art akademische Stadtführung. Eine Art wandelnde Vorlesung. Ob ich zur Verfügung stünde? Für ein kleines Honorar. Ein akademischer Vortrag. Am besten unter freiem Himmel. Wegen der großartigen Kulisse. »Es wäre uns eine große Freude, Herr Professor.« Ein Vortrag über Dichter, Denker und Gelehrte. Im Hintergrund die Fassaden namhafter Dichterklausen. Sie listete einige Häuser auf, von denen ich noch nie gehört hatte, die ihr jedoch geeignet erschienen, und sie nannte mir Termine.
Unter anderen Umständen hätte ich ihr höflich abgesagt,
aus zahllosen guten Gründen: Meine Vorlesung, mündliche Prüfungen und andere Termine. Vor allem aber: Warum sollte ich einen solchen Vortrag überhaupt halten? Unter freiem Himmel. Als touristische Darbietung für Busreisende. Eine Form akademischer Folklore. Man sah uns bereits als aussterbende Spezies, als ein Relikt einer Welt, die schon längst im Sinken war, die nur noch scheinbar, in überzeichneten Fassaden bestand ...
Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte ich den Hörer aufgelegt oder abgesagt. Doch ich sprach nun anders: Warum nicht? Das Schlimmste ist bereits überstanden. Selbst diesen Irrsinn werde ich noch überstehen. Gerne stehe ich Ihnen für einen Vortrag zur Verfügung. Wenn es nicht stört, dass ich noch nie in meinem Leben einen Vortrag unter freiem Himmel gehalten habe ... Frau Wenturis antwortete: »Nein, das stört überhaupt nicht.« Wenn überdies meine belegte Stimme nicht stört ... »Nein«, antwortete sie, »das stört nicht. Im Gegenteil. Sie haben eine wunderbare Stimme.« Sie verwies auf die Stimme auf meinem Anrufbeantworter. Ich sagte ihr, die Stimme sei bereits mehrere Jahre alt. Ihre Antwort: »Das macht nichts.«
Später saß ich aufrecht und korrigierte weiter. Ich sah all die Klausuren und Hausarbeiten mit den Augen meiner wartenden Studenten – ein Volksfest sich überschlagender Glanznoten. Und auf dem Schreibtisch lagen Listen mit den Zwischennoten. Es gab kaum eine Note irgendeines Studenten ohne eine Eins vor dem Komma. Während ich korrigierte, erinnerte ich mich an die Stimme von Frau Wenturis, an ihren Berliner Akzent, der sich so wohltuend von den Akzenten meiner Umgebung abhob. Mitten in meine Randbemerkungen einer Klausur hinein hatte ich ihre Telefonnummer notiert. Ich hörte noch ihren Satz: »Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben.«
Natürlich hatte ich Fragen. Sie kamen mir immer deutlicher in den Sinn: Über welches Thema der Vortrag gehen sollte? Wie lange er dauern sollte? Welch eine absurde Frage: Wie lange er dauern soll? Eine fahrlässige Frage, beseelt von unnötiger Bereitschaft und Unterwürfigkeit. »So lange Sie wollen«, antwortete sie. »So lange Sie wollen. Eine Stunde, wenn Sie mögen auch zwei Stunden. Wir freuen uns schon.« Alles schien für sie schon beschlossen und geregelt zu sein, bis hin zu den Hotelzimmern, die sie für ihren literarischen Kreis gebucht hatte. »Wir freuen uns!«
* * *
Als ich zum ersten Mal wieder auf meine Terrasse trat, fragte ich mich: Warum das Sekretariat des Deutschen Seminars Frau Wenturis ausgerechnet zu mir und nicht zu einem anderen durchgestellt hatte. Weil meine Telefonnummer mit einer Null endet? Oder weil mein Büro in einem entlegenen Seitengang liegt. Oder weil sich kaum ein Student mehr in meine Vorlesungen verirrt.
Frau Wenturis sprach am Telefon von Studienerinnerungen, zum Beispiel ihre Erinnerungen an ihre Studienzeit in Freiburg. Oder sie erwähnte einen Bildband über unsere Stadt, in dem ein Professor in wehendem Talar abgebildet ist. Auf dem Bug eines Stocherkahns stehend. In der einen Hand ein Buch, in der anderen Hand den Stab des Stocherkahns. Denkerblick Richtung Altstadt. Sie betrachtete unsere Universität als Form von Folklore, kaum anders als die Folklore von Uhrenmachern und Schwarzwaldmädchen, die man in Museen zur Schau stellt. In derartigen Bildern malte sie sich den Vortrag aus: als touristische Vorführung – in einer Stadt, die ihrerseits kaum etwas anderes ist als eine touristische Vorführung. Eine Stadt akribischer Verzückungen, eine Disneywelt. An Unwirklichkeit kaum zu überbieten. Vielleicht sah sie mich bereits mit wehendem Talar ihr entgegenschreiten, zu meinem Vortrag ...
Ich stand vor dem Schrank und betrachtete meine Jacketts. Ich betrachtete sie nicht nur mit meinen eigenen Augen, sondern auch mit den Augen einer Berliner Reisegruppe. Was sie wohl zu dem weinroten Jackett sagen würden? Oder zu der marineblauen Jacke?
* * *
Nach Ansicht einer Studentenzeitung war meine Vorlesung eine der schlimmsten Vorlesungen der ganzen Universität, eine Vorlesung ohne Sinn und Ziel, ohne didaktischen Plan und erklärende Schaubilder – und wenn Schaubilder, dann waren die Schaubilder unansehnlich und kaum überzeugend. Konfus und haltlos, so schrieb die Studentenzeitung über die Vorlesung. Eine Vorlesung ohne Zug, ohne Prüfungsrelevanz, ohne Botschaft. In dem Artikel der Studentenzeitung war auch ein Foto von mir abgebildet. Es wirkte wie ein Fahndungsfoto. Es zeigte in unabweisbarer Deutlichkeit meine viel zu hohe Stirn, die mein Gesicht entstellte, nein, nicht entstellte, sondern geradezu entlarvte. Falls nach Lektüre dieses Artikels noch irgendwelche Zweifel an dessen Richtigkeit bestehen sollten, sie wurden endgültig entkräftet durch das beistehende Foto: der sichtbare Beweis für die Erbärmlichkeit meiner wöchentlichen Darbietungen.
Konfus und haltlos. Ich hatte die Studenten aufgefordert, haltlose Hypothesen zu denken. Oder Paradoxien. Etwa folgender Art: »Er hatte nichts zu sagen, aber er sagte es charmant.« Keine Antwort. Oder: »Der Kreter Epimenides behauptet, dass alle Leute von Kreta lügen.« Ob irgendjemand etwas zu diesem Satz sagen möchte? Bedächtiges Schweigen. Ratlose, zur Seite gehende Blicke. Die Blicke von Rekonvaleszenten. Ich fragte erneut: Ob sie nicht wenigstens einen haltlosen Gedanken denken könnten. Die Haltlosigkeit als Beginn allen wissenschaftlichen Denkens. Die Haltlosigkeit als Voraussetzung neuer Ideen. Nicht ein haltloser Gedanke kam ihnen in den Sinn.
Vielleicht dachten sie auch an meine Frisur: »Überdenken Sie lieber mal Ihre Frisur. Die ist in der Tat haltlos.«
Wie anders noch vor zehn Jahren. Damals waren die Vorlesungen nicht nur gut besucht, sondern zu einem gewissen Grad auch inspirierend – sowohl für mich als auch für die Studenten. Ich spürte in meinen Worten noch Wirkungen: in Form von Zustimmung oder Zwischenfragen oder Nachfragen. Ich fühlte mich auf der Höhe der Zeit, der Zeit sogar voraus. Noch jung. Promotion in Yale. Schüler von Harold Bloom und Geoffrey Hartman. Mit den neueren Literaturtheorien vertraut – Literaturtheorien, die über alle einfachen Fragen und Antworten erhaben erschienen. »Die Welt ist Text. Nichts steht hinter oder über ihr. Es gibt kein Entkommen, hier in diesem Sprachgefängnis.« Mit den Jahren verloren derartige Formulierungen an Durchschlagskraft. Sie gingen an den Köpfen der Studenten vorbei, liefen ins Leere, verpufften ungehört im Raum, ohne irgendwelche Reaktionen hervorzurufen. Nicht einmal Widerwillen oder Widerspruch. Oder wenigstens Fragen. Dabei las ich nichts anderes als in den Jahren davor. Es waren dieselben Worte, aber nicht mehr dieselben Studenten. Ich betrat den Vorlesungsraum und stürzte ins Nichts. Wie sehr ich die Vorlesung auch ab- und umänderte – es herrschte immer öfter Schweigen, zunächst betretenes, vielleicht sogar mitfühlendes Schweigen, in späteren Jahren feindseliges Schweigen.