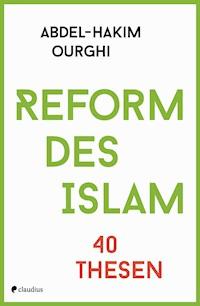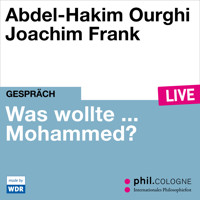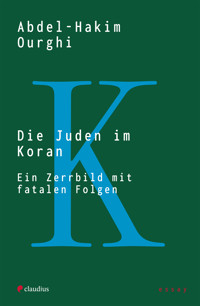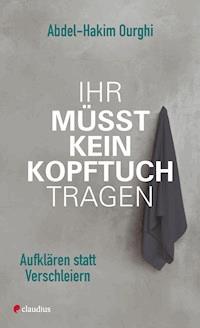
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Keine Religionsgemeinschaft hat so viel Angst vor der Selbstbestimmung der Frau wie der Islam. Zum Erhalt althergebrachter Machtstrukturen dient das Kopftuch. Es symbolisiert die Kontrolle der Muslima durch die Männer und führt längst zur Selbstkontrolle der Frauen. Aber ist das Kopftuch wirklich eine religiöse Vorschrift oder doch nur historisches Produkt des Patriarchats? Bei Claudius ist 2017 Ourghis viel beachtetes Debattenbuch "Reform des Islam" erschienen. Nun wendet sich der Autor an alle, die gute Argumente für eine klare Position zum Thema Kopftuch suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die zitierten Koranverse wurden übersetzt von Rudi Paret (Der Koran. Übersetzung, Stuttgart 112010), Hartmut Bobzin (Der Koran. Aus dem Arabischen neu übertragen, München 2010) sowie vom Autor selbst.
Für meine Mutter Zoulikha in dankbarer Verbundenheit.
Copyright © Claudius Verlag, München 2018
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –
nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
Coverfoto: © shutterstock/mrcmos
Layout: Mario Moths, Marl
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2018
ISBN 978-3-532-60032-0
INHALT
Cover
Titel
Impressum
1. Einleitung
2. Die öffentliche Sichtbarkeit der Unsichtbarkeit
3. Die Kunst der Macht: Herrscher und Beherrschte
Die Macht der männlichen Herrschaft
Scham und Erpressung: Die geraubte Kindheit
Überwachen als ständige Kontrolle
Die Isolation als Strafe
Das mauerlose Gefängnis
Die symbolische Gewalt
4. Das Ende des Kopftuchmythos als koranische Vorschrift
5. Aufklären statt Verschleiern
6. Die Sorge um sich selbst
7. Der Sieg der kritischen Vernunft
8. Ich bin ich, und ich kann nicht anders
9. Anmerkungen
1. Einleitung
In der Unmündigkeit gehorcht man in jedem Fall, sei es im privaten oder im öffentlichen Gebrauch, und folglich räsoniert man nicht.
Michel Foucault1
Die zehnjährige Mariam hat die Grundschule abgeschlossen und erzählt ihrer besten Schulfreundin Eveline am Ende der Sommerferien im September 2015, dass sie sich entschieden hat, ab dem neuen Schuljahr im Gymnasium das Kopftuch zu tragen. Ihre schiitischen Eltern stammen aus dem Irak, die Eltern von Eveline sind protestantische Pfarrer. Mariam ist das jüngste von vier Kindern, sie hat zwei Brüder und eine 19-jährige Schwester. Sie ist ein bildhübsches Mädchen mit lockigem Haar und einem unschuldigen, kindlichen Lächeln. „Meine Religion schreibt mir vor, ein Kopftuch zu tragen, und ich bin über meine Entscheidung glücklich“, erklärt sie ihrer Freundin. „Meine Eltern haben nichts dagegen, denn meine Mutter bedeckt auch ihr Haar. Nur meine älteste Schwester, die selbst kein Kopftuch trägt, warnt mich heimlich davor. Sie meint, dass ich von der Gesellschaft ausgeschlossen und keine Arbeit finden werde.“ Ergänzend teilt Mariam mir mit, dass alle ihre Freundinnen in der Moschee das Kopftuch tragen.
Die 25-jährige sunnitische Hanan erzählt mir in akzentfreiem algerischen Dialekt, dass sie mit sechs Jahren begann, ihren Vater zum Freitagsgebet in die arabische Moschee zu begleiten. Es machte ihr Spaß, dort mit den Jungs zu spielen. Ihre Eltern kamen zu Beginn der 1990er-Jahre wegen des algerischen Bürgerkriegs nach Karlsruhe, wo sie bis heute leben. Ihre Mutter war Geschichtslehrerin in Oran, das Kopftuch trägt die Mutter erst, seit sie hier in Deutschland ist. Jeden Samstag besuchte Hanan die Moschee, um Hocharabisch zu lernen. In dem nach Geschlechtern getrennten Unterricht trugen alle Mädchen Kopftuch, auch die Lehrerin. Als Hanan zwölf Jahre alt war, befahl ihr ihr Vater, ebenfalls das Kopftuch zu tragen. Sie leistete damals keinen Widerstand. Den Eltern darf man in der islamischen Kultur nicht widersprechen. Wenn es um Respekt und Gehorsam gegenüber den Eltern geht, so erinnert mich das an eine Stelle im Koran (Koran 17:23): Kinder sollen sich gegenüber den Eltern gut benehmen, heißt es dort. Man darf sie nicht anfahren oder tadeln, sondern sollte sich ihnen gegenüber ehrerbietig und gefügig verhalten. Nachts jedoch habe sie in den ersten zwei Jahren heimlich in ihrem Bett geweint, erzählt sie, denn sie wollte wie alle anderen Mädchen sein.
Ursula, eine Doktorandin der Ethnologie, ist konvertiert und heißt inzwischen Fatema. Sie ist mit einem Tunesier verheiratet. Felsenfest überzeugt von dem Verschleierungsgebot sagt sie mir: „Um Muslima zu werden, reicht es nicht aus, einen neuen muslimischen Namen zu wählen, auch das Tragen des Kopftuchs gehört dazu. Der Schleier ist doch eine islamische Vorschrift, die auch im Koran nachzulesen ist. Darüber hinaus demonstriert man seine religiöse Identität nach außen durch das Kopftuch.“ Ihre achtjährige Tochter Salma trägt bereits den Schleier, allerdings nur bei den Treffen der muslimischen Gemeinde. Sie konnte die Hänseleien ihrer Klassenkameraden bezüglich ihres Kopftuchs nicht mehr ertragen – einige Mitschüler hatten sie als „Turban-Tussi“ bezeichnet.
Vor elf Jahren konvertierte die protestantische Niederländerin Marjolein zum Islam. Heute lebt die 33-Jährige in Deutschland. Sie hat ihren Master im Fachbereich Sozialarbeit in den Niederlanden und in Freiburg abgeschlossen. Sie vertritt folgende Meinung: „Die Debatte um das Kopftuch in Deutschland regt mich sehr auf, und ich finde es inzwischen sinnlos, über ein Kleidungsstück zu diskutieren. Jeder soll anziehen, was er will. Wir Muslime führen auch keine öffentlichen Debatten über den Bikini oder die Kleidungsgewohnheiten der anderen. Wenn Nonnen ihr Ordensgewand an Schulen tragen, hat diese Kleidung eindeutig religiöse Hintergründe, aber keiner von uns spricht darüber. Das Kopftuch ist eine persönliche und private Sache. Ich trage es, weil ich überzeugt bin, dass es eine religiöse Pflicht ist. Genau wie bei meinem Gebet tue ich damit etwas für Gott. Die ersten zwei Jahre nach meiner Konversion habe ich kein Kopftuch getragen. Das hatte für mich keine Priorität. Außerdem musste ich meine Konversion vor meinen Eltern verheimlichen. Hätte ich eine Tochter, so sollte sie ab der Pubertät das Kopftuch tragen. Wenn sie das ablehnen würde, wäre es ihre Sache. Ich selber wurde jahrelang zum Kirchenbesuch gezwungen. Das bewirkte das Gegenteil. Pädagogisch gesehen war es nicht richtig.“
Im Vergleich zu Hanan und Mariam, die muslimisch sozialisiert aufwuchsen, haben sich Konvertitinnen wie Ursula und Marjolein oft aus freien Stücken und aufgrund einer Lebenskrise für den Islam entschieden. Sie suchen nach der Anerkennung der Angehörigen ihrer neuen Religion und möchten die Zugehörigkeit zur Gemeinde auch durch ihr Äußeres demonstrieren. Dennoch ist ihre Entscheidung für die Verschleierung2 nicht unbedingt eine freie Entscheidung, sondern mit der Angst verbunden, von der neuen Gemeinde nicht angenommen zu werden. Diese Frauen wissen genau, dass sie nur durch das Tragen des Kopftuches von anderen Muslimen ernstgenommen werden und sich nur so integrieren können. Diese Tatsache zeigt, dass Konvertitinnen aufgrund ihrer unbewussten Angst, nicht akzeptiert zu werden, zum Kopftuch greifen. Darüber hinaus kennen sie sich nicht mit der muslimischen Sozialisation in den Familien aus. Sie haben diese nicht selbst erlebt und können niemals verstehen, wie sehr der feste Glaube an den Islam ein essentieller Bestandteil in der elterlichen Erziehung ihrer Glaubensschwestern war. Sie mussten nie die durch Angst bestimmte Erziehung muslimischer Eltern erleben.
Aufschlussreich ist dabei die Anwendung der Prototypentheorie3, die die gemeinsamen Merkmale der befragten Mädchen und Frauen herausstellt. Im Rahmen dieser Kategorisierung verbindet die Frauen nicht nur ihr Äußeres, sondern auch ihre religiöse Überzeugung – obwohl sie alle in verschiedenen Kulturen leben. Sie alle sind der Überzeugung, dass die Körperbedeckung eine Basis des Muslima-Seins ist. Zum Zweiten scheint es auf den ersten Blick so, dass die Frauen sich jeweils in unterschiedlichem Alter freiwillig für die Verschleierung entschieden haben. Die Realität jedoch sieht anders aus. Prototypisch für diese Frauen ist, dass sie sich den Machtstrukturen ihrer Gemeinden angepasst haben, die durch die männliche Herrschaft gekennzeichnet sind. „Männliche Herrschaft“ bezeichnet hier die soziale Praxis, die anhand der religiösen Quellen (Koran und Sunna) legitimiert wird. Die Frauen haben sich die kulturellen Grundsätze der Mächtigen in den muslimischen Gemeinden zu eigen gemacht. Ihr Kopftuch soll nicht nur in der Gesellschaft deutlich sichtbar sein, sondern auch die eigenen Kinder sollen sich auf die männliche Herrschaft einstellen. Die Mädchen müssen durch Erziehung dazu gebracht werden, sich frühzeitig für das Kopftuch zu entscheiden. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild soll als kulturelle Symbolik unter dem Deckmantel des Religiösen für sich sprechen, die Mädchen sollen auch schnell erkennen, dass sie durch ihr Anderssein etwas Eigenes, Besonderes sind. Diese Art der erzieherischen Vorbereitung soll jegliches kritische Hinterfragen der gegebenen Strukturen unterbinden.
Die Auseinandersetzung mit der Kopftuchdebatte kann nicht abseits der Frage, ob der Islam zum Westen gehört, erörtert werden, denn der Islam mit seinen Anhängern gehört inzwischen auch zu Deutschland. Davon sind zumindest die hierzulande in einem säkularen und pluralistischen Land agierenden muslimischen Interessenverbände und ihre Anhänger überzeugt. Ein konstruktiver Dialog mit dem Islam setzt selbstverständlich die Anerkennung der Muslime und ihrer Religion als Teil der religiösen und sozialen Identität Deutschlands voraus. Fakt bleibt jedoch, dass auch im Westen eine islamische Identität im pluralistischen Sinn besteht, die durch innerislamische Differenzen geprägt wird. Genauer gesagt: Ein homogener Islam im Singular existiert nicht, sondern es handelt sich um einen heterogenen Islam im Plural. In dieser Situation erscheint die Frage legitim, welche Art von Islam zu Deutschland gehören soll.
Während viele Menschen in der Mehrheitsgesellschaft felsenfest davon überzeugt sind, dass die Muslime, nicht aber der Islam zu Deutschland gehören, vertreten zahlreiche andere inzwischen die Sichtweise, dass ein konservativ-politischer Islam verbunden mit einem Missionierungsauftrag gegenüber dem Westen und einer Re-Islamisierung der hierzulande geborenen muslimischen Kinder in unserem Land nichts zu suchen hat. Solch ein Islam ist in der Tat weder mit dem Grundgesetz noch mit dem demokratischen Rechtsstaat und den Menschenrechten vereinbar. Ein nicht reformierter Islam, der auf dem von Menschen erdachten Konstrukt der Scharia basiert, passt in keine freiheitliche und pluralistische Gesellschaft. So bleibt die Angst vor dem Islam zweifellos berechtigt, wenn man etwa an diejenigen Gemeinden denkt, die als eine Art Gegengesellschaft mit dem Rechtsstaat konkurrieren, oder an die Vorstellungen von konservativen Muslimen und Salafisten bezüglich einer „Islamisierung“ des Westens. Nur ein reformierter Islam kann zum Westen gehören, denn nur er lässt sich mit Werten wie Demokratie, Menschenrechten und Pluralismus vereinbaren. Gemeint ist also ein humanistischer Islam, dessen ethische Wurzeln in den muslimischen Quellen zu finden und mit dem historischen Diskurs des Islam verwoben sind. Berücksichtigt man die seit 1300 Jahren bestehenden engen Kontakte zwischen dem Abend- und dem Morgenland, gehört der Islam sicherlich nicht nur zu Deutschland, sondern zum gesamten Abendland. Trotz zahlreicher Kriege waren diese Begegnungen stets auch von einem kulturellen Austausch geprägt.
In der Realität erweist sich jedoch, dass der politische Islam eine gefährliche militante Ideologie ist, die die Herrschaft über die ganze Welt anstrebt. Konservative Muslime sind der Überzeugung, dass der Islam eine staatliche Ordnung ist, die einen Totalitäts- und Universalitätsanspruch auf die gesamte Menschheit erhebt. Radikale Muslime setzen diese Überzeugung durch Gewalt in die Tat um. Aufgeklärte Reformer vertreten hingegen die These, dass der Islam in seinen vielfältigen Auslegungen eine geistige Bewegung ist, die die Bindung des Individuums an Gott festigen will. Sie beinhaltet ein religiöses Angebot spiritueller Werte, die ein tiefes religiöses Leben ermöglichen und fördern. Entsprechend dieser Sichtweise gehört zum Westen nur der reformierte und aufgeklärte Islam auf der Basis einer reflektierenden, kritischen Vernunft. Ein Abrücken von dieser klaren Unterscheidung kann nur in Betracht ziehen, wer die Realität ignoriert.
Mit Nachdruck muss betont werden, dass ein Islam ohne Selbstkritik nicht zum Westen gehören kann und ein als Machtideologie verstandener Islam im Westen zum Scheitern verurteilt ist. Viele Muslime im Westen können es jedoch inzwischen nicht mehr ertragen, wenn der Islam und die Muslime kritisiert werden.
Es gibt keine wirkliche Selbst- und Islamkritik unter den Muslimen. Denn beide wären ihrem Wesen nach emanzipatorisch und herrschaftskritisch. Ihre Aufgabe bestünde darin, aktuelle, mit dem Islam in Verbindung gebrachte Diskussionen um die Themen Herrschaft, Unterdrückung und Verfolgung differenziert zu analysieren. Eine solche Kritik müsste sich aber auch mit den konservativen Muslimen, darunter den zum Teil erzkonservativen Islamverbänden, auseinandersetzen, deren Islamverständnis eher ein Hindernis für die Integration der hier lebenden Muslime darstellt. Durch das Wirken der muslimischen Dachverbände in der Öffentlichkeit etabliert sich bedauerlicherweise allmählich ein konservativer Islam in Deutschland, der die Moderne und ihre Grundsätze als Teufelswerkzeug verdammt4 und diese am liebsten islamisieren möchte. Im Auftrag ausländischer Regierungen wollen die konservativen Dachverbände die Deutungshoheit über den Islam und die Muslime an sich reißen. Sie tragen außerdem die Verantwortung dafür, dass der Islam in seiner pluralistischen Form in Deutschland einer modernen Renaissance und einer kritikfähigen Aufklärung hinterherhinkt, weil der Glaube ihrer Meinung zufolge eben keine Privatsache ist und jede Selbstreflexion unterbunden werden muss. Unterstützt von einer importierten Theologie mit veralteten Denkstrukturen beschlagnahmen sie die Freiheit des Individuums und lehnen die Fähigkeit zur kritischen Selbstüberprüfung ab. Wer in diesen Vorstößen einen konstruktiven Beitrag des humanistischen modernen Islam zur Selbstentdeckung bzw. Selbstdefinition der religiösen und sinnstiftenden Identität der Muslime sucht, wird schmerzlich enttäuscht werden. Die kritikfähige Auseinandersetzung mit der eigenen religiösen und historischen Identität bildet jedoch eine Voraussetzung für einen toleranten Umgang und ein Zusammenleben mit der nicht-muslimischen Mehrheit in einem interkulturellen Klima; denn das Ziel wäre ein lebendiges, alltagsorientiertes und dialogisches Lernen in der Begegnung der Muslime mit anderen.
Um zunächst einmal einen innerislamischen Dialog mit den Konservativen führen zu können, müssen die Wortführer der Verbände ihr intellektuelles Gefängnis verlassen. Es ist heute dringlicher denn je, die Positionen dieser vom Ausland gesteuerten politischen Organisationen im Lichte der deutschen Verfassung zu betrachten und die Mehrheitsgesellschaft aufzuklären. Darüber hinaus haben die Ereignisse der Ideengeschichte des Islam immer wieder gezeigt, dass der konservative Islam mit einer säkularen und pluralistischen Staatsordnung nicht vereinbar ist. Hilflose, überforderte Politiker und die Unwissenheit der Mehrheitsgesellschaft unterstützen die konservativen Muslime in ihrem Vorhaben, die angeblich ewigen und unanfechtbaren Wahrheiten und ihre eigenen scheinbar unaufhebbaren Überzeugungen zu etablieren.
Das Verfassen von kritisch-aufklärerischen Werken über den Islam, die Muslime und die islamische Ideengeschichte ist kein einfaches Unternehmen. Besonders selbstkritische Werke aus der Feder von Muslimen können heftige Wutausbrüche der muslimischen Gemeinde hervorrufen. Muslimische Kritiker sind in ihrem Alltag verbalen und schriftlichen Injurien ausgesetzt. Sie werden in den sozialen Medien verunglimpft und „takfirisiert“ (für ungläubig erklärt). Sie werden als Verräter an der Sache des Islam und den Interessen der Muslime gebrandmarkt. Gerne steckt man sie in die Schublade der Islamophoben und wirft ihnen vor, Antipathien gegenüber ihren eigenen Glaubensbrüdern zu haben. Was diesem Vorwurf entgegensteht, ist die sprachliche Vertrautheit der Islamaufklärer als Muttersprachler mit den kanonischen Quellen. Gerade deshalb kann diese Kritik historisch-kritisch fundiert und gut begründet sein. Gegner des liberalen Islam hingegen interessiert das wenig. Selten setzen diese sich intensiv mit Argumenten auseinander. Inzwischen scheuen einige Muslime nicht einmal mehr davor zurück, Drohbriefe per Post zu verschicken. Interessant erscheint, dass die Wortführer der muslimischen Dachverbände dies durchaus wissen, sich jedoch in Schweigen hüllen. Sie beherrschen einerseits meisterhaft die Opferrolle, andererseits setzen sie in der Öffentlichkeit auf „den Ton des Überlegenen, der zu fordern, nicht sehr zu geben hat. Und sie haben damit Erfolge“5. Die muslimischen Dachverbände inszenieren sich in der Opferrolle, denn sie wissen, dass diese die Einheit der muslimischen Religion in der Diaspora unterstützt und intensiviert. Gleichzeitig soll der selbst gewählte Opferstatus wohl nicht nur den Interessen der Gemeinschaft dienen, sondern auch das Mitleid der Mehrheitsgesellschaft auslösen. Die Mechanismen und Funktionen dieses Opferstatus müssen aufgedeckt werden. Nur so durchschaut man allmählich dieses Weltbild zwischen Sein und Schein: Sein, wenn es sich um die Durchsetzung der eigenen Interessen handelt, und Schein, wenn es darum geht, sich als Opfer darzustellen und keinen Beitrag für die Integration der hiesigen Muslime zu leisten.
Die muslimischen Islamreformer und Islamkritiker sind keine Feinde des Islam oder der Muslime, dennoch wird ihnen immer wieder Islamophobie vorgeworfen. Der Terminus „Islamophobie“ ist ein an die Psychologie angelehnter Begriff, der einen seelischen Zustand irrationaler Angst vor dem Anderen, in diesem Fall dem Islam, beschreiben soll. Eine Phobie ist klinisch ganz eindeutig als Krankheit umrissen. Die Zweckentfremdung dieser pathologischdiagnostischen Begrifflichkeit im Wort „Islamophobie“ sowie der inflationäre Gebrauch dieses Begriffs für muslimische Islamkritiker muss nicht nur als unangemessen und fachlich falsch gelten, sondern mehr noch als höchst bedenklich. Denn dieser Terminus führt zur Pathologisierung der Reformer und Aufklärer des Islam – sie werden als krankhaft gebrandmarkt.
Kritische muslimische Intellektuelle werden auch von der Mehrheit der Muslime als islamophob betrachtet. Inzwischen lässt sich sogar eine „Islamkritikphobie“ der Muslime im westlichen Kontext beobachten. Die muslimischen Apologeten pflegen akribisch die Opferkultur und verbitten sich anschließend mit Pathos jegliche Beanstandung. Das scheint zurzeit gleichsam im Trend zu liegen. Jede Kritik am Islam bzw. an den Muslimen wird als bedrohlich empfunden. Hierbei konkretisiert sich eine Verwechslung zwischen der Islamkritik als einer historisch-kritischen Reflexion einerseits und einem moralischen Ressentiment durch die Islamkritikphobie andererseits. Die Abneigung gegen eine Selbst- bzw. eine Islamkritik führt zwangsläufig zu Ausweichmanövern und verstärkt intensiv die Verdrängungsmechanismen gegenüber den dunklen Seiten der eigenen Geschichte – wie etwa der Gewalt in der Geschichte des Islam und der Unterdrückung der Frauen. Man möchte mit unangenehmen historischen und kulturellen Themen, die als Tabu gelten, nicht konfrontiert werden. Man möchte lieber in der eigenen Scheinwelt in althergebrachter und mustergültiger Weise leben. Der Islam soll demnach als zeitlos, vollendet und als Maßstab innerhalb seiner festgelegten Tradition gelten.
Bei der Kritik am Islam und an den Muslimen geht es muslimischen Islamkritikern hingegen nicht um private Animositäten, sondern ihr Beweggrund ist es, einen Aufklärungsprozess innerhalb des Islam in die Tat umzusetzen. Man muss immer wieder mit Nachdruck betonen, dass Selbstkritik und sachliche Kritik an der eigenen Religion mit Rassismus nicht gleichzusetzen sind, denn der Islam ist keine Rasse, sondern eine Religion. Die Islamkritik ist im Gegenteil eine essenzielle Grundlage für die Etablierung eines humanistischen Islam, denn das Ziel dieser Hinterfragung ist nicht die Diskriminierung oder die Stigmatisierung des Islam und der Muslime. Meine substanzielle Kritik am Islam ist nichts anderes als eine Liebeserklärung an die Muslime. Deshalb dürfen die Werte unseres Grundgesetzes, die die Freiheit des Individuums und des Wortes betonen, nicht gefährdet werden. Mir geht es in erster Linie um die Verwirklichung eines diskursiven und reformierbaren Islam in einem westlichen Kontext. Die wissenschaftliche und objektive Redlichkeit ist und bleibt das höchste Gut in unserer Kultur, nämlich der deutschen Kultur.
Die Mehrheit der hier lebenden Muslime ist – was eine ungehinderte Ausdehnung des konservativ-politischen Islam angeht – zu stillschweigenden Bündnispartnern der politischen Dachverbände geworden, und diese hüllen sich in Schweigen, wenn muslimische Islamkritiker bedroht werden. Der Gedanke könnte aufkommen, dass die Funktionäre der Dachverbände im Geheimen solche Drohungen und Einschüchterungen billigen, denn sie vertreten bedenkenlos den konservativen Islam und haben kein Interesse an Reformen. Inzwischen leben einige muslimische Islamkritiker in Deutschland unter Polizeischutz und die Mehrheitsgesellschaft reagiert darauf lediglich mit eisigem und beklommenem Schweigen. Zu dem Zirkel dieser „Anwälte des Schweigens“ gehören auch Politiker, die beim Thema Islam und dem Umgang mit Muslimen überfordert sind, sowie diejenigen Funktionäre der katholischen und der evangelischen Kirchen, die ständig auf einen einseitigen Dialog ausschließlich mit den konservativen Dachverbänden setzen. Ja, ihr Bemühen um den interreligiösen Dialog verdient Hochachtung. Merkwürdigerweise aber fehlt dabei der Mut, die Gefahren, denen reflektierende Freidenker und die Verfechter eines humanistischen Islams ausgesetzt sind, klar anzusprechen. Die „politische Korrektheit“ dominiert und man hat Angst vor der Reaktion der Muslime, die diese zeigen könnten, würden sie kritisiert. Man fürchtet, als islamfeindlich diffamiert zu werden. Es scheint, dass inzwischen einigen Politikern die Stimmen der muslimischen Wähler wichtiger sind als die Freiheit des Denkens und die Meinungsvielfalt.
Muslime im Westen müssen sich aber auch mit den unangenehmen Aspekten in den kanonischen Quellen auseinandersetzen, um das Klima für eine angemessene Interpretation des Islam zu schaffen. Tabuthemen, wie etwa die Gewalt im Namen des politischen Islam, die fehlende Religions- und Meinungsfreiheit oder die Knechtung der Frauen, können nicht länger ausgeklammert werden. Die Aspekte der männlichen Herrschaft6, die das Kopftuch als Symbol des politischen Islam mittels ausgefeilter Straftechniken durchsetzen will, müssen ebenfalls thematisiert werden. Der Islam in all seiner Vielfalt befindet sich aktuell ohne Zweifel in einer Sinnkrise. Eines der Symptome dieser kollektiven Sinnkrise besteht genau in dieser ungeklärten Frage, welche Stellung und Rolle die muslimische Frau in den hiesigen Gemeinden einnehmen soll. Die Verschleierung der muslimischen Mädchen und Frauen und die mit ihr verbundenen Aspekte der Repressionen, der seelischen und körperlichen Sanktionen sowie der Erniedrigungen und Verleumdungen müssen ohne falsche Rücksichtnahme debattiert werden. Es geht letztendlich bei der Verschleierung nicht nur um die Beherrschung des Geistes und Körpers der Frauen, sondern auch um die Steuerung ihrer Sexualität. Bei nicht verschleierten Mädchen und Frauen sollen Schuld- und Schamgefühle ausgelöst werden, und jeder Verstoß und jedes Aufbegehren gegen das Kopftuchgebot werden geahndet und sanktioniert. Außerhalb der muslimischen Familie und Gemeinde sind muslimische Mädchen und Frauen im Konsens der Muslime permanent Versuchungen ausgesetzt, deshalb kommen sie aus diesem Dilemma nicht heraus. Und so will die männliche Herrschaftsriege die Verschleierung als Selbstgeißelung durchsetzen.
Es ist eine zentrale Aufgabe, in einer Kultur des Dialoges über sich selbst und seine eigene Geschichte nachzudenken. Die Vernunft gebietet es, die aus der Vergangenheit stammenden archaischen Diskurse der islamischen Wissenstradition kritisch zu rezipieren und nötigenfalls abzulehnen,