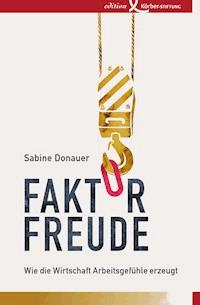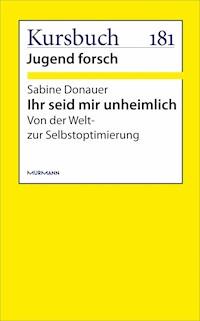
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sabine Donauer beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der Frage nach den Gefühlshaltungen der Arbeitnehmer zu ihrer Tätigkeit und wie sich diese in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. Wie stehen die jungen Berufseinsteiger heute zum Thema Arbeit? Donauer definiert drei Idealtypen: Die Allnighter, die Work-Live-Balance-Vertreter und die Engagierten, die aber prekär beschäftigt sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 22
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Sabine Donauer
Ihr seid mir unheimlich
Von der Welt- zur Selbstoptimierung
Ein heutiger Top-Performer meiner Generation entspricht in vielerlei Hinsicht dem, wie sich Großunternehmen vor knapp 100 Jahren den idealen Arbeitnehmer der Zukunft ausgemalt haben. Zu dieser Zeit standen die Arbeiter nämlich schon zwei Minuten vor Betriebsschluss vor dem Werkstor und arbeiteten nicht freiwillig unbezahlt in die Abendstunden hinein. Auch legten sie Deutschland mit massiven Streikwellen lahm, um den Acht-Stunden-Tag einzufordern. Mit dermaßen renitenten Arbeitern konfrontiert, konzipierte der Industriellenverband DINTA in der Weimarer Republik erstmals eine systematische Personalarbeit. Betriebliches Personalmanagement hatte in den 1920er-Jahren »die Aufgabe, eine lebendige, persönliche Beziehung zum Werk im Arbeiter zu wecken. Seine Arbeit soll für ihn selbst nicht nur Erfüllung vertraglich übernommener Verpflichtungen, sie soll nicht nur Ausübung der nötigen Handverrichtungen, sondern bewußtes Schaffen an einem Betriebsvorgange sein, dessen Sinn er begreift, dessen Erfolg er als seine eigene Sache erkennt.«1 Heute würde man neudeutsch sagen: Es ging den Unternehmern darum, den Arbeitnehmer an die Vision und Mission des Unternehmens glauben zu lassen. Er sollte in der Arbeit mehr sehen als nur einen Broterwerb.
Ein weiteres Zukunftsziel betraf die Frage, wie sich der Arbeiter selbst sah: Idealerweise sollte er sich nicht mehr dem streikenden Arbeiterblock zugehörig fühlen, der den »Kapitaleignern« feindlich gesinnt gegenüberstand und ständig die Verteilungsfrage stellte. Statt dieser »Kollektivexistenz« waren Arbeitnehmer gefragt, die sich als Individuum sahen, die sich mehr für ihr eigenes Fortkommen als für das ihrer sozialen Schicht interessierten und die daran glaubten, dass es für sie vorteilhafter war, sich dem Unternehmen partnerschaftlich verbunden zu fühlen statt in einer Konfrontation Tarif- und Sozialrechte einzufordern. In der Nachkriegszeit, als die Forderungen nach kollektiver Mitbestimmung in der Neuordnung der deutschen Wirtschaft besonders virulent wurden, formulierten die Personalmanager dieses Ziel wie folgt: »So umständlich und mühselig es auch erscheinen mag, wir müssen an den Einzelmenschen herankommen. Wir müssen ihn ansprechen im weitesten Sinne des Wortes. Wir müssen ihn tangieren und bewegen im besten Sinne des Wortes. Richtschnur des Verhaltens: Vom Einzelnen zum Einzelnen!«2 Eine Masse streikender, bummelnder und zu Sabotageakten geneigter Arbeiter zu mitziehenden und leidenschaftlich arbeitenden Einzelleistungsträgern zu machen, das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Jahrhundertaufgabe für die Personalarbeit der Unternehmen.
Bereits Max Weber bemerkte 1904 in seiner Protestantischen Ethik