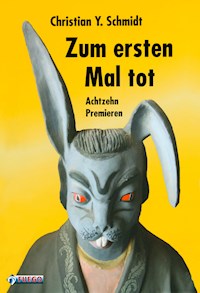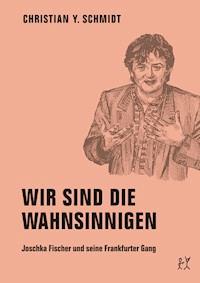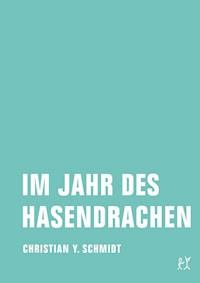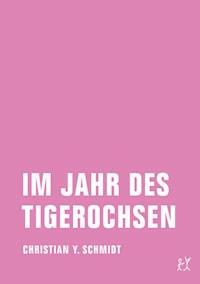
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Nach "Allein unter 1,3 Milliarden" und "Bliefe von dlüben" ist "Im Jahr des Tigerochsen" das dritte China-Buch von Christian Y. Schmidt. Zum größten Teil beruht es auf Kolumnen, die auf der "Wahrheit", der Satireseite der taz, erschienen sind. So geht es auch in diesem Buch ebenso komisch zu wie lehrreich. Der Autor legt Zeugnis davon ab, wie sich Seehofer in Peking zum Horst macht, begegnet chinesischen Multimillionären, deutschen Staatssekretären und dem Pekinger Fußballorakel. Zudem handelt das Buch von innovativer Scheiße, schlagenden Chinesinnen, nichtsaufenden Mongolen, chinesischen Anhängern der LOHAS-Religion, der Free Fickbildchen-Bewegung und Posern in Pekinger Freibädern. "Im Jahr des Tigerochsen" ist ein öffentliches China-Tagebuch der letzten beiden Jahre. Das ist auch der Grund, weshalb der Autor immer wieder aktuelle Vorgänge kommentiert. Dabei sieht Schmidt die Dinge meistens etwas anders als der Mainstream der deutschen Presse. Zu den gründlich überarbeiteten und erweiterten Kolumnen gibt es als Bonus Infokästen und einen gewichtigen Anhang, damit das Buch am Ende seriöser wirkt, als es tatsächlich ist. Für jeden China-Reisenden ein Muss, für jeden Sinologen ein Darf und für jeden anderen ein großes Solltehaben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
KOLUMNEN
INNOVATIVE SCHEISSE (1)DER DOPPELTOD OBAMAS (2)ES LEBE DER VORSITZENDE LOHAS! (3)DIE FRAUEN SCHLAGEN AUS (4)DOPPELT HÄLT BESSER (5)NACHRUF AUF EIN HAUS (6)MAO DARF NICHT FLIEGEN (7)LASST HUNDERT WACKELBLUMEN BLÜHEN! (8)EINGEHOLT VON MACKIE MESSER (9)DAS SANATORIUM DER KOHLENMINENARBEITER (10)DORO RETTET GOETHE (11)STREIKEN MIT AI WEIWEI (12)DRUCKT DIE FOTOS DER ERSCHLAGENEN HAN-CHINESEN (13)ANTIPOSING IN PEKINGS PRINZENBAD (14)MILLIONÄR WERDEN UND BLEIBEN! EIN RATGEBER (15)GRRR, GARGEL, ÄCHZ (16)DER ERSTAUNLICHE INNERE MONGOLE (17)RETTET DIE WÜSTE! (18)ORDOS MUSS NICHT SEIN (19)DURCHS TAL DER AHNUNGSLOSEN (20)DER MACKENREPORT (21)DEUTSCH-CHINESISCHE NAMENSVERWIRRNIS (22)SCHNELLER NACH OBEN! (23)ES GIBT REIS, BABY! (24)PROFESSOR LEGGEWIE, IHREN WAGEN BITTE! (25)DIE WELT IST KEINE GOOGLE (26)EIN LEIDLICH FALSCHES JAHR (27)SUSHI AUS SCHOKOLADE (28)DESIGNERMUSCHI ZEIGEN (29)BASTARDE UND RÄUDIGE HUNDE (30)SCHNÄPPCHEN IM WELTKRANKENHAUS (31)SCHLUSS MIT DER ETEPETETE-ZENSUR (32)SONNTAGS TELEFONIEREN (33)SEEHOFER MACHT SICH ZUM HORST (34)WER SCHLÄGT MIR AUF DEN KOPF? (35)VÖGELT DEN FRAUENTAUSCH-PROFESSOR FREI! (36)DAS FUSSBALLORAKEL VON PEKING (37)WELTMEISTER CHINA (38)OHNE ANMALEN UND AUSZIEHEN (39)SOMMERWUNSCH (40)FUNKELNDER FERNER OSTEN (41)EIN GROSSES PROBLEM (42)REISETHERAPIE (43)CHINESEN AM STRAND (44)LIU XIAOBO MUSS RAUS, ABER… (45)DER KOMMUNISMUS IST DA (46)BRUMM, BRUMM (47)KULTURREVOLUTION JETZT! (48)VIP-LAND CHINA (49)WIR WARTEN (NICHT) AUF DAS CHRISTKIND (50)BAIBAI, PARTY, BAIBAI (51)DAS KRITISCHE SCHAF (52)
ANHANG
Was bei den »Unruhen« im westchinesischen Xinjiang wirklich geschahTrendsport MauerspringenAuch bloß Propaganda?Wer China sagt, muss auch Deutschland sagen
Impressum und Copyright
CHRISTIAN Y. SCHMIDT
IMJAHR DES TIGEROCHSEN
Zwei chinesische Jahre
Well I’m gonna China to see for myself
Gonna China gonna China
Just got to give me some Rock ’n’ Roll
John Lennon: Meat City (1973)
Vorwort
Dieses kleine Buch ist, anders als mein letztes China-Buch »Bliefe von dlüben«, keine Einführung in die chinesische Welt. Es ist eine Chronik oder besser: ein öffentliches Tagebuch, in dem ich hauptsächlich von Ereignissen berichte, die sich in den beiden im Titel genannten Mondkalenderjahren abgespielt haben. Nach dem westlichen Kalender handelt es sich dabei um den Zeitraum von Ende Januar 2009 bis Anfang Februar 2011. Das heißt, dieses Buch folgt genau der Chronologie meiner China-Kolumne, so wie sie auf der Wahrheitseite der Berlinertageszeitungerschienen ist.
Auch der Inhalt dieser Kolumne wurde vom Lauf der Dinge in und um China herum diktiert. Nachdem im Dezember 2008 die letzte Folge der »Bliefe von dlüben«-Kolumne im Satiremagazin »Titanic« erschienen war, hatte ichmir vorgenommen, mich in der von nun an doppelt so häufig erscheinendentaz-Kolumne mehr vom aktuellen Geschehen leiten zu lassen. Das bedeutete, mich auch um die Kommentierung von wichtigen politischen Vorgängen nicht zu drücken. So habe ich den, von dem Künstler Ai Weiweiim Sommer 2009 ausgerufenen Internetstreik (Kapitel 12) genauso kommentiert wie das Auftreten der chinesischenDelegation auf der Weltklimakonferenz in Kopenhagen im Dezember desselben Jahres (Kapitel 25), das Pogrom einesuigurischen Mobs an Han-Chinesen im Westen Chinas(Kapitel 13) ebenso wie die Verleihung des Friedensnobelpreises an den Dissidenten Liu Xiaobo (Kapitel 14). Auchmindere Ereignisse habe ich nicht ausgelassen, so den bizarren Horst Seehofer-Besuch in Peking (Kapitel 34) oder die Auswirkungen der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika auf China und leider auch auf mich selbst (Kapitel37, 38).
Ich habe mich aber nicht nur an öffentlichen Ereignissen orientiert, sondern auch an meinem privaten Kalender. Das heißt: Ich habe nicht nur möglichst viel von meinem Pekinger Alltag verarbeitet, sondern auch meine Reisen durch China (Kapitel 7, 18, 19, 43, 44 und 46) und nach Deutschland (Kapitel 20, 21 und 22). Letzteres dachte ich mir zunächst als etwas größere Herausforderung, da die Texte immer einen Chinabezug behalten sollten. Es war dann aber recht einfach. Selbst in Deutschland ist China ja inzwischen allgegenwärtig.
Der Vorsatz, den Inhalt meiner Kolumnen vom Zeitgeschehen bestimmen zu lassen, hatte auch stilistische Folgen. Die »Wahrheit«-Seite dertaz,auf der die »Im Jahr des …«-Texte abgedruckt wurden und werden, ist eine Humor- und Satireseite. Auch deshalb waren meine Texte fürgewöhnlich in einem ironischen oder komischen Ton gehalten. Bei bestimmten Themen wie der Verleihung des Friedensnobelpreises an Liu Xiaobo oder dem Pogrom in Xinjiang war jedoch dieser Ton nicht angebracht. Alsowechselte ich hier zu einer verbindlicheren Sprache.
Dasgefielnicht jedem und stieß selbst innerhalb dertazauf Widerstand. Allerdings konnten sich die Stimmen nicht durchsetzen, die mich auf eine humoristische Tonlage und damit auf bestimmte Themen zwangsverpflichten wollten. Glücklicherweise ist es bei dertazauch heute noch weitgehend Konsens, dass auf der »Wahrheit«-Seite Meinungen vertreten werden können, die aus demtaz-üblichen Rahmen fallen. Eine solche Souveränität ist in der deutschen Presselandschaft nicht selbstverständlich und soll an dieser Stelle ausdrücklich gewürdigt sein.
Zusätzlich zur Freiheit, die mir von außen eingeräumt wurde, habe auch ich mich bisweilen freigemacht, unter anderem vom selbstauferlegten Aktualitätszwang. So finden sich in diesem Buch dann doch ein paar zeitlosere Kapitel, wie sie auch in »Bliefe von dlüben« hätten stehen können. Wichtig war und ist mir vor allem, dass meine Kolumne ein hohes Maß an Abwechslung bietet und dass das, was ich hier mitteile, nicht allzu erwartbar ist. Ob ich diesem Anspruch gerecht geworden bin, kann jetzt jeder anhand der hier versammelten Texte selbst überprüfen.
Meine Kolumnenfreiheit erlaubte es mir aber auch, immer wieder über chinesische Themen zu schreiben, die Redaktionen anderer Blätter für irrelevant hielten. Deshalb konnte ich manchmal schneller sein als andere Medien. So erfuhren die Leser dertazschon sehr viel früher einiges über die innermongolische Riesenstadt Ordos (Oktober 2009, Kapitel 19) als die vonSpiegel Online(Januar 2011). Von anderen chinesischen Phänomenen hat man – wenn ich mich nicht völlig irre – außerhalb meiner Kolumne in der deutschen Presse noch nicht viel gelesen: Von Lohas in China beispielsweise (Kapitel 3), dem irren Huazi-Turm in Fengjie (Kapitel 6), von Pekinger Fahrraddemos (Kapitel 39) oder dem Frauentauschprofessor Ma Yaohai (Kapitel 36). Oder von Xi Yang Yang, einer der populärsten Zeichentrickfiguren der Welt (Kapitel 52), die in Deutschland trotzdem keiner kennt.
Die Frage ist natürlich, ob solche aktuellen Texte auch der Zeit standhalten? Diese Frage stellt sich erst recht, wenn die Texte von China handeln, einem Land, das sich nahezu ununterbrochen in einem haarsträubenden Tempo verändert. Und tatsächlich sind ein paar Informationen in diesem Buch zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung bereits veraltet. Beispielsweise stimmt die Behauptung nicht mehr, dass sich chinesische Liebespaare in der Öffentlichkeit nicht küssen (Kapitel 4). Seit mindestens einem Jahr tun sie es und keiner weiß genau warum. Auch der Satz, dass chinesische Badegäste in der Waterworld im Qingnianhu-Park nicht auf meiner Lieblingstreppe herumposen (Kapitel 14), muss zurückgezogen werden. Genau an diesem Ort überraschten mich nämlich im letzten Sommer eine nicht geringe Zahl von Pekinger Hardcore-Posern. Auch dieser Paradigmenwechsel ist für mich im Moment noch nicht erklärbar. Und selbst die bereits erwähnte Stadt Ordos wird wohl auf einen heutigen Besucher nicht mehr den von mir beschriebenen geleckten Eindruck machen. Hier stürzte im Dezember 2010 ein für umgerechnet 150 Millionen US-Dollar innerhalb von sechs Monaten errichtetes Riesenstadion einfach ein, ohne dass jemand einen Grund dafür nennen konnte.
Obwohl also diese Beobachtungen und Behauptungen nicht mehr stimmen, habe ich sie dennoch in den jeweiligen Kapiteln belassen. Erstens: Weil ohne sie die ganze Pointenarchitektur dieser Texte zusammenbrechen würde. Und zweitens, weil die Texte ja auch Zeitdokumente sind, die Auskunft darüber geben sollen, wie ich China in den Jahren 2009 und 2010 sah. Nur einige Zahlenangaben habe ich stillschweigend aktualisiert, wie z.B die der chinesischen Internet-Nutzer. Ansonsten wurden fast alle Kolumnen stilistisch überarbeitet und um einige Passagen erweitert, die es wegen des begrenzten Kolumnenplatzes nicht in dietazgeschafft hatten. Zwei Kapitel (»Druckt die Fotos der erschlagenen Chinesen« und »Die Welt ist keine Google«) wurden im Anhang um zwei anderen Orts abgedruckte Texte ergänzt, weil mir hier meine Position besonders erläuterungsbedürftig erschien. Wem lediglich 3.000 Zeichen für einen Text zur Verfügung stehen, der kann oft nur verkürzt argumentieren. Und natürlich macht sich derjenige, der sich auf eine solche Verkürzung einlässt, angreifbar.
Nicht nur aus diesem Grund bin ich nicht sonderlich verwundert, dass ich für das, was ich in der Tigerochsenkolumne vertreten habe, teilweise etwas rüder kritisiert wurde. Ein solches Echo war auch deshalb erwartbar, weil ich ja selbst immer wieder als Kritiker auftrete, insbesondere, wenn es um die deutsche Chinaberichterstattung und -kommentierung geht. Glücklicherweise stehe ich mit dieser Kritik inzwischen nicht mehr allein da. Die 2010 erschienene wissenschaftliche Studie der Heinrich-Böll-Stiftung »Die China-Berichterstattung in den deutschen Medien« bestätigt im Großen und Ganzen das, was ich in meinen Kolumnen gelegentlich etwas überspitzter formuliere. So kann man in dieser Studie, die sich auf umfassendes empirisches Material aus dem Jahr 2008 stützt, nachlesen, dass praktisch alle deutschen Medien »deutliche blinde Flecken in der Themenagenda« haben, wenn es um China geht, dass viele von ihnen »extrem versimplifizierte(n) und verkürzende(n) Klischees« verbreiten und dass in ihrer Berichterstattung eine »auf Konflikte und Gewalt fokussierende Kernagenda« vorherrscht.
Das Resultat einer solchen Berichterstattung ist ein allzu simples bis falsches Chinabild in den Köpfen zwar nicht aller, aber doch vieler Deutscher. Dieses Bild spiegelte sich zuweilen auch in den Kommentaren zu einzelnen Tigerochsen-Kolumnen auf der Homepage dertazwieder. Hier machte man mir den Vorwurf, zu regierungsfreundlich bzw. generell zu prochinesisch zu sein: »Ich finde: ›China sucks‹«, erklärte jemand, »keinen Vertrag mit Menschenrechten.« Ein anderer schimpfte mich einen »Schmierfink« und ausgerechnet die bravetazein »Revolverblatt«, und noch einer erklärte meine Sicht der Dinge zur »Augenwischerei eines ehemaligen Maoisten«. Was man halt so schreibt, wenn man nicht Bescheid weiß, und dazu etwas Galle getankt hat.
Ich hatte allerdings heftigere Reaktionen erwartet, zum Beispiel anlässlich meiner Stellungnahme zur Verurteilung des Dissidenten Liu Xiaobo. Auf meiner Facebook-Seite wurde dieser Beitrag auch eifrig diskutiert, auf dertaz-Homepage gab es dagegen keinen einzigen Leserkommentar. Dass hier die Diskussion ausblieb, mag daran liegen, dass die Kolumne eben auf einer Satireseite erscheint, auf der man auch Ernstgemeintes nicht für voll nimmt. Andererseits gab es zu anderen, weniger kontroversen Beiträgen auch immer wieder ernsthafte Hinweise und Korrekturen vontaz-Lesern, die in sinologischen Fragen oft gebildeter sind als ich. Hin und wieder wurde die Kolumne auch gelobt, besonders von in China lebenden Deutschen und in Deutschland lebenden Chinesen. Gerade diese Reaktionen haben mich gefreut und dafür will ich mich an dieser Stelle endlich einmal bedanken.
Gefreut habe ich mich auch, dass mir zumindest einigetaz-Leser unterstellten, ich mache China und die chinesische Regierung absichtlich schlecht. Anlässlich der Kolumne »Reisetherapie«, in der ich beschreibe, wie man mir auf Reisen durch die Provinz Liaoning mehrmals ein Hotelzimmer verweigerte, weil ich ein Ausländer bin, glaubte zum Beispiel ein Kommentator, mich als antichinesischen Fälscher entlarven zu können: »Sind Sie sicher«, fragte er wohl die Redaktion, »dass Herr Schmidt sich das nicht ausgedacht hat?« (mehr auf Seite 122). Gefreut habe ich mich, weil dieser Kommentar ein vorzeigbares Indiz dafür ist, dass ich nicht der Propagandist der chinesischen Regierung bin, für die mich die Mitglieder der Galle-Fraktion halten.
Tatsächlich versuche ich das Land, in dem ich seit nunmehr über sechs Jahre lebe, möglichst unvoreingenommen zu beschreiben, und dabei vor allem seine komischen und unterhaltsamen Seiten zu zeigen. Ich bestreite aber keineswegs, dass es auch andere, weniger unterhaltsame Seiten gibt. Auf diese negativen Aspekte Chinas konzentrieren sich allerdings bereits eine ganze Reihe meiner Kollegen, die zudem für wesentlich einflussreichere Medien arbeiten. Deshalb denke ich, dass ich dieser Seite nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken muss. Würde allerdings kein deutscher Journalist aus China über Bergwerksunglücke, Umweltverschmutzung, Zensur und Menschenrechtsverletzungen berichten, wäre ich gewiss der erste, der sich dieser Themen annehmen würde.
Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich, je länger ich in China lebe, die Verhältnisse hier umso kritischer sehe. Der Demokratisierungsprozess, den die Regierung selbst versprochen hat, geht äußerst schleppend voran und erleidet immer wieder Rückschläge. Am schwersten sind wohldie wiederkehrenden Berichte über Behördenwillkür zuertragen, die übrigens auch in der chinesischen Presse zu finden sind. Wieso zum Beispiel der Künstler Ai Weiwei – ein Mann, den ich durchaus nicht so unkritisch sehe wie die Mehrheit der westlichen Presse; siehe Kapitel 12 »Streiken mit Ai Weiwei« – dabei behindert wurde, die Namen der beim Erdbeben 2008 in Sichuan umgekommenen Schulkinder zu sammeln und zu dokumentieren, ist mir unverständlich. Auch die Behinderung und Verfolgung von Petitionären und ihren Anwälten, Korruption und Vetternwirtschaft, rechtlose Arbeitsverhältnisse, die immer noch sehr hohe Zahl der Todesurteile oder übertriebene Zensurmaßnahmen trübten in den letzten Jahren zusehends mein Chinabild.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die chinesische Regierung einiges besser macht als die meisten Regierungen in der dritten Welt (siehe dazu: »Auch bloß Propaganda«, S. 167). Denn dass China bei 4.000 US-Dollar Jahreseinkommen pro Kopf immer noch ein Dritte-Welt-Land ist, darf bei seiner Beurteilung nicht vergessen werden. Trotzdem hat es das hiesige Regime geschafft, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dem Elend zu entreißen. Und das betrifft nicht nur die seit rund zehn Jahren immer wieder zitierte – und deshalb etwas zweifelhafte – Zahl von vierhundert Millionen Menschen, die inzwischen zur Mittelschicht gehören. Selbst viele der einst bitterarmen Bauern haben von der Entwicklung Chinas profitiert.
Dass der ökonomische Fortschritt auch großen Teilen der Bevölkerung zugute kommt, muss man noch nicht einmal denoffiziellenDarstellungen und Statistiken glauben. Man kann es sehen, wenn man, so wie ich, häufig im ganzen Land herumreist. Dabei bekommt man natürlich auch das eine oder andere architektonische Beispiel von Größenwahn, Fehlplanung und Verschwendungssucht zu Gesicht. Es überwiegen aber große Wohnungsbauvorhaben, der Bau von Schulen und Universitäten, Krankenhäusern, Kraftwerken, Eisenbahn- und U-Bahnnetzen, und das überall im Land, nicht nur im sowieso schon recht wohlhabenden Osten. Dazu werden inzwischen gewaltige Anstrengungen im Bereich des Umweltschutzes unternommen. Überall im Land entstehen Windkraftanlagen, in den Städten werden große Parks angelegt und landesweit sind die ersten Erfolge des größten Wiederaufforstungsprogramms in der Geschichte der Menschheit zu besichtigen (Kapitel 18: »Rettet die Wüste!«).
Keine Frage: Trotz dieser allenthalben sichtbaren und etlicher weiterer unsichtbarer Erfolge ist das chinesische Entwicklungsmodell weit davon entfernt, perfekt zu sein. Es wundert aber auch nicht, dass sich inzwischen andere Entwicklungsländer, die trotz (oder wegen?) westlicher Entwicklungshilfe in den letzten Jahrzehnten bei der Bekämpfung des eigenen Elends keinen Schritt vorangekommen sind, sich zusehends an dem chinesischen Modell orientieren.
Und noch etwas, bevor das Buch dann gleich wirklich durchstartet: Die chinesische Gesellschaft ist weitaus liberaler als man gemeinhin in Deutschland meint. Und das nicht nur, weil man in China im privaten Rahmen alles sagen kann, was man sich so zusammendenkt. Nein, selbst in der staatlichen Presse finden sich immer wieder kritische Artikel und Kommentare. Ansonsten würden ihre Journalisten wohl kaum gelegentlich mit den Zensurbehörden aneinander geraten oder bei investigativen Reportagen von der Polizei behindert werden. Auch Hochschullehrer und andere Intellektuelle äußern sich kontrovers und kritisch in der Öffentlichkeit. So lange sie nicht an bestimmte, wenige Tabus rühren, ist das problemlos möglich.
Das in der chinesischen Verfassung garantierte Recht auf freie Religionsausübung ist zwar immer noch deutlich eingeschränkt, vor allem für Anhänger von Sekten wie Falun Gong. Auch behält sich der Staat vor, religiöse Organisationen zuzulassen und zu kontrollieren sowie der Ernennung ihrer Würdenträger zuzustimmen. Aber sogar die illegalen »Hauskirchen« und die papsttreue katholische Untergrundkirche werden zusehends toleriert. Selbst das christliche Hilfswerk »Open Doors«, das jährlich einen »Christenverfolgungsindex« aufstellt, räumt ein, dass es in den letzten Jahren »bemerkenswerte Fortschritte hinsichtlich der Religionsfreiheit in China gegeben« hat. Dieselbe Organisation bescheinigt den chinesischen Christen übrigens auch, mehr religiöse Freiheiten zu haben, als beispielsweise ihre Glaubensbrüder und -schwestern in dem von vielen Westlern distanzlos bewunderten buddhistischen Himalajakönigreich Bhutan.
Die staatliche Kontrolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften hat allerdings auch zumindest einen positiven Aspekt: Ein wie auch immer gefärbter Gottesstaat hat momentan in keinem Teil Chinas eine Chance. Genauso ist es dem chinesischen Staat bisher gelungen, jede Form von ethnisch motivierter Verfolgung und Gewalt schon im Ansatz zu unterbinden (siehe »Was bei den ›Unruhen‹ im westchinesischen Xinjiang wirklich geschah«). Das heißt nicht, dass nicht auch unter der hiesigen Bevölkerungsmajorität der Han-Chinesen – sie machen etwa einundneunzig Prozent der in China lebenden Menschen aus – rassistische Einstellungen verbreitet sind. Trotzdem sind in China die Angehörigen der staatlich anerkannten fünfundfünfzig so genannten Minderheiten wesentlich besser geschützt als ethnische Minderheiten in manch einem anderen Teil der Welt. Sie können ihre Kultur praktizieren und ihre Sprache sprechen; in autonomen Regionen wie Xinjiang oder Tibet sind die jeweiligen Minderheitensprachen Amtssprache neben Mandarin. Es erscheinen Zeitungen in diesen Sprachen, und es gibt Fernsehsender, die sie ausschließlich verwenden. Auch in den Schulen werden sie gelehrt und die Beschilderung im öffentlichen Raum ist nahezu durchweg zwei-, wenn nicht dreisprachig.
In einigen Punkten – wie zum Beispiel bei der Zulassung zum Hochschulstudium – werden Angehörige von Minderheiten gegenüber Han-Chinesen sogar bevorzugt. Und da die Minderheiten nicht der Ein-Kind-Politik unterworfen sind, wachsen sie auch schneller als die Han. So stieg der Anteil dieser Ethnien an der Gesamtbevölkerung Chinas von 6,1 Prozent im Jahr 1953 auf 9,4 Prozent in 2005. Zwar ist es richtig, dass Angehörige von Minderheiten vielfach noch benachteiligt sind, wenn es um die Vergabe administrativer Posten und um Arbeitsplätze geht. Doch wer im Zusammenhang mit der heutigen Nationalitätenpolitik Chinas von »Endlösung« oder »Holocaust« spricht, wie wiederholt der Dalai Lama, oder von »Genozid« – wie der Dalai Lama, der türkische Premierminister Erdogan oder die uigurische Oppositionelle Rebiya Kadeer – dem kann es nur darum gehen, Gewalt zwischen den Ethnien zu schüren, um davon zu profitieren.
»China ist kein Reich des Bösen«, so lautet der Titel eines als Buch erschienenen Essays des langjährigen PekingerZeit-undtaz-Korrespondenten Georg Blume. Dieser Satz ist vollkommen richtig. Er bedeutet im Umkehrschluss natürlich nicht, dass China ein »Reich des Guten« ist. Man könnte sich aber vielleicht darauf einigen, es als ein »Reich des etwas Besseren« oder des »kleineren Übels« zu bezeichnen. Auch diese Einsicht habe ich versucht, in dem hier vorliegenden China-Tagebuch zu vermitteln. Offen bleibt, ob die chinesische Führung gewillt ist, das etwas Bessere noch weiter zu verbessern, oder ob im Land die bereits bestehenden Ungerechtigkeiten weiter zunehmen. Ich bin im Moment noch zuversichtlich, dass es weiter in die positive Richtung geht. Man kann aber auch mit genau der gleichen Berechtigung pessimistisch in die Zukunft blicken. Welcher Prognose man zuneigt, hängt wahrscheinlich nur am eigenen Naturell.
Zum Schluss noch ein Dank an alle, die dieses Buch möglich gemacht haben: Die Tageszeitung mit dem komischen Namen»die tageszeitung«,den man im Ausland immer umständlich erklären muss, hier insbesondere die Redaktion der »Wahrheit«, bestehend aus Corinna Stegemann, Michael Glückel und Michael Ringel, der Verbrecher Verlag und Jörg Sundermeier, die Redaktion der ZeitschriftKonkret,hier ganz besonders Marit Hofmann und Svenna Triebler, die Zentrale Intelligenz Agentur, die Redaktion der SendungPolitikumauf WDR 5, speziell Valentina Dobrosavljevic, Björn Blaschke und Morten Kansteiner, sowie meine Dolmetscherin, Übersetzerin und Ehefrau Gong Yingxin. Das Buch aber soll dem Andenken des zeitweiligen »Wahrheit«-Mitarbeiters Dieter Grönling gewidmet sein.
Christian Y. Schmidt, Peking, den 3. Februar 2011, am ersten Tag des Jahr des Hasen
KOLUMNEN
INNOVATIVE SCHEISSE (1)
Letzte Woche feierten wir hier in Peking den Beginn des Jahres des Ochsen. Das Jahr davor war das der Ratte, aber George W. Bush ist ja jetzt weg. Gut, der hatte letztlich nichts damit zu tun, denn die chinesischen Jahre heißen nach den zwölf chinesischen Tierkreiszeichen. Das des Ochsen steht dabei – wer hätte das gedacht – in erster Linie für harte Arbeit. Von diesem Ochsengeist war bereits in der Neujahrsshow des chinesischen Staatsfernsehens einiges zu bemerken. Dies ist die größte Fernsehshow der Welt, mit geschätzten 400 bis 500 Millionen Zuschauern, und die dort auftretenden Sängerinnen und Sänger mussten in diesem Jahr wirklich selber singen. Das schreibt ein neues chinesisches Gesetz vor, das im Juli 2008 vom Staatsrat beschlossen wurde, und das Vollplayblack bei öffentlichen Auftritten verbietet. Danach muss jeder professionelle Sänger hohe Geldstrafen zahlen und verliert im Wiederholungsfall seine Lizenz, sollte er das Publikum auf diese Weise betrügen. Bei der Neujahrsshow klangen deshalb manche Sängerinnen und Sänger auch nicht mehr ganz so gut wie noch im letzten Jahr.