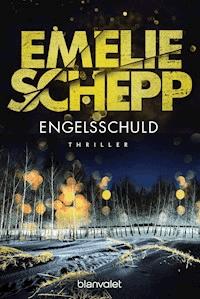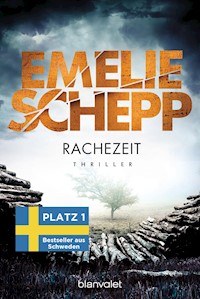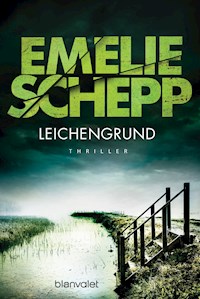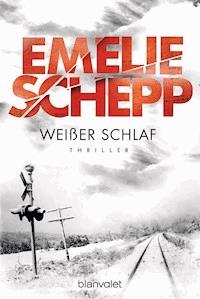9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jana Berzelius
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der neue Thriller von Emelie Schepp, Schwedens bester Spannungsautorin!
An einem warmen Sommerabend ruft ein sechsjähriger Junge seinen Papa an. Zutiefst verängstigt berichtet er, dass ein Mann ins Haus eingedrungen sei und Mama niedergeschlagen habe. Diese Worte sind die letzten, die Sam seinen Jungen sagen hört, bevor der Kleine spurlos verschwindet ... Die unnahbare Staatsanwältin Jana Berzelius leitet die Ermittlung. Doch je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr entgleitet ihr der Fall. Als die Entscheidung über Leben und Tod allein in Janas Händen liegt, beginnt ein Kampf gegen die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Ähnliche
Buch
Es ist der Albtraum eines jeden Vaters. Sam ist nur kurz zum Supermarkt gefahren, als ihn sein sechsjähriger Sohn Jonathan anruft. Völlig verängstigt erzählt dieser, dass ein Mann ins Haus eingedrungen sei und seine Mama niedergeschlagen habe. Diese Worte sind die letzten, die Sam seinen Jungen sagen hört, dann ist die Leitung tot. Als er nach Hause kommt, findet er seine Frau ermordet im Flur – Jonathan ist spurlos verschwunden ... Die unnahbare Staatsanwältin Jana Berzelius leitet die Ermittlungen. Doch je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr entgleitet ihr der Fall. Als die Entscheidung über Leben und Tod allein in Janas Händen liegt, beginnt ein Kampf gegen die Zeit.
Autorin
Emelie Schepp, geboren 1979, wuchs im schwedischen Motala auf. Sie arbeitete als Projektleiterin in der Werbung, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Nach einem preisgekrönten Theaterstück und zwei Drehbüchern verfasste sie ihren ersten Roman: Der zuerst nur im Selbstverlag erschienene Thriller »Nebelkind« wurde in Schweden ein Bestsellerphänomen und als Übersetzung in zahlreiche Länder verkauft. 2016 und 2017 wurde Schepp mit dem renommierten CrimeTime Specsaver’s Reader’s Choice Award ausgezeichnet und damit bereits zweimal zur besten Spannungsautorin Schwedens gekürt.
Von Emelie Schepp bereits erschienenNebelkind · Weißer Schlaf · Engelsschuld
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
EMELIE SCHEPP
Im Namen des Sohnes
THRILLER
Deutsch von Annika Krummacher
Für Lena und J-O
»Ich kann mich noch so gut erinnern.«
Der Mann blickte nach unten und lächelte kurz, als sähe er alles genau vor sich.
»Woran?«, fragte Henrik.
»Wie er geweint hat. Er hatte wohl Angst. Mir wäre es auch so gegangen, ganz allein unter dem Bett. Aber als ich ihn hochgenommen habe, ist er ganz still geworden. Ich werde nie vergessen, wie er mich mit seinen blauen Augen angesehen hat.«
»Da haben Sie ihn also mitgenommen?«
»Ja«, sagte der Mann und nickte. »Von diesem Moment an gehörte er mir.«
MONTAG
1
Es war vollkommen windstill, als Sam Witell seinen Arbeitsplatz bei der Ambulanten Wohnbetreuung in Norrköping verließ und sich auf den Weg zu seinem roten Toyota machte, der ganz hinten auf dem schattigen Parkplatz stand.
Nach dem langen Arbeitstag wollte er so schnell wie möglich nach Hause. Er freute sich darauf, Jonathan mit dem neuen Fußball zu überraschen, der in der Tüte auf der Rückbank lag. Jonathan liebte Fußball und stand dabei am liebsten im Tor. Sam lächelte, als er den Sechsjährigen vor sich sah, wie er sich auf den nächsten Torschuss vorbereitete, mit gebeugten Knien und Torwarthandschuhen, die an seinen kleinen Händen riesig aussahen.
Sam setzte sich in seinen Wagen und verließ die Innenstadt. Zehn Minuten später hatte er die neugebauten Einfamilienhäuser in Åselstad mit ihren Trampolinen, großzügigen Holzterrassen und sorgfältig geschnittenen Rasenflächen erreicht.
Sein weißes Haus lag auf einer Anhöhe mit Blick auf das funkelnde Wasser des Ensjön. Er bog in die Einfahrt, nahm die Tüte mit dem Fußball und stieg aus dem Auto. Summend begann er in Richtung Haus zu gehen, doch als er das Gartentor öffnete, hatte er plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden, und drehte sich um.
Ein Stück von ihm entfernt stand ein weißer Lieferwagen auf der Straße, an dem ein Mann lehnte. Er trug ein kurzärmliges Polohemd zu einer schwarzen Hose und starrte seltsam fragend herüber.
»Sind Sie Sam Witell?«, rief er.
»Ja«, sagte dieser zögernd.
»Ich müsste mal mit Ihnen sprechen.«
Der Mann begann auf ihn zuzugehen. Jetzt sah Sam, dass an der Seite des Lieferwagens in schwarzen Lettern Direktalarm stand.
»Tut mir leid«, erklärte Sam, während er durch das geöffnete Gartentor ging, »aber ich habe keine Zeit.«
»Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen«, sagte der Mann, der immer näher gekommen war.
»Nein, danke. Ich möchte Sie bitten, jetzt zu gehen.«
»Es dauert gar nicht lange. Ich wollte Sie nur fragen, ob …«
»Papa!«
Jonathan lief durch den Garten auf ihn zu.
»Hallo, mein Kleiner, wie geht’s?«, fragte er, hob den Jungen in die Höhe und strich ihm das helle Haar aus dem Gesicht, wodurch das Muttermal über der Augenbraue sichtbar wurde.
»Gut«, antwortete Jonathan und lächelte fröhlich.
Sam versuchte zurückzulächeln, aber die Anwesenheit des Mannes machte ihn nervös. Es lag an seiner Körpersprache, dem kurz geschorenen Haar, den muskulösen Armen und dem Stiernacken.
»Wer ist das?«, fragte Jonathan und zeigte auf den Mann.
»Ach, bloß ein Verkäufer«, antwortete Sam und spürte, wie er immer unruhiger wurde, als der Mann den Jungen so seltsam anschaute. Warum tat er das?
»Was hast du in der Tüte?«, fragte Jonathan, als Sam ihn wieder auf den Boden gestellt hatte. »Hast du was für mich gekauft?«
»Komm«, sagte Sam, packte seine Hand und begann in Richtung Haus zu gehen.
»Was hast du gekauft? Ist es ein Fußball? Es sieht aus wie ein Fußball!«
»Komm schon!«
Sam packte Jonathans Hand noch fester und ging rasch an den hohen Büschen und dem Schuppen vorbei, von dem die Farbe abblätterte. Beinahe wäre er über ein zusammengerolltes Tennisnetz gestolpert, fing sich aber wieder und legte das letzte Stück bis zur Haustür im Laufschritt zurück, mit der Tüte in der einen und Jonathan an der anderen Hand.
Atemlos betrat er das Haus, schloss die Tür von innen ab und ließ die Hand des Jungen los.
»Was ist denn, Papa?«
Sam antwortete nicht. Er sah nur durchs Fenster auf die Straße, in der Hoffnung, dass der Mann inzwischen weggefahren war.
Aber er stand immer noch da.
Staatsanwalt Per Åström war hochkonzentriert. Vor sich hatte er einen großen Bildschirm, auf dem er die Vernehmung mit Danilo Peña verfolgen konnte, ohne beim Gespräch selbst anwesend sein zu müssen. Peña saß still im Vernehmungsraum und starrte auf die Tischplatte. Die Ärmel des grünen Pullovers der Haftanstalt waren hochgeschoben.
Neben ihm saß sein Anwalt Peter Ramstedt. Seine Zähne sahen aus, als hätte er sie bleichen lassen, und er trug einen grellbunt gestreiften Schlips. Pausenlos spielte er an dem schwarzen Kugelschreiber herum, den er in der Hand hielt, und erzeugte dabei ein klickendes Geräusch.
»Es dürfte für Sie keine große Überraschung sein, dass Sie unter Mordverdacht stehen«, sagte Kriminalobermeisterin Mia Bolander, die zusammen mit Kriminalkommissar Henrik Levin gegenüber von Danilo Peña am Tisch saß. »Ich nehme an, das war der Grund, weshalb Sie nach Polen geflüchtet sind?«
Danilo Peña schwieg.
»Wie auch immer«, fuhr Mia Bolander fort. »Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Sie erhoben. Möchten Sie dazu vielleicht etwas sagen? Oder zu den jungen Drogenschmugglerinnen, die Sie umgebracht haben?«
Keine Antwort.
Sie schwieg eine Weile, ehe sie weitersprach.
»Los jetzt, reden Sie schon.«
Mia Bolander wartete erneut. Diesmal ein wenig länger. Währenddessen betrachtete Per das markante Kinn und die mahlenden Kiefer des Einunddreißigjährigen. Dann ließ er seinen Blick zu den dunklen Haaren wandern, die bis zum Ausschnitt des Pullovers reichten. Er musste daran denken, dass es nicht die geringste Spur von diesem Mann gegeben hatte, nachdem er vor einigen Monaten aus einem bewachten Zimmer im Vrinnevi-Krankenhaus geflohen war. Er hatte weder Pass noch Kreditkarte bei sich gehabt. Die Ermittler hatten keine Adresse, keine Familie oder Verwandtschaft ausfindig machen können. So als wäre Peña ein Geist.
Durch den Hinweis eines Passagiers erfuhr die Polizei, dass der Flüchtige sich auf einer Fähre nach Danzig befand. Die Polizei hatte in Polen auf ihn gewartet, aber es war Peña gelungen, unbemerkt an Land zu gehen. Nach ein paar Wochen intensiver Suche hatte man ihn schließlich gefasst.
Seit er nach Norrköping in die Untersuchungshaft gebracht worden war, hatte er kein Wort gesagt. Und jetzt hatte er offenbar auch nicht vor zu sprechen.
»Stellen Sie sich nicht dumm. Es ist besser, wenn Sie mit uns reden«, sagte Mia Bolander und rutschte unruhig auf dem Stuhl herum.
Allmählich reißt ihr der Geduldsfaden, dachte Per. Das war nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Ihr Ton war härter geworden, und sie sprach immer schneller. Vielleicht wäre es besser, wenn Henrik Levin die Vernehmung übernahm? Er machte stets einen ruhigen und vernünftigen Eindruck, und im Gegensatz zu seiner Kollegin wurde er nur an den entscheidenden Stellen laut.
»Okay«, sagte Mia Bolander seufzend. »Der Prozess beginnt in vier Wochen. Wir hoffen einfach, dass Sie bis dahin das Sprechen gelernt haben.«
Plötzlich öffnete Peña den Mund.
»Kontaktieren Sie Jana«, zischte er.
Per zuckte zusammen. Er war völlig unvorbereitet auf die dunkle, raue Stimme des Mannes. Levin und Bolander waren offenbar genauso erstaunt, denn es war völlig still im Vernehmungsraum.
»Wen?«, fragte Mia Bolander schließlich.
»Jana Berzelius«, erklärte Peña und starrte sie an.
»Wer ist Jana Berzelius?«, fragte sie.
Er grinste.
»Ich frage mich, wer von uns beiden sich hier gerade dumm stellt.«
Henrik Levin beugte sich über den Tisch.
»Warum möchten Sie Jana Berzelius treffen?«, fragte er.
»Kontaktieren Sie sie. In meinem Auftrag.«
»Warum?«, wiederholte Levin.
»Ich will sie sehen. Ein bisschen mit ihr reden.«
»Das ist unmöglich. Sie wissen, dass wir das nicht zulassen können.«
»Ich weiß. Aber mit Ihnen rede ich nicht.«
Per verfolgte, wie Peña den Stuhl zurückschob. Plötzlich drehte er sein Gesicht zur Kamera an der Decke, sah ihn direkt an und sagte:
»Alles ist möglich. Nicht wahr, Per Åström?«
Jana Berzelius saß barfuß auf einer Bank. Die Maske klebte an ihrem Gesicht. Sie ähnelte einer Sturmhaube, mit Löchern für die Augen und den Mund, und reichte bis über den Nacken.
Jana betrachtete ihre bandagierten Hände und lauschte auf die Stimmen der etwa zehn Personen, die sich in dem Raum befanden.
Sie selbst sagte kein Wort, da sie auf keinen Fall das Risiko eingehen wollte, ihre Identität preiszugeben. Genau deshalb war sie hier, in diesem illegalen Kampfclub. Hier war Anonymität eine Selbstverständlichkeit. Keines der Mitglieder nannte den eigenen Namen, niemand zeigte sein Gesicht. Sie kannten einander nicht, aber sie hatten alle dasselbe Bedürfnis.
Die Räume gehörten einem Umzugsunternehmen, doch jetzt hatten die Kartons, in Plastikfolie eingewickelten Möbel und Sackkarren vorübergehend einer quadratischen schwarzen Matte Platz gemacht. Wegen des unerwarteten Orts und der ungewohnten Tageszeit konnten Uneingeweihte sich kaum zusammenreimen, was in diesen Wänden geschah.
Jana hob die Hand und zog an der Maske. Sie wollte sich vergewissern, dass der Stoff den Nacken und insbesondere die in die Haut eingeritzten Buchstaben bedeckte. Seit sie neun war, hatte sie sich anhören müssen, dass sie keinem die Narben zeigen durfte. Niemand sollte erfahren, wofür sie standen. Niemand sollte wissen, wer sie oder, besser gesagt, was sie als Kind gewesen war.
Die Glocke ertönte.
Jetzt war sie an der Reihe.
Sie wollte sich gerade erheben, als sie ihren Gegner sah, der mit entschlossenen Schritten quer durch den Raum auf sie zukam. Er war groß, vermutlich Rechtshänder und trug dunkle Shorts und ein dunkles Muskelshirt.
Sie rief sich in Erinnerung, dass die Maske an ihrem Platz saß und dass sie sich keine Sorgen machen musste, dann ballte sie die Hände zu Fäusten.
»Bist du bereit?«, rief der Schiedsrichter.
Sie erhob sich, nickte ihm zu und betrat die Matte.
Sam Witell saß auf dem Sofa im Wohnzimmer mit dem Fußball hinter dem Rücken. Durch die riesigen Fenster waren das funkelnde Wasser des Ensjön, die marineblauen Gartenmöbel und der Schwarm von Kriebelmücken zu sehen, der über dem Rasen tänzelte.
»Okay, bist du bereit?«, fragte er und lächelte Jonathan an, der sich bemühte, neben ihm still zu sitzen.
»Ja«, sagte Jonathan erwartungsvoll.
»Ich glaube nicht. Darf ich dich mal ansehen?«
Sam blickte ihm in die kornblumenblauen Augen. Auf dem weißen T-Shirt waren viele kleine Flecken, und die Jeans hatten große Löcher an den Knien. Doch Jonathan bestand trotzdem darauf, immer diese Hose zu tragen.
»Ach, nein«, neckte Sam den Jungen. »Ich glaube nicht, dass du ein Geschenk von mir willst.«
»Papa, jetzt hör auf!«
Sam blickte auf, als er ein schweres Seufzen aus dem Flur hörte. Die Tür zur Toilette stand einen Spalt weit geöffnet, und ein schwaches Licht war auf dem Boden zu sehen. Felicia würde bald zu ihnen hereinkommen. Er wusste es. Er kannte ihre Gewohnheiten. Schon lange hatte er versucht, sich mit ihnen zu arrangieren, damit alles gut werden würde.
Das Sofa bebte, als Jonathan immer näher heranrückte, um zu sehen, was er hinter dem Rücken versteckte.
»Hör auf, nicht schauen!«
Sam versetzte ihm einen leichten Stups, und Jonathan fiel lachend hintenüber.
»Bitte, Papa, gib mir einfach den Fußball.«
»Wie kannst du wissen, dass ich dir einen Fußball gekauft habe?«
»Ich habe es doch gesehen, als du nach Hause gekommen bist. Er lag in der Tüte.«
»Okay, okay. Bist du jetzt bereit?«
»Ja!«
Sam lächelte, als er den rotgemusterten Ball aus der Tüte nahm.
»Tada!«
»Wow! Der ist total cool. Danke, Papa!«, sagte Jonathan und umarmte ihn fest. »Du bist der Beste auf der ganzen Welt.«
Irgendetwas schepperte in der Toilette, und nach einer Weile kam Felicia in Jogginghose und grauer Strickjacke heraus. Mit müden Bewegungen trat sie auf sie zu. Ihr Gesicht war blass und die Lippen trocken, und sie hatte dunkle Augenringe.
Sam zögerte, doch dann beugte er sich zu Jonathan und flüsterte: »Sag auch Danke schön zu Mama.«
Jonathan betrachtete Felicia, die an der Türöffnung stehen geblieben war. Sie fing seinen Blick auf und wich ihm dann aus. Als wäre es ihr nicht möglich, ihn länger anzusehen.
»Tu das bitte«, sagte Sam.
»Okay.«
Jonathan schluckte und stand vom Sofa auf.
In Sams Magen kribbelte es vor Angst, als Jonathan seine dünnen Arme um sie legte.
»Danke für den Fußball, Mama.«
Felicia erwiderte die Umarmung nicht, verzog keine Miene, sah Jonathan nicht einmal an, als er sie losließ.
Stattdessen hüllte sie sich enger in die Strickjacke.
»Jonathan?«, sagte Sam. »Komm, setz dich wieder zu mir.«
Der Junge nickte und kam zurück, sah vollkommen resigniert aus, als er den Fußball hochhob und ihn in den Händen wog.
»Spielen wir?«, fragte er und sah Sam bittend an. »Du kannst Elfmeterschießen mit mir üben, und ich versuche zu halten …«
»Es ist gleich sechs«, unterbrach Felicia sie mit ihrer monotonen Stimme. »Wir müssen essen.«
»Schon?«, fragte Sam.
»Es ist sechs«, wiederholte sie und verließ das Zimmer.
»Soll ich dir beim Kochen helfen?«, rief er, obwohl er wusste, dass die Frage sinnlos war.
Mia Bolander drückte rasch die Tür auf und ging zusammen mit Henrik aus dem Vernehmungsraum. Für heute hatte sie genug von der Arbeit. Stattdessen würde sie schnell nach Hause gehen, um sich fürs Abendessen mit Gustaf Silverschöld umzuziehen, ihrem neuen, reichen Freund.
Im Flur entdeckte sie Per Åström. In seinem Anzug sah er verdammt gut aus, das musste sie zugeben, obwohl er für ihren Geschmack ein bisschen zu groß und ein bisschen zu ehrgeizig war. Er war nicht nur ein erfolgreicher Staatsanwalt, sondern spielte auch Tennis und hatte gerade an der Vätternrundan teilgenommen, was offenbar das größte Amateurradrennen der Welt war. Dreihundert Kilometer auf dem Sattel, mitten in der Nacht. Wer so etwas machte, musste wirklich eine Schraube locker haben. Oder besser gesagt zwei, weil er anscheinend was mit seiner Kollegin Jana Berzelius am Laufen hatte, dieser arroganten Karriereschlampe.
»Dann hätten wir diese Vernehmung hinter uns«, sagte Per Åström, als sie auf ihn zukamen.
»Ich weiß nicht, ob ich das als Vernehmung bezeichnen würde«, erwiderte Mia genervt. »Danilo Peña hat ja nur gesagt, dass er mit Jana Berzelius sprechen will, sonst nichts. Warum nur?«
»Keine Ahnung«, sagte Henrik. »Aber er scheint die Spielregeln vorgeben zu wollen.«
»Was sollte er denn sonst tun?«, meinte eine Stimme hinter ihnen.
Sie drehten sich um und sahen Rechtsanwalt Peter Ramstedt auf sie zukommen.
»Vielleicht sollte Ihr Mandant stattdessen unsere Fragen beantworten?«, schlug Mia vor.
»Warum? Vielleicht belasten ihn Ihre Fragen ja psychisch«, entgegnete Ramstedt.
»Der Arme, er tut mir aufrichtig leid«, bemerkte Mia beißend.
»Insbesondere da er mit dem, dessen Sie ihn anklagen, nicht das Geringste zu tun hat«, konterte Ramstedt.
»Das behaupten Sie.«
»In der Tat«, sagte der Rechtsanwalt, »und ich freue mich wirklich auf den Prozess. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen dort zu begegnen, Åström«, fuhr er an den Staatsanwalt gewandt fort. »Oder werden Sie sich dann wieder in einem Nebenraum verschanzen? Das wäre vielleicht das Beste. Es besteht nämlich das Risiko, dass Ihre Verurteilungsrate sinkt, und es wird ganz schön peinlich für Sie sein, wenn mein Mandant freigesprochen wird. Wie war das noch, Ihre Rate liegt bei neunzig Prozent?«
»Es sind neunundneunzig Prozent. Informieren Sie sich bitte ordentlich«, erwiderte Åström. »Und Sie wissen sehr wohl, dass ich gut vorbereitet bin. Es steht außer Zweifel, dass Danilo Peña schuldig ist.«
»Sie denken also, dass Sie gewinnen werden?«, fragte der Rechtsanwalt.
»Es geht nicht um Gewinn oder Verlust – es geht darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt.«
Der Verteidiger grinste. »Wie viele Jahre sind Sie schon Staatsanwalt? Zehn?«
»Das stimmt.«
»Es tut mir aufrichtig leid«, sagte er und nickte seinem Gegenüber zu, ehe er sich umdrehte und davonging.
»Immer so bescheiden und freundlich, dieser Ramstedt«, murmelte Åström.
»Genauso bescheiden und freundlich wie Peña«, sagte Mia.
»Und wie werden Sie weiter vorgehen?«, erkundigte sich Henrik und sah den Staatsanwalt an.
»Inwiefern?«
»Werden Sie ein Treffen zwischen Jana Berzelius und Danilo Peña zulassen?«
»Nein«, antwortete Åström. »Natürlich nicht. Aber ich frage mich, warum er sich ausgerechnet mit ihr treffen möchte. Haben Sie eine Idee?«
»Nein«, sagte Mia.
»Ich auch nicht«, meinte Åström. »Aber ich werde es herausfinden.«
Der Gegner näherte sich mit erhobenen Fäusten. Jana Berzelius sah, wie er Anlauf nahm und sich duckte. Er schlug nach rechts und links, die Fäuste fegten durch die Luft, immer wieder an ihrem Gesicht vorbei. Er tänzelte vor und zurück und blieb in ständiger Bewegung auf der schwarzen Matte.
»Du willst mich verletzen, das sehe ich«, sagte er. »Glaubst du, dass du das kannst?«
Sie nickte knapp.
»Dann los!«
Er bewegte sich noch wilder. Es ist an der Zeit, dachte sie und ging direkt auf ihn zu, parierte seinen Schlag mit der Schulter und schlug ihm dann mit der Faust aufs Kinn.
Er sah erstaunt aus, hatte sich aber bald wieder gefasst und konterte mit einem brutalen und für sie überraschenden Rückhandschlag in ihren Bauch.
Jana hielt inne, verspürte aber keinen Schmerz, noch nicht. Dann ging alles sehr schnell. Mit voller Kraft stieß sie den Ellbogen in sein Gesicht, rasch und hart. Eine Bewegung, die sie instinktiv ausführen konnte.
Sein Kopf zuckte nach hinten.
Dann sank er auf die Knie und hielt seine bandagierten Hände unter die Nase.
»Scheiße!«, heulte er, als er das Blut auf den Boxbandagen sah.
Jana wurde bewusst, dass sie viel zu fest zugeschlagen hatte, und sie streckte ihm die Hand hin, aber er stieß sie zur Seite. Blut lief ihm über die Lippen, er hustete und spuckte.
Die Nase war gebrochen.
Sie hätte weitergemacht, aber ihr war klar, dass der Kampf vorbei war.
Also wandte sie ihm den Rücken zu, entspannte sich und wollte gerade die Bandagen lösen, als sie ein Brüllen hinter sich hörte. Sie konnte den Angriff nicht parieren, wurde vornüber geworfen und schlug mit dem Gesicht auf den Boden. Der Gegner war über ihr, prügelte mit rasender Wut auf sie ein, immer wieder. Sie wand sich, um ihn von ihrem Rücken abzuschütteln. Plötzlich spürte sie, wie die Maske am Nacken hochrutschte.
»Was ist denn das, verdammt«, hörte sie ihn sagen.
Panisch versuchte sie die Hand zu heben, um die Maske zurechtzuziehen, doch im nächsten Moment war ihr klar, dass es zu spät war. Der Gegner hatte die eingeritzten Buchstaben bereits gesehen.
Nein!, schrie sie im Stillen und wurde von einem fürchterlichen Zorn erfüllt.
Sie zog den Stoff wieder über den Nacken und bearbeitete den Oberschenkel ihres Gegners so heftig mit dem Ellbogen, dass er zu Boden ging. Es gelang ihr, sich zu befreien, und sie zwang ihn auf den Rücken, setzte sich rittlings auf ihn und schlug auf ihn ein, bis sein ganzer Körper bebte.
Sie hörte nicht die Rufe um sich herum, sie ignorierte den erschrockenen Blick ihres Gegners. Sie schlug einfach nur drauflos, ohne Hemmungen, damit er vergaß, was er gesehen hatte.
Irgendwann spürte sie, wie Hände nach ihren Armen griffen und an ihr zogen. Am Ende begriff sie, dass Widerstand zwecklos war, und ließ sich wegtragen, weg von ihrem Gegner.
»Was machst du da?«, schrie sie der Schiedsrichter an.
Sie antwortete nicht, sondern beobachtete die anderen, die sich um ihren Gegner versammelt hatten, der zusammengekrümmt dalag.
»Hast du sie nicht mehr alle? Du hättest ihn umbringen können!«
Jana stand auf, wandte ihnen den Rücken zu und verließ die Matte. Der Schiedsrichter rief ihr zu, sie solle zurückkommen, aber sie nahm nur ihre Tasche und verließ das Gebäude.
2
Die drei Gläser klirrten, als Sam Witell sie auf die glänzende weiße Tischplatte im Esszimmer stellte. Dann warf er einen Blick in die Küche, wo Felicia vor dem Kühlschrank stand.
Er drehte sich zu Jonathan um, der auf einem Stuhl saß und mit einer Serviette kämpfte.
»Wie läuft es?«, fragte er.
»Es geht nicht«, sagte der Junge. »Ich kann keinen Fächer falten!«
»Doch«, sagte Sam. »Probier es noch mal.«
»Kann ich nicht stattdessen Minecraft spielen?«
»Ich helfe dir.«
Sam setzte sich neben Jonathan, zeigte ihm, wie er es machen musste, aber faltete auch falsch, und beide begannen zu lachen.
»Was ist denn so witzig?«
Felicia war ins Esszimmer gekommen, ihre Stimme klang heiser und müde.
»Dass die Serviette nicht wie ein Fächer, sondern wie eine Kackwurst aussieht«, erklärte Sam, was Jonathan erneut zum Lachen brachte.
Sie blinzelte, aber mehr nicht.
»Wir haben keine Sahne mehr«, sagte sie. »Ich kann kein Geschnetzeltes ohne Sahne machen.«
»Schade, dass ich das auf dem Heimweg von der Arbeit nicht gewusst habe. Könnten wir stattdessen Milch nehmen? Oder was anderes kochen?«
Felicia seufzte tief und bebend.
»Okay«, sagte Sam. »Ich fahre los.«
»Darf ich mitkommen?«, fragte Jonathan, als Felicia aus dem Zimmer gegangen war.
»Nein«, sagte Sam und strich dem Jungen zärtlich das blonde Haar aus dem Gesicht.
»Warum denn nicht?«, fragte Jonathan enttäuscht.
»Weil es besser ist, wenn du die Servietten faltest, solange ich weg bin.«
»Warum soll ich sie eigentlich falten?«
»Um Mama eine Freude zu machen.«
»Aber Mama freut sich ja nie!«, rief Jonathan und warf die Servietten auf den Tisch.
Sam hob das Kinn des Kleinen. »Sag das nicht.« Die Angst erwachte in ihm, als er den traurigen Blick des Jungen sah.
»Aber es stimmt doch«, beharrte Jonathan und blinzelte, als wollte er die Tränen vertreiben.
»Mama freut sich«, entgegnete Sam mit einem kleinen Lächeln und schob dem Jungen die Serviette hin. »Sie zeigt es nur nicht so oft. Mama hat am liebsten ihre Ruhe. Das weißt du doch, das habe ich dir schon oft gesagt.«
»Ist das der Grund, warum sie nicht so gern kuschelt?«
»Soll ich dich in den Arm nehmen? Komm her, mein kleiner Racker, dann umarme ich dich ganz doll.«
Sam drückte den kleinen Körper eng an sich.
»Hilfe!«, rief Jonathan lachend.
»Selber schuld«, sagte Sam und nahm ihn noch fester in den Arm, ehe er ihn losließ. »Und jetzt falte die Servietten fertig, ich bin gleich wieder zurück.«
Henrik Levin fiel es schwer, nicht mehr an Danilo Peña zu denken. Trotz Bewachung war es dem Mann gelungen, aus dem Vrinnevi-Krankenhaus zu fliehen. Erinnerungsfetzen zogen vor seinem inneren Auge vorbei. Er dachte an die Krankenschwester und den Pfleger, die überfallen worden waren, an den zusammengeschlagenen Wachmann und an die blutigen Fingerabdrücke an den Türen.
Sie hatten überall nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Peña war untergetaucht, hatte sich irgendwo versteckt, ehe er die Fähre nach Danzig betreten hatte. Henrik war sich fast sicher, dass sie niemals erfahren würden, wo genau. Aber es war nicht wichtig, nicht mehr. Wichtig war jetzt nur, dass sie ihn gefasst hatten und er bald vor Gericht stehen würde.
Henrik griff nach dem Treppengeländer und legte die letzten Schritte in den dritten Stock des Polizeigebäudes zurück. Wenig später stand er an der Tür zum Büro des Ermittlungsleiters Gunnar Öhrn. Der Kriminalhauptkommissar stand mit dem Rücken zu ihm am Fenster und telefonierte. Lautlos betrat Henrik den Raum und betrachtete Gunnars verschwitztes Hemd und den faltigen Nacken.
»Aber du kannst doch nicht einfach voraussetzen, dass ich … Doch, ich weiß, dass Anwesenheitspflicht ist, aber … Nein, das habe ich nicht gesagt, du musst mal … Hallo? Verdammt!«
»Probleme?«, fragte Henrik, als Gunnar sich umdrehte.
»Ich habe gerade einen Elternabend aufgedrückt bekommen. Offenbar will der Fußballverein die Punktspiele von Adams Mannschaft durchsprechen, aber das eigentliche Problem ist nicht der Elternabend, sondern dass ich eben erst davon erfahren habe – eine halbe Stunde vor Beginn.«
Gunnar fuhr sich durchs graue Haar.
»Was auch immer du tust, Henrik«, sagte er, »trenn dich nicht von deiner Frau. Versprichst du mir das?«
Henrik nickte.
Die Trennung von Anneli Lindgren hatte Gunnar ziemlich mitgenommen. Obwohl er inzwischen mit Britt Dyberg zusammenlebte, wirkte er nicht ganz glücklich. Beide Frauen arbeiteten im selben Haus wie Gunnar, Anneli als Kriminaltechnikerin und Britt als Informationskoordinatorin, und Henrik dachte im Stillen, dass dies das eigentliche Problem war.
»Wo steckt Mia?«, fragte Gunnar und legte sein Handy auf den Schreibtisch.
»Sie musste nach Hause, ich glaube, sie wollte mit jemandem zum Abendessen ausgehen.«
»Aha. Na, dann lass mal hören, was du über Peña zu berichten hast.«
»Nicht viel Neues, außer dass er Jana Berzelius sehen will.«
»Hat er das gesagt? Dass er sie sehen will?«
»Ja.«
»Aber in diesem Fall führt doch Per Åström den Prozess, oder etwa nicht?«, fragte Gunnar.
»Genau«, sagte Henrik, »und wie du weißt, wurde Danilo Peña als besonders gefährlich eingestuft. Deshalb gilt die höchste Sicherheitsstufe. Åström entscheidet, mit wem Peña reden darf und mit wem nicht.«
»Aber warum will er Jana Berzelius treffen?«
»Er hat keinen Grund genannt.«
»Seltsam.«
Gunnar hatte recht, dachte Henrik. Es war wirklich seltsam, dass Peña ausgerechnet Jana Berzelius sehen wollte. Henrik und die anderen im Team hatten in mehreren komplizierten Fällen mit ihr zusammengearbeitet, und sie war eine sehr fähige Staatsanwältin, aber das erklärte kaum, warum Peña gerade mit ihr reden wollte.
»Und was sagt Åström dazu?«, fragte Gunnar. »Hat er irgendeine Erklärung, warum Peña darauf besteht, Jana Berzelius zu sehen?«
»Nein, aber er wollte es herausfinden.«
»Gut, dann schließen wir das Thema für heute ab. Fahr jetzt nach Hause zu deiner Familie.«
»Das mache ich«, sagte Henrik. »Ich freue mich auf heute Abend.«
»Ach ja? Was habt ihr denn vor?«
»Nichts. Und genau darauf freue ich mich.«
Jana Berzelius schloss die Wohnungstür hinter sich und genoss die Stille, die sie empfing. Sie ging ins Schlafzimmer, stellte die Sporttasche an ihren Platz im begehbaren Kleiderschrank und duschte anschließend. Nachdem sie eine langärmlige Bluse und eine schwarze Hose angezogen hatte, setzte sie sich an den aufgeräumten und blitzblanken Schreibtisch in ihrem Arbeitszimmer.
Während sie aus dem Fenster sah, ging sie in Gedanken den Boxkampf noch einmal durch. Sie dachte an ihren Gegner und daran, dass er ihren Nacken gesehen hatte.
Langsam strich sie mit den Fingern über die ungleichmäßige Haut unter dem feuchten Haar und spürte die drei Buchstaben, die sie immer daran erinnern würden, wer sie eigentlich war.
KER.
Die Göttin des Todes.
Als Kind hatte sie sich zusammen mit ihren Eltern und mehreren anderen Familien in einem Container versteckt. Sie waren auf dem Weg über den Atlantik gewesen, nach Schweden, wo sie sich ein neues, besseres Leben erträumten. Doch als das Schiff ankam und der Container geöffnet wurde, verwandelte sich der Traum in einen Albtraum. Draußen standen drei Männer mit Schusswaffen in der Hand und wählten einige der Kinder aus. Sie wurde nach draußen ins Licht geschleppt, weg von ihren Eltern. Es war das letzte Mal, dass Jana sie zu Gesicht bekam.
Die Männer hatten ihre Waffen direkt in den Container gerichtet. Nie würde sie das Knallen der Schüsse vergessen. Anschließend war der Container mit den Leichen auf dem Meeresgrund versenkt worden.
Sie selbst war in einen Lieferwagen geschubst worden. Dort hatte sie dicht an dicht mit den anderen sechs Kindern gesessen und ihrem Weinen gelauscht.
Sie waren zu einer Insel gebracht und zu Kindersoldaten ausgebildet worden. Zu Killern, deren einzige Aufgabe das Töten gewesen war.
Und sie hatten neue Namen bekommen. Namen, die in ihre Haut eingeritzt worden waren, um sie daran zu erinnern, wer sie von da an waren und für immer sein würden.
Jana hatte schon erwogen, die Narben in ihrem Nacken entfernen zu lassen, aber das würde nicht die Gewalt beseitigen, die sie in sich trug, und sie hatte gelernt, die Buchstaben ständig zu bedecken.
Es gab nur zwei Menschen, die von der Hautritzung wussten. Der eine war ihr Adoptivvater, Karl Berzelius. Allerdings bezweifelte sie, dass er wirklich noch eine Bedrohung für sie darstellte. Sein Name und sein Renommee als ehemaliger Reichsstaatsanwalt stünden auf dem Spiel, ganz zu schweigen von der Gefängnisstrafe, die ihm drohte, wenn die Wahrheit ans Tageslicht käme. Jana und die anderen Kinder waren zu Kindersoldaten ausgebildet worden, um illegale Machenschaften zu schützen, an deren Spitze Karl Berzelius selbst gestanden hatte.
Der andere, der davon wusste, war Danilo Peña. Er stellte noch immer eine Bedrohung für sie dar, denn auch in seinem Nacken stand ein Name: Hades. Der Gott des Todes.
Sie waren zur selben Insel gebracht worden, hatten Seite an Seite trainiert, und sie waren beinahe so etwas wie Geschwister geworden. Zusammen hatten sie beschlossen zu fliehen, doch sie hatten sich auf der Flucht aus den Augen verloren. Jana war einem Unfall zum Opfer gefallen, und als sie im Krankenhaus aufwachte, hatte sie keine Ahnung, wer sie war oder woher sie kam. Doch in ihren Träumen drängten die Erinnerungsbilder allmählich empor. Später hatte sie ihren Adoptiveltern, Karl und Margaretha Berzelius, von ihren Erlebnissen erzählt, von ihren entsetzlich realistischen Albträumen.
Karl war der Einzige, der wusste, dass ihre Träume auf tatsächlichen Erlebnissen beruhten, aber um sich selbst und seine kriminellen Machenschaften zu schützen, hatte er ihr befohlen, nie wieder davon zu sprechen.
Daher hatte sie begonnen, alles niederzuschreiben.
Im Lauf der Jahre hatte sie ein Tagebuch nach dem anderen gefüllt. Sie hatte versucht zu begreifen, wer sie gewesen war, bevor sie adoptiert wurde, doch sie war zu keinem Ergebnis gekommen. Erst im Erwachsenenalter war es ihr gelungen, Danilo aufzuspüren. Er hatte ihr mehr Antworten gegeben, als sie eigentlich hören wollte. Er wusste auch, wofür die Namen in ihren Nacken standen.
Doch sie wollte nichts mehr von ihm wissen. Sie teilten dieselbe blutige Vergangenheit, mehr nicht, und sie war bereit, alles zu tun, damit diese Vergangenheit im Verborgenen blieb.
Das Wissen, dass es jetzt einen fremden Mann gab, der die Buchstaben gesehen hatte, nagte an ihr. Niemand durfte sie sehen. Niemand! Sie hatte kämpfen und der Gewalt, die sie in sich trug, freien Lauf lassen wollen, aber jetzt war ihr klar, dass es ein großer Fehler gewesen war, in diesen illegalen Kampfclub zu gehen.
Zwar hatte ihr Gegner keine Ahnung, wer sie war, und vielleicht würde er auch niemals herausfinden wollen, was die Buchstaben in ihrem Nacken bedeuteten. Aber sicher konnte sie sich nicht sein. Konnte sie mit der Ungewissheit leben?
Ihre Gedanken wurden von eifrigem Klopfen unterbrochen.
Sie verließ ihr Arbeitszimmer, ging zur Wohnungstür, warf einen Blick durch den Spion und lächelte.
Nur ein Kunde stand vor ihm im ICA-Supermarkt. Sam Witell legte die Kochsahne aufs Band, zog seine Kreditkarte aus der Hosentasche und wartete, bis er an der Reihe war. Als sein Handy klingelte, antwortete er sofort.
»Hallo, Papa«, sagte Jonathan.
»Hallo, mein Schatz«, antwortete Sam und nickte der Kassiererin zu.
»Papa?«
»Ja?«
»Was machst du gerade?«
»Ich kaufe Sahne ein.«
»Noch immer?«
»Ich bin bald zurück. Was machst du?«
»Ich spiele ein Videospiel. Aber … oh nein!«
»Wolltest du nicht Servietten falten?«, fragte Sam und schob die Kreditkarte in den Kartenleser.
»Ich bin schon fertig«, antwortete Jonathan.
»Also bist du nach oben ins Fernsehzimmer gegangen?«
»Ja.«
»Und was macht Mama?«
»Weiß nicht. Jetzt stirb schon, du Scheißzombie!«
»Okay«, sagte Sam, »ich muss jetzt auflegen, damit ich mich aufs Bezahlen konzentrieren kann.«
»Ich dachte, du wärst schon zu Hause.«
»Wie kommst du darauf?«
»Weil ich ein Auto gehört habe.«
»Ach, wirklich?«
Sam runzelte die Stirn. Vielleicht hatte sich jemand verfahren und wollte in ihrer Einfahrt wenden.
Aber dann hörte er durchs Telefon die Türklingel.
»Es läutet an der Tür, Jonathan«, sagte Sam, während er den PIN-Code seiner Kreditkarte eintippte.
»Ja … Los, jetzt stirb einfach!«
Jonathan war von seinem Spiel vollkommen absorbiert.
»Gehst du nicht zur Tür und öffnest?«, fragte Sam. Er nahm den Kassenzettel in Empfang und verließ den Kassenbereich mit der Sahne in der Hand.
»Nein. Das macht Mama.«
»Hör mal zu, du kleiner Faulpelz.«
»Was ist denn? Ich spiele doch.«
Sam zuckte zusammen, als ein lauter, aber gedämpfter Schrei zu hören war. Er sah sich verwirrt um und suchte mit dem Blick das Geschäft ab, ehe er begriff, dass das Geräusch aus dem Telefon kam.
»Was ist da los, Jonathan?«, fragte er. »Hallo? Jonathan? Was ist los?«
»Papa …« Die Stimme des Jungen zitterte. »Papa, da ist jemand in unserem Haus.«
»Wie bitte?« Sam gefror das Blut in den Adern. »Wer denn?«
»Mama ist …«
»Was ist mit Mama?«, fragte Sam und ging schnell zum Parkplatz. »Jonathan?«
»Mama?«, hörte er Jonathan rufen.
Die Stimme des Jungen zitterte noch mehr.
»Sie antwortet nicht«, sagte Jonathan. »Sie liegt einfach nur auf dem Fußboden.«
»Sie liegt auf dem Fußboden? Wo denn?«
»In der Diele. Er hat sie geschlagen.«
»Was sagst du?«, rief Sam. »Jemand hat Mama geschlagen? Wer denn? Wer war das?«
Er riss die Autotür auf und warf die Sahnepackung auf den Beifahrersitz.
»Ich weiß es nicht. Ich trau mich nicht runterzugehen. Ich habe nur gesehen, dass er da war, und er hat irgendwas gerufen …«
»Was hat er gerufen?«
»Ich weiß es nicht, ich glaube, es war ein Name.«
Sam hantierte hektisch mit den Autoschlüsseln herum, um den Wagen möglichst schnell anzulassen.
»Wo bist du jetzt?«, fragte er.
Jonathans Stimme wurde vom Motorengeräusch übertönt.
»Sag, wo du gerade bist«, wiederholte Sam. »Sag schon!«
»An der Treppe. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Mama!«, rief Jonathan.
»Nicht rufen, sei einfach still, okay?«
»Okay …«
»Ich will, dass du in dein Zimmer gehst. Tust du das bitte?«
»Ich sehe ihn. Er kommt, Papa! Er kommt!«
Panik stieg in Sam auf.
»Du musst mir jetzt gut zuhören, Jonathan. Geh in dein Zimmer und schließ dich ein.«
Durchs Telefon waren rasche Atemzüge zu hören.
»Bist du unterwegs in dein Zimmer?«, fragte Sam, als er mit quietschenden Reifen auf die Straße bog. »Du musst dich beeilen. Jonathan? Hörst du, was ich sage?«
»Warte.«
»Was tust du denn jetzt? Geh in dein Zimmer!«
»Ich trau mich aber nicht. Stell dir vor, er …«
»Du kannst nicht stehen bleiben. Du musst in dein Zimmer gehen. Ich bin am Telefon bei dir, aber beeil dich!«
Sam hörte ein quietschendes Geräusch. Offenbar hatte Jonathan die Kinderzimmertür geöffnet.
»Papa, ich kann nicht …«
»Bist du in deinem Zimmer?«
»Ja, aber ich kann die Tür nicht zumachen. Das Schwert ist hängen geblieben, und ich kann nicht …«
»Du musst die Tür abschließen! Hörst du, was ich sage? Schließ die Tür ab!«
»Das versuch ich doch gerade!«, schluchzte Jonathan.
Plötzlich kam Sam ein Wohnmobil entgegen, und er musste auf den Seitenstreifen ausweichen. Das Auto schlingerte, und er hielt das Steuer krampfhaft umklammert, um nicht im Straßengraben zu landen.
»Mach Platz!«, brüllte er dem Wohnmobilfahrer zu und schaltete herunter, gab dann wieder Gas und fuhr in hohem Tempo weiter in Richtung Åselstad.
»Hast du die Tür abgeschlossen?«, fragte er Jonathan.
»Es geht nicht!«
Sein Herz raste, es hatte noch nie so heftig geschlagen wie jetzt. Sam wusste nicht, was er tun sollte. Die Polizei anrufen? Nein, er hatte Jonathan doch versprochen, am Telefon zu bleiben.
»Jonathan, du musst dich verstecken.«
Er hörte einen dumpfen Knall und dann ein schleifendes Geräusch.
»Jonathan? Hörst du mich? Jonathan!«
»Ich liege unter dem Bett«, flüsterte der Junge.
»Gut, dann bleib so ruhig liegen, wie du nur kannst. Verstehst du? Ganz ruhig.«
»Ich habe Angst.«
»Ich weiß, aber ich bin auf dem Weg. Ich komme bald. Bleib einfach ruhig liegen.«
Sams Hand zitterte so stark, dass er fürchtete, das Mobiltelefon könne ihm entgleiten. Für einen Moment war nur das schnurrende Geräusch des Motors zu vernehmen. Auf einmal hörte Sam ein Quietschen aus dem Handy, und er begriff, dass die Tür zu Jonathans Zimmer soeben langsam geöffnet worden war.
Jana Berzelius betrachtete Per. Er hatte eine weiße Papiertüte in der Hand und war untadelig gekleidet, mit hellgrauem Anzug, weißem Hemd und glänzenden schwarzen Schuhen.
»Ich habe Sushi mitgebracht«, sagte er und hielt das Essen vor ihr in die Höhe. »Zur Feier des Tages.«
»Komm rein.«
Jana schloss die Tür hinter ihm, während er sich die Schuhe auszog und in die Küche ging.
Es war für sie noch immer ungewohnt, ihn in ihrer Wohnung zu haben. Sie hatte immer allein gelebt, war immer allein gewesen, und außer Per hatte sie nie jemanden zu sich nach Hause eingeladen.
Als sie ihn kennenlernte, hatte sie gerade ihr neues Büro in der Staatsanwaltschaft betreten. Ihr Chef Torsten Granath hatte sie einander vorgestellt, und Per, der schon mehrere Jahre dort arbeitete, versuchte sofort ein Gespräch über alles zu beginnen, was nicht zur Arbeit gehörte. Sie hatte ihm erklärt, dass sie Smalltalk nicht leiden könne, aber er hatte sie nur auf seine furchtbar kindische Art angegrinst, und von diesem Tag an war zwischen ihnen allmählich eine Freundschaft gewachsen.
Sie öffnete ihre schwarze Aktentasche, zog eine kleine Schachtel heraus, die in goldfarbenes Papier eingepackt war, und hielt sie unnötig fest in der Hand, während sie ebenfalls in die Küche ging. Sie wusste nicht, wie Per reagieren würde.
Eine angenehme Wärme breitete sich in ihr aus, als sie sah, dass er schon zwei Teller auf den Tisch gestellt hatte.
»Danke für die Blumen«, sagte er, während er eine Box mit Lachs-Sushi aus der Tüte nahm.
»Was für Blumen denn?«, fragte sie.
»Die ich im Büro bekommen habe«, sagte er und verteilte die Röllchen auf die Teller. »So einen großen Strauß habe ich noch nie gesehen.«
»Ich war aber nicht daran beteiligt.«
»Nicht?« Er hielt inne, sah enttäuscht aus. »Ich dachte, der wäre von allen in der Behörde.«
»Ich wollte dir lieber das hier geben«, sagte sie und hielt ihm die kleine Schachtel hin.
»Ein Geschenk?«, fragte er erstaunt. »Für mich?«
»Ja.« Sie sah ihm in die verschiedenfarbigen Augen, von denen das eine blau und das andere braun meliert war.
»Es ist das erste Mal, dass du …«
»Nimm schon«, unterbrach sie ihn.
Per nahm die Schachtel in Empfang und hielt sie so vorsichtig, als enthielte sie Glas.
»Worauf wartest du noch? Los, pack aus.«
Er lächelte und riss sofort das Papier auf. Dann blickte er eine ganze Weile in die Schachtel und betrachtete die Manschettenknöpfe, die darin lagen.
»Danke«, sagte er und erwiderte ihren Blick.
Eine angespannte Stimmung breitete sich in der Küche aus. Er hatte seltsam reagiert, fand sie. Seine Wangen waren rot geworden, und seine Augen glänzten.
»Ich wollte dir nur gratulieren«, sagte sie und wandte sich ab. »Das war alles.«
»Stimmst du mir zu, dass zehn Jahre im Staatsdienst gut klingt?«, konterte er und stellte die Schachtel mitten auf den Tisch. »Bald bist du auch dort angekommen.«
Sie nickte und setzte sich. Ihre Karriere war vorherbestimmt gewesen. Ihr Adoptivvater hatte ihr schon früh klargemacht, dass sie in seine Fußstapfen treten sollte.
Jana sah, dass Per zwei Weingläser holte.
»Ich kann keinen Wein trinken«, sagte sie.
»Aber wir feiern doch. Nur einen kleinen Schluck?«
»Wenn überhaupt, dann nur ein kleines bisschen. Oscar Nordvall, der Neuzugang unserer Behörde, hat heute das erste Mal Bereitschaftsdienst, und ich habe ihm versprochen, jederzeit erreichbar zu sein, falls etwas sein sollte.«
»Oscar macht einen vielversprechenden Eindruck auf mich. Wo finde ich einen Korkenzieher?«
Sie deutete mit dem Kopf auf eine Schublade. Es knallte, als Per den Korken aus der Weinflasche zog.
»So«, sagte er, als er sich hinsetzte. »Dann Prost. Auf zehn Jahre im Staatsdienst.«
Sie hob das beschlagene Weinglas und sah ihm wieder in die Augen. Das Glänzen von vorhin war verschwunden.
»Auf zehn Jahre im Staatsdienst«, wiederholte sie und nippte an dem Wein.
Per stellte langsam das Glas auf den Tisch, ohne sie aus den Augen zu lassen.
»Was ist?«, fragte sie.
»Heute war die Vernehmung von Danilo Peña.«
»Was hat er gesagt?«, fragte sie und versuchte ungerührt zu wirken.
»Er hat sich entschieden zu schweigen. Er will weder etwas gestehen noch seine Unschuld behaupten, und ich frage mich, ob er während der Hauptverhandlung dieselbe Strategie einsetzen wird.«
»Und was denkst du angesichts der Hauptverhandlung?«
»Nicht so viel – nur dass es einer meiner wichtigsten Prozesse überhaupt ist.«
»Das klingt beinahe so, als würdest du das Prestige höher setzen als die Forderung nach Objektivität«, sagte sie und runzelte die Stirn.
»Ich habe bei Schuldfragen noch nie Stellung bezogen, warum sollte ich das jetzt tun?«
Sie fing seinen Blick auf.
»Das heißt, du würdest es mit Gleichmut aufnehmen, wenn die Beweise nicht für eine Verurteilung reichen würden?«
»Natürlich«, sagte er. »Aber bei der momentanen Beweislage gehe ich davon aus, dass die Voraussetzungen für eine Verurteilung gegeben sind. Das ist keine Bewertung, sondern lediglich eine Tatsache. Und auch dass Danilo Peña extrem gewalttätig ist, stellt eine Tatsache dar.«
»Davon habe ich auch schon gehört.«
»Gehört, oder weißt du es?«
»Was meinst du?«, fragte sie.
Per begann mit den Essstäbchen auf dem Teller zu spielen. Sie beobachtete ihn und spürte, dass er sich einer Sache näherte, über die sie nicht sprechen wollte.
»Er hat heute nach dir gefragt«, sagte Per nach einer Weile.
Sie erstarrte.
»Er hat nach mir gefragt?«
»Er wollte dich sehen. Warum?«
»Keine Ahnung.«
»Warum fragt er dann nach dir?«, fuhr Per fort. »Es muss doch einen Grund geben.«
»Spielt das irgendeine Rolle?«
»Ich finde schon.«
»Das finde ich nicht«, antwortete sie und wich seinem Blick aus.
Das Auto donnerte über den groben Asphalt. Nach der Kurve beschleunigte Sam Witell und sah schon bald sein weißes Haus vor sich.
Er bremste abrupt, warf sich aus dem Wagen, lief so schnell er konnte auf das Haus zu und verkniff sich, laut Jonathans Namen zu rufen.
Der Schweiß lief ihm den Rücken herab, als er die Tür öffnete.
Er machte einen Schritt in die große Diele und sah sie sofort.
»Felicia!«, keuchte er.
Sie lag vollkommen still da, ein paar Meter von ihm entfernt, mit den Händen seitlich am Körper. Die graue Strickjacke war ihr von der Schulter gerutscht, der BH-Träger hing locker über der Haut. Ihre Augen waren offen und starrten ihn leer an. Ein Wangenknochen war stark gerötet, eine Blutlache hatte sich um ihren Kopf gesammelt und zwischen den grauen Steinplatten, auf denen sie lag, ein dunkelrotes Rinnsal gebildet.
»Nein, nein, nein …«
Sam nahm seine Frau in den Arm, hielt ihren Körper und spürte, dass seine Hände vom Blut ganz nass wurden. Dann wandte er seinen Blick nach oben in Richtung Treppe und rief:
»Jonathan?«
Panik drohte ihn zu überwältigen, als aus dem oberen Stock keine Antwort kam.
»Jonathan, ich komme!«
Sam ließ Felicia los und erhob sich so hastig, dass der Boden unter ihm schwankte. Er taumelte zur Seite, stolperte über einen Turnschuh, landete in der Garderobe, und Jonathans hellblaue Jacke fiel über ihn.
Hastig befreite er sich, kam wieder auf die Füße und lief die Treppe hinauf. Ein seltsames, pfeifendes Geräusch war aus dem Fernsehzimmer zu hören. Dann ertönte ein Knacken, bevor das Ganze von vorn anfing. Die Geräusche kamen sicher vom Videospiel, dachte Sam.
»Jonathan?«, rief er wieder. »Ich bin gleich bei dir!«
Atemlos erreichte er das Zimmer des Jungen, sah die grün gestreifte Tapete und das unaufgeräumte Bücherregal und den Schreibtisch mit dem kleinen Computerbildschirm.
Das Bett war gemacht, und die cremeweiße Tagesdecke hing bis zum Fußboden.
Sam beugte sich vor, schob den weichen Stoff zur Seite und schaute unter das Bett.
Entsetzt schrie er auf.
Jonathan war nicht da.
3
Blaulicht von Polizeiautos und Rettungswagen flackerte durch den Garten und über das Haus in Åselstad.
Henrik Levin war an der Haustür stehen geblieben. Die Kriminaltechniker verrichteten mit raschelnden Overalls ihre Arbeit.
Die Untersuchung des Tatorts war bereits in vollem Gang.
Er trat einen Schritt vor und betrachtete die tote Frau, die auf dem Fußboden vor ihm lag.
»Shit«, murmelte Mia, die hinter ihm stand. Sie trug ein kurzes, schwarzes Kleid.
Sie arbeiteten schon lange im selben Team, aber Henrik hatte sie noch nie so aufgestylt gesehen. Der Notruf war vor zwanzig Minuten eingegangen. Da hatte er gerade seinen Wagen zu Hause abgestellt. Er war gleich wieder auf die Straße gefahren, hatte Mia angerufen und sie wenig später vor einer Villa im mondänen Stadtteil Kneippen aufgesammelt. Als sie ins Auto gestiegen war, hatte er geschwiegen und weder ihr Kleid noch ihre Fahne oder ihre schlechte Laune kommentiert. Er war einfach auf direktem Weg zum Tatort gefahren.
Henrik hob den Blick, als die Kriminaltechnikerin Anneli über die Trittsteine im Garten auf sie zukam. Eine Kamera hing um ihren Hals. Kurz nickte sie ihnen zu, dann sank sie neben der Toten auf die Knie.
»Was kannst du denn schon über das Geschehen sagen?«, fragte Henrik.
Anneli zog den Mundschutz herunter.
»Sie ist noch nicht so lange tot«, sagte sie. »Ich schätze eine Stunde oder sogar weniger.«
»Und die Mordwaffe?«
»Keine Stichverletzungen, keine Einschusslöcher, soweit ich sehen kann. Sie hat eine gerötete Stelle am Jochbein, und meine Vermutung ist, dass sie dort einen harten Schlag abbekommen hat. Infolgedessen ist sie nach hinten gefallen und mit dem Kopf auf den Steinboden geschlagen. Aber ob der Sturz die Todesursache ist, kann ich momentan nicht sagen.«
»Ist die Tote von der Stelle bewegt worden?«, fragte Henrik.
»Sieht nicht so aus.«
»Hast du irgendwelche Spuren vom Täter gesehen?«
»Bisher nicht.«
»Gar keine?«
»Nein, aber wir sind längst nicht fertig.«
Henrik drehte sich um und bemerkte, dass eine hellblaue Kinderjacke auf dem Fußboden lag und dass das Schuhregal umgekippt war.
»Das heißt, wir haben einen Mord am Hals«, stellte Mia fest.
»Nicht nur«, sagte er. »Es geht auch um eine Kindesentführung. Denn ihr habt das Haus schon durchsucht, oder?«
»Ja, aber wir haben den Jungen nicht gefunden«, berichtete Anneli.
»Wie alt ist er?«, fragte Mia.
»Sechs«, antwortete Henrik, atmete tief ein und sah ins Innere des Hauses. Es gab einen offenen Wohnbereich, und im Esszimmer war der Tisch gedeckt. Eine Welle von Gefühlen überschwemmte ihn, als er die ordentlich gefalteten Servietten auf den Tellern sah.
»Okay«, sagte Mia. »Dann lassen wir Anneli und ihr Team in Ruhe arbeiten, damit sie irgendwann fertig sind, oder?«
Henrik nickte.
Sie verließen das Haus, gingen hinaus auf die Veranda und durch den Garten auf das flackernde Blaulicht zu.
In einem der Autos saß ein Mann, der in eine Decke gehüllt war und auf seine Knie hinunterstarrte. Ein Streifenpolizist sprach durch die offene Wagentür mit ihm. Das musste Sam Witell sein. Der Mann hob den Kopf und starrte sie mit verweinten Augen an, als sie sich vorstellten.
»Was ist eigentlich los?«, fragte er mit ängstlicher Stimme. »Keiner sagt mir etwas.«
»Es tut mir leid«, sagte Henrik. »Ihre Frau ist tot.«
»Ja, aber warum ist sie noch immer im Haus?«
»Sie bleibt dort, bis die Untersuchung des Tatorts abgeschlossen ist.«
Henrik betrachtete das blasse Gesicht des Mannes, sah die Angst in seinen Augen, und plötzlich empfand er tiefes Mitgefühl. Der Mann war von einer unfassbaren Tragödie getroffen worden.
»Es tut mir wirklich sehr leid«, wiederholte er.
»Und Jonathan?«, fragte Sam Witell. »Wo ist er? Haben Sie ihn gefunden?«
»Sie müssen uns aufs Polizeirevier begleiten«, verkündete Mia.
Sam Witell sah sie verständnislos an, dann wanderte sein Blick zu Henrik.
»Warum denn das?«, fragte er beunruhigt.
»Wir müssen mit Ihnen über die Ereignisse sprechen«, erklärte sie.
Sam Witell machte Anstalten aufzustehen. Die Decke glitt von seinen Schultern, und Henrik sah, dass er Blut an den Händen, an der Hose und am Pullover hatte.
»Setzen Sie sich«, sagte Henrik und legte seine Hand auf Sam Witells Schulter.
»Aber ich kann nicht fahren«, sagte Witell mit panischem Blick und unternahm einen weiteren Versuch, sich zu erheben.
»Bleiben Sie sitzen«, sagte Henrik.
»Nein, ich muss …«, antwortete der Mann und schlug Henriks Hand von seiner Schulter.
»Hinsetzen!«
Henrik versuchte ihn zurückzuhalten, aber Sam Witell riss sich los, stürmte aus dem Auto und versuchte wegzulaufen. Plötzlich gaben seine Beine unter ihm nach. Er blieb auf dem Bauch liegen, während er sein Haus anstarrte und laut weinte.
Henrik und Mia packten seine Oberarme, zogen ihn auf die Füße und führten ihn zurück zum Auto.
Jana Berzelius ging rasch die Treppen hinunter und dann durch den Gang in Richtung Tiefgarage. Ihr langes, dunkles Haar wippte bei jedem Schritt leicht über den Schultern.
Vor Kurzem hatte sie einen Anruf von Oscar bekommen, dass eine Frau umgebracht worden und ein sechsjähriger Junge verschwunden sei. In Abstimmung mit ihm und ihrem Chef Torsten hatte sie beschlossen, die Angelegenheit zu übernehmen. Unter anderem sollte ein erstes Gespräch mit Sam Witell geführt werden, dem Vater und Ehemann, der als Erster am Tatort gewesen war.
Per hatte sofort verstanden, dass sie in einer dringenden Angelegenheit angerufen worden war, und sie mit Fragen oder Einwänden verschont. Stattdessen hatte er einfach die Schachtel mit den Manschettenknöpfen mitgenommen, sich kurz verabschiedet und war dann gegangen.
Jana näherte sich der stabilen Metalltür zur Garage, als sie darüber nachzudenken begann, was Per über Danilo gesagt hatte. Er wollte sie sehen, dabei hatte sie schon längst beschlossen, dass sie nie wieder mit ihm zu tun haben wollte.
Für ihn war die Hautritzung im Nacken kein Hindernis. Er riskierte nichts, indem er sie zeigte. Sie hingegen riskierte alles.
Sie würde ihre gesamte Karriere und ihr bisheriges Leben aufs Spiel setzen, wenn jemand entdeckte, dass sie in der Lage war zu töten und sogar schon getötet hatte.
Das unangenehme Gefühl stieg wieder in ihr auf. Ihr Gegner in dem illegalen Kampfclub hatte die Buchstaben im Nacken gesehen. Sie musste herausfinden, wer er war, und ihn zwingen, das zu vergessen, was er gesehen hatte.
Dabei reichte ihr schon die ständige Angst, dass Danilo sie verraten könnte. Er wusste, wie viel es ihr bedeutete, ihre gemeinsame Vergangenheit unter Verschluss zu halten, und er hatte es schon mehrmals ausgenutzt.
Er hatte sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert, nachdem er aus dem Vrinnevi-Krankenhaus geflohen war. Außerdem hatte er ihre Tagebücher und Notizen gestohlen und damit gedroht, die entsprechenden Informationen über sie zu verbreiten, sollte sie ihn der Polizei ausliefern. Mehrere Tage hatte sie mit ihm zusammen in ihrer Wohnung verbringen müssen.
Diesmal hatte er sein Versprechen gehalten. Als er schließlich die Wohnung verließ, hatte sie die Tagebücher und die Notizen zurückbekommen. Sie hatte alles verbrannt, außer den Tagebüchern, die jetzt in einem Bankschließfach lagerten. Dort sollten sie für immer verwahrt werden, verborgen vor der Umwelt.
Jana drückte die Stahltür auf, und das Geräusch ihrer Absätze hallte wider, während sie über den nackten Betonboden zu ihrem schwarzen BMW X6 ging.
Eigentlich war sie nicht sonderlich erstaunt, dass Danilo sie sehen wollte. Für ihn gab es keine normalen Grenzen. Auch ihr gegenüber trat er immer unverschämt und feindselig auf. Er war ausgesprochen stark, konnte jedes Hindernis überwinden und war dabei vollkommen schonungslos. Deshalb ahnte sie auch, dass er nicht aufgeben würde, bevor sie ihn im Untersuchungsgefängnis besuchte.
Aber er würde seinen Willen nicht durchsetzen, dachte sie und schloss das Auto auf. Diesmal nicht.
Eine helle Lampe leuchtete über dem Kopf der Justizvollzugsbeamtin Rebecka Malm. Sie stand vor dem Pausenraum und spielte an ihrem Schlagstock herum. Er war am Gürtel befestigt, der ihre schmale Taille umschloss. Jetzt musste sie die Gefängnisinsassen für die Nacht vorbereiten. Als Rebecka vor zwei Jahren hier angefangen hatte, befürchtete sie, über den eintönigen Routineabläufen verrückt zu werden, doch schon bald hatte sie gemerkt, wie sehr es ihr gefiel, dass die Arbeitstage mehr oder weniger identisch waren. Das gab ihr ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit, was sie nach der aufreibenden Scheidung von Kristian umso mehr zu schätzen wusste.
Hinter ihr wurde die Tür geöffnet, und Rebecka sah ihren Kollegen Marko Hammar herauskommen, ein kräftiger, langhaariger Mann in den Fünfzigern.
»Was stehst du hier herum?«, fragte er. »Hat das kleine Fräulein vielleicht Angst vor dem großen bösen Buben in der Nummer acht?«
»Hör auf«, sagte Rebecka genervt. »Ich habe keine Angst vor ihm.«
Sie wusste, dass sie mit ihrer geringen Körpergröße und ihrem geschminkten Gesicht jünger als siebenundzwanzig aussah, aber er musste ja nicht mit ihr reden, als wäre sie ein Kind.
»Das solltest du aber«, sagte Marko.
»Willst du mir etwa Angst einjagen?«
»Nein, aber der neue Typ ist ein bisschen … schwierig, könnte man sagen. Er unterliegt den höchsten Sicherheitsauflagen, aber hat wie alle anderen Insassen das Recht auf eine Stunde Hofgang pro Tag. Jeder Schritt außerhalb der Zelle muss von mindestens zwei Personen überwacht werden. Willst du, dass ich ihn ins Bett bringe?«
»Jetzt hör schon auf. Du bleibst auf deiner Seite und ich auf meiner, wie immer.«
»Okay, aber rede nicht mit ihm«, warnte Marko sie.
»Wie soll ich ihm denn dann eine gute Nacht wünschen? Was hat er eigentlich getan?«
Marko seufzte und zog das Spiralkabel mit dem Schlüsselbund aus der Hosentasche.
»Danilo Peña ist ein Monster. Mehr musst du nicht wissen«, erklärte er. »Also denk dran: Fass ihn nicht an, rede nicht mit ihm. Du darfst nur schauen.«
Sie begannen den Häftlingen eine gute Nacht zu wünschen, jeder in seinem Bereich. Je weiter sich Rebecka der Zelle acht näherte, desto gespannter war sie. Sie fragte sich, warum. Schließlich verspürte sie sonst nie eine solche Unruhe vor der Begegnung mit einem Gefangenen. Es war Markos Schuld, dachte sie.
Aufgrund der idiotischen Kommentare ihres Kollegen zögerte Rebecka, als sie den Schlüssel ans Schloss von Peñas Zelle hielt. Und statt die Tür zu öffnen, entriegelte sie nur die Luke.
Vorsichtig blickte sie hinein, sah ihn aber nicht. Plötzlich meinte sie ein Flüstern zu hören und zuckte zusammen. Sie lächelte nervös, als ihr klar wurde, dass Peña sich direkt hinter der Tür versteckt hatte.
»Die Tablette, nach der ich gefragt habe«, sagte er leise. »Zweimal schon habe ich um eine Kopfschmerztablette gebeten. Bitte …«
»Rebecka!«, rief Marko wütend. »Was machst du da, verdammt noch mal?«
»Er hat gesagt, dass er …«
»Geh weg von der Tür!«
»Aber er braucht eine Tablette«, sagte Rebecka und warf Marko einen säuerlichen Blick zu.
»Davon weiß ich nichts.«
»Alle Häftlinge haben ein Recht auf Medikamente.«
»Das Einzige, worauf Peña ein Recht hat, ist, die Fresse zu halten. Wenn er noch einmal das Wort ›Tablette‹ in den Mund nimmt, kann er die Stunde Hofgang morgen vergessen.«
Rebecka wandte wieder den Blick zur Zellentür und zuckte zusammen, als sie Peña sah. Er schaute sie mit intensiven, dunklen Augen durch die offene Luke an.
»Bitte«, sagte er.
»Rebecka, mach die Luke zu!«, rief Marko.
Widerwillig gehorchte sie.
»Warum bekommt er nicht einfach eine Tablette?«, fragte sie hartnäckig, während sie zur nächsten Zelle weiterging.
»Er soll lernen, wer hier das Sagen hat«, antwortete Marko.
»Aber was, wenn er ernsthaft krank ist? Was machen wir dann?«
»Nichts.« Er grinste.
»Setzen Sie sich bitte«, sagte Henrik Levin an Sam Witell gewandt und zeigte auf einen Stuhl im Vernehmungsraum. Dann nahm er neben Jana Berzelius Platz. Er warf einen raschen Blick zum dunklen Fenster, hinter dem Mia das Gespräch mitverfolgte.
Sam Witell sackte auf dem Stuhl zusammen. Vermutlich stand er noch immer unter Schock. Seine blutige Kleidung war ins Labor zur Analyse geschickt worden, und er hatte neue Sachen bekommen, ein Langarmshirt und eine Jogginghose.
Henrik lehnte sich zurück und fragte sich, wie er selbst reagiert hätte, wenn seine Frau Emma ermordet worden und eines seiner Kinder, Felix, Vilma oder Vilgot, verschwunden wäre. Wie könnte er dann überhaupt weiterleben?
»Es tut mir wirklich leid, was Ihrer Frau und Ihrem Sohn zugestoßen ist«, begann er.
»Haben Sie sie abgeholt?«, fragte Sam Witell beinahe flüsternd. »Felicia, haben Sie sie abgeholt?«
»Sie wird noch eine Weile im Haus bleiben«, antwortete Henrik.
»Und Jonathan?«
»Wir suchen ihn noch immer.«
»Haben Sie auf der Rückseite des Hauses geschaut? Er hat da eine Hütte, die er …«
»Wir suchen überall«, unterbrach Henrik ihn und betrachtete Jana Berzelius, die schweigend dasaß und den Mann vor sich in Augenschein nahm.
Beide hoben den Blick, als Witells Verteidiger, ein älterer Mann mit Schnurrbart, den Raum betrat. Er setzte sich neben seinen Mandanten und flüsterte ihm zu, dass er bislang nicht unter Tatverdacht stehe, sondern von der Polizei als Zeuge vernommen würde.
»Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist«, sagte Sam Witell. »Ich …«