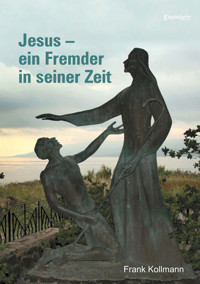
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nach christlichem Glauben hat Jesus das göttliche Werk vollendet, welches im Alten Testament vorbereitet wurde. Da Jesus sich jedoch als „Sohn“ Jahwes, den Gott der Israeliten sah, müsste er nach jüdischem Glauben zu seinem Volk gesandt worden sein, um das Land von den Römern zu befreien. Jesus aber löste sich von dieser Vorstellung und predigte Nächsten- und Feindesliebe. Stellt man die geschichtlich belegten Vorgänge zu seiner Zeit dem Wirken Jesus gegenüber, so fällt auf, dass es keinen Bezug zu dem allumfassenden Wunsch gerade der ärmeren Bevölkerung gibt, das Land von den Fesseln der Besatzer zu befreien. Nach dem Ende des Jüdischen Krieges war jedoch kein Befreier-Messias mehr von Nöten. Viele Indizien deuten deshalb darauf hin, dass die Jesus-Geschichte von den Evangelisten den Bedürfnissen der Nachkriegsphase angepasst wurde. Die Handlung folgte dem von den Prophezeiungen vorgegebenen Weg, der am Kreuz enden musste, „damit sich das Wort der Schrift erfüllt“. Erst die ebenfalls von Jesus vorhergesagte Wiederauferstehung führte zu seiner Vergöttlichung und letztendlich zum Erfolg seiner Lehre. Vielleicht war der wahre Jesus ein charismatischer Wanderprediger, der den Evangelisten als Vorbild gedient hat. Die Evangelien selbst sind jedoch von Anfang an als eine reine Glaubensbotschaft gedacht, die nichts mit der Realität zu tun hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Kollmann
JESUS – EIN FREMDER IN SEINER ZEIT
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2023
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild: Frank Kollmann
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Jesus – ein Fremder in seiner Zeit
Einleitung
Die Person Jesus, kritisch betrachtet
Wie nannten Jesus seine Zeitnenossen, wie sah er sich selbst, welche Titel stammen aus späterer Zeit?
Jesus – der Messias?
Jesus – der Gottessohn?
Jesus – der Menschensohn?
Jesus – ein (falscher) Prophet?
Jesus – der Gottesknecht
Jesus – der (Gesetzes-)Lehrer (Rabbi)
Jesus – König der Juden
Jesus – seine Bildung, sein Beruf, seine soziale Stellung
Resümee
Theorien zur Lebensgeschichte Jesus
1. War Jesus der, den wir aus der Bibel kennen?
2. War Jesus ein charismatischer Wanderprediger?
3. War Jesus ein Zelot?
4. Lehrer der Gerechtigkeit – ein Vorbild für Jesus?
5. Waren die Römer (oder Flavius Josephus) die Autoren der Evangelien?
6. Wurde die Figur „Jesus“ frei erfunden?
7. Lebte Jesus als Paulus weiter?
Die Anhänger Jesus
Die unglaubwürdigen Geschichten rund um Jesus
Jesus, das Gesetz und das Judentum
Der kleine Gott und das große Universum
Welche Hinweise findet man über die Mission Jesus in den Evangelien?
Welche Mission hatte Jesus wirklich zu erfüllen?
Kam Jesus auf die Welt, um den jüdischen Glauben zu reformieren?
Kam Jesus auf die Welt, um den Juden das Reich Gottes anzukündigen?
Kam Jesus auf die Welt, um einen neuen Bund mit Israel und Gott zu schließen?
Kam Jesus auf die Welt, um die Israeliten von den Römern zu befreien?
Kam Jesus auf die Welt, um das Evangelium zu allen Völkern der gesamten Welt zu predigen?
Kam Jesus auf die Welt, um die Sünden auf sich zu nehmen bzw. die Menschen von den Sünden zu erlösen?
Wollte Jesus eine neue Religion und in Folge die Kirche gründen?
Die Position der katholischen Kirche zur Misson Jeus
Kam Jesus auf die Welt, damit sich die Prophezeiungen aus dem Alten Testament zu erfüllen?
Setzten die Jünger Jesus seine Mission fort?
Die Messias-Erwartung der Juden
Die Situation der jüdischen Bevölkerung in den Jahren 4 v. Chr. bis 66 n. Chr
Der Jüdische Krieg
Masada
Der Krieg und seine Folgen
Die Evangelien im Kontext ihres Zeitgefüges
Die Gott-Jesus-Beziehung
Theorien über den Abfassungszeitraum der Evangelien
Wer waren die Adressaten des Markus-Evangeliums?
Jesus und die Pharisäer
Prophezeit und geplant: die Kreuzigung Jesus
Allgemeines zu den Evangelien
Die fragwürdige Person Paulus
Die Bekehrung von Paulus
Paulus ignoriert das Leben und die Taten Jesus
Der Jude Paulus und seine Sympathie für die Heiden
Wodurch unterscheidet sich Paulus von Jesus?
Wurde Paulus von Gott beauftragt, die Mission Jesus zu korrigieren?
War auch Paulus ein Fremder in seiner Zeit?
Paulus und die Trennung vom Judentum
Paulus und sein Einfluss auf die Evangelien
Aus welcher Zeit stammen die Paulus-Briefe?
Wie glaubwürdig sind die Paulus-Briefe?
Die Lösung des Paulus-Rätsels?
Die weitere Entwicklung des Christentums
Fehlende Fakten werden durch eindringliche Glaubensbotschaften ersetzt
Schlussgedanken
ANHANG
Die Kirche und die moderne Welt
Einleitung
Der Grund, mich als theologischer Laie mit dem Glauben insgesamt und der Bibel im speziellen zu befassen, liegt in meiner Skepsis gegenüber vorgegebenen religiösen Dogmen, die meiner Ansicht nach nicht kommentarlos zur Kenntnis genommen werden können. In meinem im Jahre 2020 erschienenen Buch habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, an welchen Gott wir wirklich glauben, da mir die Bibel nur äußerst unzureichende Antworten auf diese Frage gegeben hat. Dabei bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass:
„Der Gott der Bibel ein Phantom ist, welcher durch die frühgeschichtliche Prädominanz einer von Aber- und Dämonenglauben durchdrungenen Urbevölkerung gefördert und durch die Umstände ihrer geschichtlichen Entwicklung zustande gekommen ist. Er setzt sich zusammen aus dem archaischen Gott Jahwe, dem transzendenten Gott der aaronitischen Priester, dem personifizierten und menschennahen Gott der Silo-Priester, dem idealisierten Gott der Nächstenliebe von Jesus und dem alles vergebenden Gott von Paulus, der von nun an auch für die ganze Menschheit zuständig ist.“ 1
Mit diesem Buch möchte meine Gedanken über die Bibel insgesamt sowie Jesus und Paulus im Besonderen vervollständigen und versuchen, ein Ergebnis zu erarbeiten, welches meine erste Einschätzung bestätigt oder widerlegt.
Mir ist nicht entgangen, dass ein Buch wie dieses die Gefahr in sich birgt, dass die Resultate sehr stark von der Einstellung und den Ansichten des Autors geprägt sein können. Kein Individuum kann sich wohl vollständig von seiner eigenen Subjektivität lösen. So wird z. B. ein Theologe kaum von seiner Glaubensvorstellung abweichen, wenn er ein einen biblischen Text interpretiert. Um diese Gefahr gering zu halten, habe ich versucht, möglichst viele unterschiedliche, ja gegensätzliche Meinung zu berücksichtigen und zu verarbeiten.
Viele Exegeten bemühten sich, durch die Analyse einzelner Worte und Sätze hinter das Geheimnis der eigentlichen Botschaft zu kommen bzw. die wahren Abläufe der Geschehnisse zu rekonstruieren. Fast in allen Fällen enden aber solche Versuche mit dem Ergebnis, dass nur Vermutungen übrigbleiben, die häufig die persönliche Auffassung der Exegeten wiedergeben, was wiederum einer Reihe weiterer Interpretationen Tür und Tor öffnet.
Ich bin der Ansicht, dass grundsätzlich hinter jedem Wort der Bibel ein großes Fragezeichen zu setzen ist, denn nur Weniges ist historisch belegt und mündlichen überlieferte Aussagen sind generell mit größter Vorsicht zu betrachten, insbesondere, wenn es sich um Zwiegespräche mit Gott handelt.
Damit ist auch klar, dass eine Schlussfolgerung, die aus den biblischen Darstellungen gezogen wird, nur als eine Möglichkeit von mehreren gesehen werden darf. Es gilt also, die Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abzuwägen, deren Relevanz entsprechend zu würdigen und zu begründen.
Bezüglich der religiösen Vorstellung der Menschen zu dieser Zeit bleibt uns aber mangels anderer Quellen nichts anderes übrig, die Bibel als Grundlage für eine Untersuchung zu verwenden, wohlwissend, dass die Schlüsse, die wir aus den dort geschilderten Ereignissen ziehen, nur so richtig sein können, wie es das vorhandene Material zulässt. Mit anderen Worten, sind die Ausgangsparameter falsch, kann das Ergebnis niemals richtig sein.
Im Gegensatz zu den meisten Exegeten versuche ich die Evangelien und die Apostelgeschichte in ihrer Gesamtheit zu betrachten und sie den glaubwürdig überlieferten geschichtlichen Ereignissen dieser Zeit gegenüberzustellen. Dabei sind für mich die Schwerpunkte und die Zielrichtung der Jesuslehre in ihrer Gesamtheit weit mehr von Interesse als einzelne Aussagen.
Es wäre vermessen, sich in Gottes Gedankengänge hinein zu versetzen, aber irgendetwas muss Gott dazu bewegt haben, seinen Sohn, der Jesus Christus genannt wurde, auf die Erde zu senden. Hat es aber tatsächlich einen göttlichen Auftrag für Jesus gegeben? Eine der Kernfragen dieses Buches lautet deshalb: war es wirklich Gott selbst, der seinen angeblichen Sohn auf die Erde gesandt hat oder haben uns die Evangelisten einen Messias präsentiert, der in erster Linie ihren Vorstellungen oder den Erfordernissen ihrer Zeit entsprach?
Wenn Gott solch ein noch nie dagewesenes und bis heute einmaliges Vorhaben plante, so müsste man, zumindest im Nachhinein, einen konkreten und nachvollziehbaren Grund hierfür feststellen können. Aus den Evangelien sind nur widersprüchliche Hinweise zu erkennen, mit welcher Mission Jesus betraut wurde und welches Ziel er eigentlich erreichen sollte. Wenn er aber keine klar definierte Mission zu erfüllen hatte oder wenn er diese nicht wie vorgesehen ausgeführt oder zu Ende gebracht hatte, so wäre dies ein Indiz dafür, dass es gar keine Gott-Jesus-Beziehung gibt. In letzter Konsequenz würde dies aber auch bedeuten, dass uns die Evangelien einen Gottglauben vortäuschen, der auf falschen Voraussetzungen beruht.
Auf eine Reihe von drängenden Fragen soll versucht werden, eine Antwort zu finden:
War es der richtige Zeitpunkt, Frieden und Nächstenliebe in einer Phase des kollektiven Aufstandes gegen die Besatzer zu predigen? Welche Menschen hat er bekehrt oder zu bekehren versucht? Wen hat er mit seiner Lehre angesprochen und wen hat er davon gezielt ausgeschlossen? Wie weit reichte sein geographischer Wirkungskreis?
Auch ist die Frage zu stellen, in welcher Eigenschaft Gott Jesus auf die Welt kommen ließ und welche Identität Gott ihm verliehen hat? Wie hat er sich selbst bezeichnet? Wie haben ihn seine Zeitgenossen gesehen? Welchen Wandel hat seine Person in späterer Zeit über sich ergehen lassen müssen?
Waren die Evangelien eine bloße Niederschrift von mündlichen Überlieferungen? Gab es bereits vor Markus schriftliche Aufzeichnungen? Was hat es mit der Logienquelle auf sich? War Paulus der wahre Apostel? Schließlich wurde ihm ja ebenfalls ein (anderes) göttliches Evangelium offenbart.
Der Text der Evangelien vermittelt uns ein Bild, als ob deren Autoren Augenzeugen der damaligen Ereignisse gewesen wären. Tatsächlich stammen die Niederschriften jedoch aus einer völlig anderen Zeitepoche. Die Niederlage im Jüdischen Krieg veränderte alles! Nichts war mehr wie zuvor. Was gestern noch angehimmelt wurde, wird nachher verpönt oder totgeschwiegen.
Traumatisiert von diesen Ereignissen flohen die Überlebenden aus dem Land. Erst dann machten sich unbekannte Autoren aus verschiedenen Kulturkreisen außerhalb Israels an die Arbeit, eine Jesus-Geschichte in einer fremden Sprache zu verfassen, die den Gegebenheiten und religiösen Bedürfnissen der Nachkriegszeit entsprechen musste.
Während die historischen Ereignisse sehr gut dokumentiert sind, spielte sich das Wirken Jesus isoliert vom Zeitgeschehen in völlig unbedeutenden Gebieten Galiläas ab. Jesus wurde in den damaligen Metropolen gar nicht wahrgenommen, was fehlende zeitgenössische Zeugnisse ausdrücklich belegen.
Historisch betrachtet hatte die jüdische Befreiungsbewegung, die schon vor Christi Geburt begann und mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer endete, drastische Auswirkungen auf das Leben der Juden und deren Auffassung von Religion.
In diesem Buch möchte ich darlegen, warum die Evangelisten in ihren Werken das politische Umfeld zu Jesus Zeiten ignorierten und warum plötzlich die Feindes- und Nächstenliebe zu einem der wichtigsten Ziele des Wirkens von Jesus wurde.
Die heutige Zeitrechnung beginnt mit dem Jahre Null; man assoziiert damit nicht nur die Geburt Jesus, sondern auch eine Art Neubeginn, die Kirche spricht sogar von einer neuen Schöpfung. Es sollte also ein neues christliches Zeitalter anbrechen.
War es aber wirklich ein Neubeginn? Und was sollte neu beginnen? Beabsichtigte Jesus selbst einen solchen oder entstand der Neubeginn erst im Nachhinein durch die nach seinem Tode einsetzende Entwicklung?
Was kann als wahre Begebenheit gewertet werden und was ist frei erfunden? Was ist Geschichte und was Mythos?
Die historisch fragwürdigen und interpretationsfähigen Evangelien ließen eine Reihe von Theorien entstehen, die uns durchaus andere Möglichkeiten des wahren Geschehens anbieten als die, die uns die Kirche vermittelt.
Ich habe dieses Buch in fünf Schwerpunkte unterteilt, die, in Gänze betrachtet, Klarheit darüber erbringen sollen, ob der Mission Jesus wirklich ein göttlicher Auftrag zugrunde lag oder ob die „Frohe Botschaft“ rein menschliche Interessen verfolgte, um den jüdischen Glauben in eine bestimmte Richtung zu lenken:
1. Wer war Jesus und wie sah er sich selbst?
2. Welche Mission hatte Jesus zu erfüllen?
3. Welche Theorien entwickelten sich aufgrund der unklaren und widersprüchlichen Evangelien?
4. Passen die Evangelien in das Zeitgeschehen und welcher Bezug findet sich zu den politischen Verhältnissen in dieser Epoche?
5. Welche Rolle spielte Paulus?
1 Frank Kollmann, An welchen Gott glauben wir? Kirchheim 2020, S. 439.
Die Person Jesus kritisch betrachtet
Im ältesten Evangelium (Markus) findet sich die Geschichte eines Mannes, der schon im ersten Satz als Gottes Sohn bezeichnet wird. Doch ist die Sache wirklich so einfach? Selbst Theologen bezweifeln häufig diese Aussage und vermuten, dass ihm dieser Titel erst in späterer Zeit verliehen wurde. Andere Bezeichnungen von Jesus, wie Messias, Menschensohn oder Prophet verwirren die Gläubigen bis zum heutigen Tag.
Geht man davon aus, dass Jesus tatsächlich göttlicher Natur ist und ignoriert alle Zweifel am Wahrheitsgehalt der Evangelien, so ergibt sich folgende Ausgangsposition: Jesus muss in Bethlehem zur Welt kommen, nicht weil Gott es so wollte, nicht weil ein Zensus stattfand, sondern weil prophezeit wurde, der Messias müsse aus dem Hause David stammen, und Bethlehem war die Stadt Davids.
Jesus verbringt seine Jugend in dem unbedeutenden Ort Nazareth, nicht weil es Gott so wollte, sondern weil es im AT so steht. Betrachtet man den gesamten Lebenslauf von Jesus, so kann festgestellt werden, dass alle wichtigen Ereignisse in seinem Leben auf Prophezeiungen aus dem AT basieren und nicht auf einem Plan Gottes. Sollte es aber Gottes Absicht gewesen sein, irgendwelche völlig unbewiesenen Aussagen längst vergangener Propheten in Erfüllung gehen zu lassen, so kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es keinen anderen, wirklich triftigeren Grund gab, Jesus ausgerechnet zu dieser Zeit zu den Menschen zu senden.
Jesus wird eine ganze Reihe Wunder zugeschrieben, die beweisen sollen, dass er der Sohn Gottes ist und von diesem auf die Welt gesandt wurde. Die Jungfrauengeburt, die Wunderheilungen und die Wiederauferstehung sollen dies eindrücklich untermauern. Die Himmelfahrt sei hier nicht zu vergessen.
Ich bin allerdings der Meinung, Jesus hätte seine göttliche Herkunft weit besser unter Beweis stellen können, wenn er eine überzeugende Botschaft vermittelt und der Welt mitgeteilt hätte, an wen er sie eigentlich hat richten wollen. Dies bleibt nämlich bis zum Ende seines Wirkens nebulös.
Zu Beginn der Arbeiten an diesem Buch schien es mir nicht sonderlich schwierig zu sein, einen Auftrag bzw. eine Mission auszumachen, mit der Gott Jesus betraut hatte, als er von ihm auf die Welt gesandt wurde. Wenn man jedoch versucht, die möglichen Missionen, die Jesus im Auftrag Gottes erfüllen sollte, genauer zu definieren und unter die Lupe zu nehmen, sind diese nur schwer dingfest zu machen.
Als ersten Ansatz habe ich versucht, das Leben und Wirken von Jesus, wie es sich mir in den Evangelien darstellt, in einem Diagramm zu veranschaulichen. Die linke Spalte oben zeigt die Bezeichnungen, wie sich Jesus entweder selbst nannte oder wie er sich widerspruchslos nennen ließ. Im unteren Teil der linken Spalte finden sich Stichworte zu verschiedenen Theorien, wer Jesus möglicherweise gewesen sein könnte.
Der mittlere Teil zeigt das Leben Jesus hinsichtlich seiner Vorbestimmung. Jesus durchläuft ein Drehbuch, welches durch die Prophezeiungen aus dem AT vorgezeichnet ist. Er kündigt sein ebenfalls prophezeites Leiden und seinen Tod mehrfach an und richtet sein ganzes Handeln danach aus, damit am Ende das Wort der Schrift durch seinen Tod am Kreuz in Erfüllung geht.
In der rechten Spalte finden sich die wichtigsten Punkte seiner Lehre und, wenn man so will, seiner möglichen Missionen. Ich werde allerdings diese in den folgenden Kapiteln aufspalten, da sie zum Teil nur Israel und die Juden betreffen und zum kleineren Teil die gesamte Menschheit. Wenn Sie in dieser Rubrik die Wunder Jesus vermissen, so hat dies einen einfachen Grund: sie sind für das Erreichen der möglichen Ziele von Jesus einfach irrelevant, da andere (angeblich falsche) Propheten dies auch vollbringen konnten und Jesus hier einfach nicht zurückstehen durfte.
Die Rolle der rätselhaften Person Paulus wird am Ende behandelt. Warum hat er sich nicht für das Leben Jesus interessiert? Was hat er aus Jesus und seiner Lehre gemacht? Blieb Paulus sein Leben lang Jude? Wer schrieb seine Briefe? Hat er das Judentum gespalten oder hat dies Jesus verschuldet? Ist er der eigentliche Gründer des Christentums? Es bleiben noch viele Fragen offen, die es zu erläutern gilt.
Der Namenswirrwarr in den Evangelien
Neben den verschiedenen Ungereimtheiten in den Evangelien erschwert uns auch die Frage „wer ist wer in der Bibel?“ die Arbeit. Nicht nur, dass Jesus eine Reihe von verschiedenen Eigenbezeichnungen benützte oder sich so nennen ließ, auch die meisten anderen Namen, die die Bibel nennt, sind solche, die allein oder als Doppelnamen sehr häufig vorkommen. Selbst der Name „Jesus“ ist weithin verbreitet. Wir kennen den Propheten „Jesus Sirach“; auch der mit Jesus zum Tode verurteilte Barrabas soll den Beinamen „Jesus“ getragen haben.
Um Verwechslungen auszuschließen, wurde den Namen häufig auch die Ortsbezeichnung hinzugefügt, z. B. „Jesus von Nazareth“ oder „Maria von Magdala“. Im Markus-Evangelium heißt es:
„Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus.“ (Mk. 5,37)
Als weiteres Beispiel sei hier Johannes Markus genannt. Einmal ist er Begleiter von Paulus, ein anderes Mal Dolmetscher von Petrus. Einmal ist er der Evangelist Markus, ein anderes Mal wieder nicht.
„Johannes“ nennt sich ein Jünger Jesus, dessen Name sich auch der Evangelist Johannes aneignete. Johannes der Täufer spielt in allen Evangelien eine wichtige Rolle. Weiterhin kennen wir noch Johannes den Presbyter, der von 60 bis 130 n. Chr. gelebt haben soll. Kein Wunder, dass sich die Exegeten nicht darüber einigen können, welcher „Johannes“ die drei Johannesbriefe geschrieben hat.
Lukas ist einmal Arzt und Begleiter von Paulus, einmal ist er Rechtsgelehrter, dann wird er auch als Lukas der Evangelist gesehen, was aber der Großteil der Exegeten wiederum für unwahrscheinlich hält.
Maria ist die Mutter von Jesus; Maria Magdalena seine „Verehrerin“. In der Apg. 12,12 findet sich folgender Teilsatz: „… ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus …“
Zwei Jünger von Jesus heißen Jakobus. Einer der Brüder von Jesus heißt aber auch Jakobus.
In der Apostelgeschichte finden wir folgenden Satz: „Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinaus, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, …; Jakobus Ben Alphäus, Simon der Zelot und Judas Ben-Jakobus.“ Apg. 1,13. „Who is who“ im Neuen Testament?
Diese Beispiele sollten reichen, um einen Eindruck von dem Wirrwarr ähnlicher Namen zu bekommen, die auch noch mit einem zweiten Namen versehen werden und eine andere, zusätzliche Bedeutung haben konnten. Durch diese Namensvielfalt entstehen zwangsläufig Verwechslungen, die zu folgenschweren Fehlinterpretationen führten.
Wie nannten Jesus seine Zeitgenossen, wie sah er sich selbst, welche Titel stammen aus späterer Zeit?
In der Bibel finden sich die verschiedensten Bezeichnungen von Jesus. Haben ihm die Evangelisten diese verliehen? Stammen sie aus dem AT oder aus jüngerer Zeit?
Die Vielfalt der Bezeichnungen von Jesus gibt nur sehr wenig Aufschluss über sein eigenes Selbstverständnis. Vielmehr spiegelt sie in erster Linie die Sichtweise der Evangelisten bzw. den späteren Redaktoren wider. Sie kann uns deshalb leicht auf eine falsche Fährte führen.
Jesus – der Messias?
Der Begriff selbst wurde dem Tanach entnommen und bedeutet „Gesalbter“, ins griechische übersetzt „Christos“, was im lateinischen Sprachgebrauch zu „Christus“ wurde. Im Tanach (hebräische Bibel) wird dieser Hoheitstitel für einen von Gott auserwählten Menschen mit besonderen Aufgaben für sein Volk Israel vergeben. Nach dem Untergang des Reiches Juda (586 v. Chr.) kündigten einige Propheten einen Retter und Friedensbringer der Endzeit an. Es liegt in der zu dieser Zeit herrschenden jüdischen Auffassung begründet, dass zwei Messiasgestalten nacheinander erscheinen werden. Der erste soll Israel von der Fremdherrschaft befreien und der zweite soll die Endzeit mit der messianischen Erlösung einleiten. Mit der ebenfalls angekündigten „Erlösung“ ist jedoch nicht die Vergebung individueller Sünden gemeint, wie das später im Christentum gesehen wurde, sondern die Schuld Israels durch den Bruch des ersten Bundes (Jer. 31/31).
Die Thora sagt, dass alle „Mizwot“ (jüd. Gesetze und Rituale) für alle Zeiten bindend bleiben und dass, wer immer auch kommt, um die Thora zu ändern, sofort als falscher Prophet entlarvt werden wird (5. Moses 13,1-4).
Das Erscheinungsbild des Messias ist bei Johann Maier in seinem Buch „Judentum“ klar definiert:
„Die endgeschichtliche Verwirklichung der Gottesherrschaft besteht in der Durchsetzung der Thora, insbesondere im Land Israel. Und dies ohne Bindung
durch Weltvölker, die auf ihre angestammte Religion verzichten und den Gott Israels als einzigen Gott anerkennen. Diese theokratische Friedensordnung muss ggf. mit Gewalt durchgesetzt werden, das ist die Aufgabe des Gesalbten, aus dem Hause Davids.“2
In weiten Teilen des Neuen Testaments widerspricht jedoch Jesus der Thora und behauptet, ihre Gebote seien von Menschen gefälscht. Nach Ansicht der Juden hat Jesus schon aus diesem Grund die Voraussetzungen für einen Messias nicht erfüllt.
Nun ist es allerdings so, dass Jesus gerade die Gruppen am heftigsten angegriffen hat, die die Thora am striktesten eingehalten hatten, nämlich die Pharisäer.
Während Jesus bei Mk. 8,29 seinen Jüngern verbot, über ihn als Messias zu sprechen, erklärte er den Pharisäern gegenüber, er sei sowohl der Messias als auch der Sohn Gottes: „Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal: „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott: Bist du der Messias, der Sohn Gottes, oder nicht?“ „Ich bin es!“, erwiderte Jesus. „Daraufhin zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen.“ (Mt. 26,63).
Die letztgenannte Aussage hatte nur einen Zweck: Jesus musste die Pharisäer derart provozieren, um dem Hohen Rat Gründe für seine Verhaftung zu liefern. Seinen eigenen Vorhersagen (Leidensankündigungen) konnte er damit aber nicht gerecht werden, da es zu der Zeit den Juden verboten war, Todesurteile auszusprechen. Erst als Jesus als Aufrührer verleumdet wurde, konnte er als Staatsfeind nach geltendem römischem Kriegsrecht angeklagt und zum Tode am Kreuz verurteilt werden.
Warum aber verbot er seinen Jüngern, über ihn als Messias zu sprechen? Jesus wusste genau, dass er damit gegen das jüdische Gesetz verstößt und vermied es deshalb, auch von seinen Anhängern als Gotteslästerer gesehen zu werden.
Jesus – der Gottessohn?
Wie bereits erwähnt, wird schon im ersten Satz des ältesten Evangeliums (Markus) Jesus als der Sohn Gottes vorgestellt (Mk. 1,1). In Mt. 11,27 bestätigt Jesus unmissverständlich, dass er der Sohn Gottes ist:
„Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn denn nur der Vater; und niemand kennt den Vater denn nur der Sohn …“
Es gibt sonst nicht viele Stellen, in denen Jesus von sich behauptet, dass er Gottes Sohn sei, nämlich in Jh. 10,36. „wie könnt ihr da behaupten: ‘Du lästerst Gott!’, weil ich sagte: ‘Ich bin Gottes Sohn’; ich, der vom Vater gerade dazu erwählt und in die Welt gesandt wurde?“ und Lk. 22,70: „Da riefen sie alle: „Dann bist du also der Sohn Gottes?“ „Ihr sagt es“, erwiderte er, „ich bin es.“ Zusätzlich gibt es eine Reihe von Stellen, bei denen Jesus als Gottes Sohn angesprochen wurde, ohne dass er dem widersprochen hätte.
Die Bezeichnung „Söhne Gottes“ war nicht nur im Judentum bekannt, sondern in den meisten antiken Reichen wurden besonders herausragende Könige als Söhne Gottes bezeichnet. In den griechischen Sagen zeugten Götter mit menschlichen Frauen eine ganze Reihe von Halbgöttern. Auch im AT finden wir einen Hinweis in Ps. 2,7, der bereits eine Vaterschaft Gott Jahwes eines Sterblichen bezeugt, nämlich von König David:
„Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“. Damit ging auch das Versprechen einher: „Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Welt zum Eigentum. Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule, wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern.“
Leitet man die Worte „Sohn Gottes“ also von diesem Psalmtext ab, so kommt dem Begriff durchaus auch eine religiöse Bedeutung im Judentum zu. Wie Gott David gezeugt hat, so hat er auch Jesus gezeugt, könnte man schlussfolgern. Obwohl diese Stelle im NT nicht erwähnt wird, müssen die Evangelisten wohl zu dem gleichen Ergebnis gekommen sein, als sie Jesu zum Sohn Gottes kürten unter dem Motto, wenn schon David Gottes Sohn ist, dann muss es Jesus erst recht sein. Da er sich aber viel öfter als Menschensohn (siehe folgendes Kapitel) bezeichnet, kam es bald zu heftigen Auseinandersetzungen unter den Gläubigen über die Frage: ist Jesus göttlicher oder menschlicher Natur? Schon in den ersten christlichen Gemeinden gab es kontroverse Meinungen hierüber.
Mit drei verschiedenen Ansätzen wurde versucht, das Problem anzugehen: Monarchianismus: Jesus Christus ist als Mensch geboren und wurde dann später von Gott adoptiert. In dieser Version besteht eine Einheit aus Gott Vater und dem Sohn. Gott und Jesus sind also nur zwei verschiedene Erscheinungsformen ein und desselben Gottes.
Im Modalismus ist Jesus als volle Gottheit anerkannt. Allerdings soll der Monotheismus dadurch gewahrt bleiben, dass es letztendlich doch auf eine Identität von Gott und Jesus hinausläuft. Man versuchte jedoch den Eindruck zu vermeiden, dass Gott selbst am Kreuz hatte leiden müssen.
Im frühen Subordinatianismus ist Gottes Sohn dem Gott Vater untergeordnet. Die Anhänger dieser Theorie sehen die Bezeichnung „Gottessohn“ als Ehrentitel und Jesus nur als „Adoptivsohn“ Gottes an. Einen der wichtigsten Vertreter dieses Subordinatianismus finden wir später im Presbyten Arius aus Alexandrien (280-336 n. Chr.). Er gründete die Glaubensrichtung der Arianer (Arianismus) und lehrte, dass Jesus ein Geschöpf Gottes sei und deshalb nicht wesensgleich mit ihm sein konnte.
Die damaligen Gegenspieler nannten sich Trinitarier, Athanasianer oder Nicaener. Sie glaubten, dass Gott und Jesus auf einer ranggleichen Ebene stehen. Nachdem Kaiser Konstantin 313 n. Chr. den Christen im Römischen Reich die Religionsfreiheit gewährte, bestand auch von offizieller Seite her das Bedürfnis, die Frage nach dem Wesen Jesus Christus zu klären.
Im Jahre 325 n. Chr. lud der Kaiser deshalb die Bischöfe des Reiches nach Nicäa (nahe dem heutigen Istanbul) ein, um eine Antwort auf diese Kernfragen zu finden. Da Jesus bereits bei seiner Zeugung göttlich war und nur ein Sohn Gottes wiederauferstehen konnte, musste das Konzil entscheiden, dass Jesus mit Gott wesensgleich ist.
Und hier liegt das Ergebnis der kirchlichen Wahrheitsfindung vor:
- Jesus Christus wurde Mensch, ist aber Gott geblieben!
- Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch – dieses Geheimnis bleibt dem menschlichen Verstand unerklärlich,
- der wissenschaftlichen Forschung unzugänglich,
- aber dem Glauben kostbare Erkenntnis!
Sollten Sie hier Verständnisprobleme haben, kein Problem, es gibt endlose und kontroverse Kommentare und Ansichten zu diesem Thema.
Auf nicht weniger als drei Konzilen befasste man sich bis zum 5. Jahrhundert mit diesem Thema. Auf dem Konzil von Chalcedon (heutiger Istanbuler Stadtteil Kadiköy) im Jahre 451 entschied man endgültig über den lange und erbittert geführten Streit um die menschliche oder göttliche Natur Jesus Christus. Das Ergebnis: Jesus ist Gott der Sohn als zweite Person der Dreifaltigkeit und wahrer Mensch zugleich, unvermischt und ungetrennt. Die Trinität wurde zum Dogma. Nicht einverstanden damit waren allerdings die Ostkirchen, insbesondere der Kirchen Ägyptens, Syriens und Palästinas. Sie sahen die Entscheidung des Konzils als eine Rückkehr zum Nestorianismus an (Jesus ist eine Person mit menschlicher Natur und eine Person mit göttlicher Natur zugleich – beide Personen sind mit dem Band der Liebe miteinander verbunden). Neben machtpolitischen Einflüssen führte diese Entscheidung letztendlich auch zur Kirchenspaltung (Schisma) zwischen Ost- und Westkirche (katholische und orthodoxe Kirche), wobei der Arianismus in der Ostkirche verankert blieb. Nach Joachim Gnilka (Professor für neutestamentliche Exegese) ist die Beweislage über die göttliche Natur von Jesus offenkundig, weil dies an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments vorkommt. Daher wäre es auch nicht nötig, darüber zu streiten:
„Als Gottessohn steht er in einem einzigartigen Verhältnis zu Gott“3. Zur Begründung führt er auf, dass dies in den heiligen Schriften „hinreichend vertreten“ sei. Mit anderen Worten: man braucht etwas nur oft genug wiederholen oder abschreiben und schon wird es zur göttlichen Gewissheit.
Die Ablehnung von Jesus durch die Juden hatte jedoch einen trivialen Grund: sie sahen die Eigenbezeichnung „Sohn Gottes“ als eine Gotteslästerung an, da der von den Propheten vorhergesagte Messias niemals auch der Sohn Gottes sein sollte.
Es finden sich allerdings einige Ereignisse in den Evangelien, die Jesus automatisch zu einer gottähnlichen Figur machen, nämlich die Jungfrauengeburt, die Wunder, die er vollbracht hat und die Wiederauferstehung/Himmelfahrt. Kein normaler Mensch wäre in der Lage, dies zu bewerkstelligen. An diesem Punkt gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder wir glauben dies ohne den geringsten Beweis in Händen zu halten, dann war Jesus Gottessohn, oder wir glauben das nicht, dann war Jesus ein ganz normaler Mensch, bestenfalls ein charismatischer Wanderprediger.
Jesus – der Menschensohn?
Jesus bezeichnet sich selbst sehr häufig (aber meistens in der dritten Person) als „Menschensohn“. Dieser Begriff wurde dem Zitat in Daniel 7,13 („Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn“) entlehnt. Hier soll auf das Kommen des Messias verwiesen worden sein, was meiner Meinung nach sehr zweifelhaft erscheint. Liest man weiter, so findet man folgenden Wortlaut (Vers 14): „Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass alle Völker ihm dienen sollten.“ Um in Vers 15 fortzufahren: „Ich Daniel, entsetzte mich davor, und solches Gesicht erschreckte mich.“ War hier wirklich Jesus gemeint? Hatte Jesus je Gewalt, Ehre und die Führung eines Reiches angestrebt? Daniel erschrak jedenfalls beim Anblick seines Gesichtes, was zu denken geben mag. Wesentlich häufiger als Jesus wurde der Prophet Hesekiel als „Menschensohn“ (manchmal auch als Menschenkind) bezeichnet, nämlich 87 Mal. Bibelexegeten gehen davon aus, dass diese Bezeichnung den Propheten besonders herausheben möchte und ihn als Propheten der Endzeit auszeichnet. Warum wählt aber Jesus diese Bezeichnung für sich? Zu diesem Thema findet man keine einheitliche Meinung. Einige Exegeten sind der Auffassung, es handle sich um eine später eingefügte Bezeichnung, andere sehen darin die Darstellung eines zum Menschen gewordenen göttlichen Wesens. Auffallend ist, dass Paulus diese Bezeichnung kein einziges Mal verwendete, was wohl damit zu erklären ist, dass Paulus von Anfang an Jesus als Sohn Gottes gesehen hatte.
Nimmt man den Begriff „Menschensohn“ wörtlich, so kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass Jesus vielleicht von Gott gesandt wurde, aber als Mensch geboren und auch als solcher gestorben ist. Er war damit bis zu seiner „Himmelfahrt“ ein körperlich anwesender Mensch und kein gottähnliches Wesen. Dies würde allerdings bedeuten, dass alle metaphysischen Auslegungen über seine Person, wie z. B. seine Wunder und die Wiederauferstehung, dadurch widerlegt sind.
Jesus – ein (falscher) Prophet?
Jesus bezeichnet sich selbst relativ selten als Prophet (Mt. 13,57; Mt. 21,11; Lk. 7,16; Lk. 13,33; Lk. 24,19, Jh. 4,19). Gelegentlich nannten die Gläubigen Jesus einen Propheten (Mk. 6,15; Mt. 21,11). Sollte er auch Gottes Sohn und der Messias gewesen sein, so müssten seine Fähigkeiten die eines Propheten sicherlich miteinschließen. Die große Frage ist hier, hat er sich auch als solcher betätigt oder war er „nur“ dem Namen nach ein Prophet? Es sei nebenbei bemerkt, dass Jesus im Koran als Prophet Allahs erwähnt wird. Da Jesus in erster Linie seine Lehre verkünden wollte und den Menschen nicht mit irdischen, sondern mit himmlischen Strafen gedroht hat, falls sie ihn nicht als Sohn Gottes wahrnehmen und verehren, war Jesus eher kein Prophet. Andererseits hat er sich, wie die „alten“ Propheten auch, mit dem „Establishment“ angelegt und diesem Gottlosigkeit vorgeworfen. Wir finden aber bereits im AT eine ausgeprägte Furcht vor falschen Propheten in den verschiedensten Büchern vor – 5. Mose 13,3-5; 18,20-22; Jer. 5,31; 14,14-15; 23,21; 23,26; 23,32-34; Micha 3,5; Hes. 13,9 – um nur einige zu nennen). Diese Angst übertrug sich ganz offensichtlich auch auf Jesus, denn er warnte mehrfach (Mk. 13,22; Mt. 7,15, Mt. 24,4+11+24) vor selbigen. Aber wie unterscheidet man einen falschen von einem echten Propheten? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir weit in das AT zurückgreifen: „Wenn ein Prophet im Namen des Herrn spricht und sein Wort sich nicht erfüllt, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat.“ (5. Mose 18,22). Nun behaupteten die Pharisäer, Jesus wäre ein falscher Prophet. Wir brauchen also nur prüfen, inwieweit die Jesusworte in Erfüllung gegangen sind:
a) „Heilt kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus“ (Mt. 10,8)
b) In Mk. 16,17-19 setzt Jesus noch zu: „Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen werden gesund werden.“
Unglücklicherweise wird noch in den Evangelien bestätigt, dass Jesus nicht in der Lage war, diese Fähigkeiten auf Normalsterbliche zu übertragen: „Ich habe
schon deine Jünger gebeten, ihn (den Dämonen) auszutreiben, aber sie konnten es nicht.“ (Lk. 9,40)
c) „Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe“ (Mt. 10,7).
d) „Amen, ich sage euch, von denen die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden bevor sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen“ (Mt. 16,28).
e) Jesus erklärt den erstaunten Jüngern, sie könnten durch ihren Glauben Berge versetzen: „Ich versichere euch: Wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe; ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen: ‘Heb dich hoch und stürz dich ins Meer!’, und es wird geschehen. Alles, was ihr glaubend im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten.“ (Mt. 21,21+22).
f) „Seht ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden“ (Lk. 10,19)
Nichts davon ist in späterer Zeit in Erfüllung gegangen! Zwar ließ Lukas in der Apostelgeschichte einige Wunderheilungen durch die Jünger literarisch geschehen, doch die grundlegenden Dinge wie die Wiederkehr des Messias, die Bezwingung der Feinde oder dass der Glaube Berge versetzen kann, erfüllten sich nie und werden sich auch nicht erfüllen. So haben die Pharisäer wohl recht gehabt, Jesus nicht als den wahren Propheten Gottes und/oder als Messias zu anzuerkennen.





























