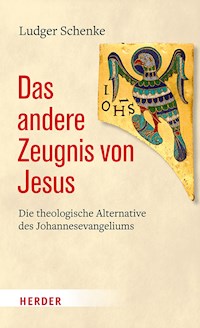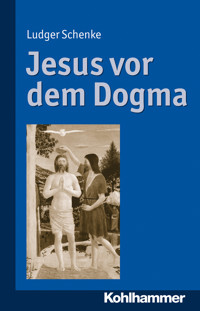
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der irdische Jesus hat keine Christologie gelehrt. Im Mittelpunkt seiner Verkündigung standen allein Gott und seine Initiative zum Heil für ein verlorenes Israel. Mit seinem Wort und in seinem Verhalten hat Jesus den Zugang zur Vergebung durch Gott eröffnet, zum Gehorsam unter Gottes Willen aufgerufen und das kommende "Reich Gottes" zugesagt. Die spätere christologische Traditionsbildung ist nicht von ihm vorgegeben, sondern sie ist Antwort auf die Verkündigung Jesu. Die Christologie dient der Lebensbotschaft Jesu und soll deren ewige Gültigkeit sichern. Darum muss auch heute gelten: Zuerst die Botschaft Jesu, danach die Dogmatik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludger Schenke
Jesus vor dem Dogma
Zur inneren Überzeugungskraft der Worte Jesu
Verlag W. Kohlhammer
Umschlagabbildung: Piero della Francesca, Die Taufe Christi, um 1450
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher
Satz: wiskom e.K., Friedrichshafen
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-024291-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-024292-0
epub: ISBN 978-3-17-024293-7
mobi: ISBN 978-3-17-024294-4
Inhaltsverzeichnis
Die besprochene Jesusüberlieferung
Vorwort
1. Alternative: Jesus ohne Dogma
2. Ausgangspunkt: Jesu Urteil über die Menschenwelt
Jesu wunderbares Kraftgefühl
Im Banne Johannes des Täufers
Die Bußpredigt des Täufers
Die Bußgesinnung Jesu
Jesus als Täuferjünger
Über den Täufer
Kontinuität auch im Gerichtsgedanken?
Schlauheit in der Krise
Jesu Urteil über Israel
Jesus ohne den Täufer
Jesu neue Perspektive
Zum Profil Jesu
3. Der Grund für Jesu Urteil: Gottes Heiligkeit
Vom Zorn und begehrlichen Blick
Analogien
Die Intention Jesu
Das Besondere bei Jesus
Folgerungen
Über Wahrhaftigkeit
Von der Würde der Sprache
Gegen das Schwören
Zum Profil Jesu
4. Neuanfang: Gottes Vergebungsbereitschaft
Vom Pharisäer und Zöllner
Das Verhalten Jesu
Richtet nicht!
Nochmals: Johannes und Jesus
Brauchen wir die Gerichtsvorstellung?
Zum Profil Jesu
5. Konsequenzen: Selbst vergeben
Ein Beispiel: Der erbarmungslose Sklave
6. Neue Chance: Gottes überraschende Güte
7. Das große Fest: Die Heimkehr des Verlorenen
Jesus als Autor der Erzählung
Zum Profil Jesu
8. Gottes Verhalten: Wiederfinden macht Freude
Zum Profil Jesu
9. Krisenbewältigung: Entschlossenheit und Torheit
Beispielhafte Warnung
Analogien
Die Erzählung vom törichten Reichen
Das Gleichnis „Vom großen Festmahl‘
Das vermutliche Jesusgleichnis
10. Die Zukunft: Gottes Reich
Was wussten Jesu Hörer über Gottes „Reich“?
Die Zukünftigkeit des „Reiches Gottes“
Die Seligpreisungen
Gott gibt die
basileia
Von der selbst wachsenden Saat
Die Annahme der Botschaft von der
basileia
Wie kommt die
basileia?
Jesu Zuversicht in Gottes Zukunft
Nähe und Gegenwärtigkeit der
basileia
Der Bezug der
basileia
zur Gegenwart
Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig
Entschlossenheit für das „Reich Gottes“
Vom Schatz und von der Perle
Zum Profil Jesu
11. Das Tun entscheidet: Grundsätzliches zur Ethik Jesu
Jesus und die Tora
Zur Ehescheidung
Vom Sabbatgebot
12. Die große Umkehrung: Arm und Reich
Die Wahrheit des Gleichnisses
Warnungen vor dem Reichtum
Vom richtigen Gebrauch des Reichtums
Die Sklaverei des Mammons
Analogien
Der „Nutzen“ des Reichtums
13. Gebot: Liebe deinen Nächsten
Das Vorbild Gottes
„wie dich selbst“
Die goldene Regel
Beispielhafte Fremdenliebe
Das Jesusgleichnis
Paradox: Der Feind als Nächster
Der Inhalt
Analogien
Die Begründung
14. Aggressionsspirale: Überwindung von Bosheit und Gegnerschaft
Das geforderte Verhalten
Warum soll man so handeln?
Analogien
Zum Profil Jesu
15. Konsequenz en: Vertrauen in Gott als Vater
Vom vertrauensvollen Bitten
Analogien
Worum es geht
Optimismus: Güte und Recht setzen sich durch
Beten als Haltung
Sorglos: Leben aus Gottes Fürsorge
Analogien
Ihr seid mehr wert als Vögel und Lilien
Analogien
Die Nutzlosigkeit des Sorgens
Gegen die Angst
Märtyrerparänese
Analogien
Zum Profil Jesu
Nachwort
Literaturverzeichnis
Register
Die besprochene Jesusüberlieferung
nach dem Matthäusevangelium
Mt 3,7-12par 23
Mt 5,21f 45
Mt 5,32 152
Mt 5,33-37 54
Mt 5,36 57
Mt 5,38-42 191
Mt 5,39b 194
Mt 5,40 194
Mt 5,41 193
Mt 5,42 193
Mt 5,44-48 183
Mt 6,7f 213
Mt 6,14f 72
Mt 6,19ff 163
Mt 6,24 165
Mt 6,25-34par 214
Mt 6,26.28b-32b 216
Mt 6,27 219
Mt 6,34 219
Mt 7,1f 64
Mt 7,7-11 203
Mt 8,11f 34
Mt 10,28 222
Mt 10,28-31 220
Mt 11,7-11par 29
Mt 11,12f 29, 140
Mt 12,43-45 19
Mt 13,24-30 127
Mt 13,45f 140
Mt 13,47f 127
Mt 18,3 121
Mt 18,12-14 99
Mt 18,23-33 73
Mt 20,1-15 79
Mt 21,28-31 145
Mt 22,1-14 107
Mt 23,13 121
Mt 27f 45
nach dem Markusevangelium
Mk 2,18a 37
Mk 2,27 153
Mk 3,24ff 18
Mk 4,3-8 129
Mk 4,26-29 124
Mk 4,30-32 137
Mk 8,36f 168
Mk 10,5-9 151
Mk 10,15 123
Mk 10,23.25 139, 162
Mk 10,25 121
Mk 12,30.31 171
Mk 14,25 134
nach dem Lukasevangelium
Lk 3,1-9 23
Lk 6,20f 122
Lk 6,24f 162
Lk 6,27-36 183
Lk 6,29-34 191
Lk 6,31 173
Lk 6,36 171
Lk 10,18 17
Lk 10,23f 135
Lk 10,30-35 174
Lk 11,5-8 208
Lk 11,20 18
Lk 12,16-20 103
Lk 13,2-5 30
Lk 13,6-9 39
Lk 13,20f 137
Lk 14,16-24 107, 108
Lk 15,4-10 99
Lk 15,11-32 86
Lk 16,1-8a 31
Lk 16,16 140
Lk 16,19-31 155
Lk 17,20f 127
Lk 17,34f 127
Lk 18,2-8 208
Lk 18,9-14 60
Lk 21,18 220
Vorwort
Es gab eine Zeit, in der Jesus noch nicht als Sohn Gottes galt, der aus dem Himmel herabgekommen und Mensch geworden ist. Das war die Zeit seines irdischen Wirkens und Verkündigens. Gleichwohl haben viele Menschen seiner Botschaft Glauben geschenkt. Sie waren sicher, dass Jesu Worte eine Botschaft Gottes an sie waren und sein Verhalten Gottes eigenes Verhalten abbildete. Darum haben sie den Ruf Jesu zur Umkehr und Erneuerung Israels aufgegriffen. Nicht Jesu Person qualifizierte seine Botschaft, sondern diese, ihre innere Wahrheit und Überzeugungskraft, qualifizierte Jesus. Wurde sie als von Gott kommendes Wort verstanden, dann konnte auch ihr Verkünder mit Gott verbunden werden als sein beauftragter und gesandter Bote, der zudem in seinem Verhalten die Botschaft vorlebte. Wurde ihr die höchste Autorität zuerkannt, dann war damit zugleich die Frage nach der Autorität Jesu gestellt und musste insbesondere im Blick auf sein Verwerfungsschicksal beantwortet werden. Diese christologische Reflexion über Jesus ist also eine Funktion der Anerkennung seiner Botschaft und somit die Antwort auf die Verkündigung des irdischen Jesu, nicht jedoch ihr Inhalt.
Deshalb soll im Folgenden nach der Jesusverkündigung vor dem Dogma gefragt werden, nach der inneren Überzeugungkraft der Erzählungen und Worte Jesu und nach seinem Verhalten, mit dem er seine Botschaft auch vorlebte – noch vor jeder Christologie. Jesu Botschaft spricht für sich selbst. Sie überzeugt aus sich. Ihre Wahrheit ist nicht abhängig von einer zuvor festgestellten Qualifikation ihres Sprechers. Wo immer Jesu Worte und Erzählungen nachgesprochen werden, kann daher ihre Wahrheit aus sich heraus offenbar werden.
Des Weiteren soll hier aufgewiesen werden, dass die Worte und Erzählungen Jesu nicht isoliert werden dürfen, dass sie nicht völlig unvergleichlich sind, vielmehr eingebunden in die prophetische Mahnung, weisheitliche Weisung und apokalyptische Hoffnung Israels. Ziel ist es schließlich darzulegen, dass die gläubige Übernahme der nachösterlichen Christologie nicht Voraussetzung ist, um sich dem Anspruch der Worte und Erzählungen auszusetzen und sie als Wahrheit im Glauben an Gottes Handeln anzuerkennen und anzunehmen. Sie ist die Folge. Wer die Botschaft des irdischen Jesus bejaht hat, wird die christologischen und soteriologischen Folgerungen für Jesu Würde und Wirken verstehen und nachvollziehen können. Sie wollen ja die unbedingte Gültigkeit und Wahrheit der Lebensbotschaft Jesu bestätigen und daran festhalten: Der irdische Jesus hat in seiner Botschaft den Zugang zu Gottes Vergebungshandeln eröffnet. Diese Botschaft durfte nicht verloren gehen. Das geschichtliche Wort Jesu sollte ein ewiges Wort werden.
Dieses Buch hat eine mehr als zwanzigjährige Vorgeschichte. In immer neuen Anläufen habe ich mich während meiner Lehrtätigkeit der Verkündigung Jesu zu nähern versucht, bis hin zu jener Pointierung, die meine Darstellung nun bestimmt. Ich hatte nicht immer vor, meine Überlegungen zu veröffentlichen. Die alte Warnung Kohelets hielt mich zunächst davon ab. Aber gerade die vielen Bücher über Jesus der letzten Jahre haben mich nun doch angetrieben, meine Überlegungen gedruckt erscheinen zu lassen. Denn viele dieser Jesusbücher versuchen, die christologische Dogmatik in die Verkündigung des irdischen Jesus einzutragen. Mein Anliegen ist ein anderes: Ich möchte die Botschaft des irdischen Jesus so zur Geltung bringen, dass sich ihre Wahrheit und Glaubwürdigkeit, die sie aus sich selbst hat, ohne Rückgriff auf die dogmatische Christologie erweist. Auch ein nicht glaubender Leser soll zunächst von dieser Botschaft berührt werden und dann Stellung zu ihrem Verkünder beziehen.
Danken möchte ich dem Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und hier besonders seinem theologischen Lektor Jürgen Schneider für eine jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ohne zu zögern hat er auch diesmal mein Manuskript angenommen und die Drucklegung mit seinem Rat begleitet.
Klein-Winternheim, im September 2013
1. Alternative: Jesus ohne Dogma
Der kirchliche Glaube schwindet mehr und mehr und mit ihm die Akzeptanz seines Christusbildes. Dennoch übt Jesus von Nazareth nach wie vor eine mächtige Faszination aus, auch auf Menschen, die sich von den Kirchen entfernt haben. Sein Leben und seine Botschaft stoßen auf Sympathie, zumindest Interesse. Historisch gesicherte Aussagen über ihn sind gefragt. Doch wir wissen über Jesus und seine Botschaft im Wesentlichen nur durch Texte, die vom christlichen Glauben geprägt wurden.
Wenn nun unser Wissen über Jesus historisches Wissen sein soll, darf es aber nicht vom Glauben abhängig sein. Es muss sich dem kritischen Urteil verdanken und kann die Annahme eines Christusdogmas nicht voraussetzen. Weil viele Menschen nicht mehr vom Glauben herkommen, ist heute deshalb eine historische Vermittlung der Lebensbotschaft Jesu notwendig. Einen solchen Zugang kann die historisch-kritische Exegese leisten. Sie ist der wissenschaftliche Versuch, von Jesus im Modus der Historie zu erzählen, und eröffnet so die Möglichkeit – wenn auch nur ausschnitthaft und in analoger Weise –, in die Position der Hörer des irdischen Jesus zu wechseln und seine Botschaft zu hören, ihren Wahrheitsanspruch zu prüfen und durch Annahme oder Ablehnung Stellung zu ihr zu beziehen. Wahrheitskriterium ist dabei die Botschaft selbst.
Auf eine missionarische Pastoral bezogen kann das heißen: Not tut heute eine Vermittlung der Botschaft Jesu, die nicht vom Christusglauben herkommt, sondern zu ihm hinführt. Um an Christus zu glauben, muss zuerst der Botschaft Jesu geglaubt werden, wie sie historische Rückfrage hinter dem Kerygma der Urgemeinde rekonstruieren kann. Muss sie nicht aus sich und notwendigerweise Gegenstand von Theologie und Verkündigung sein? Oder ist sie nicht aus sich selbst, sondern nur darum bedeutsam, weil sie in das nachösterliche Kerygma aufgenommen und damit zur Botschaft des geglaubten Christus wurde? Verpflichtende Wahrheit zu sein wäre ihr dann wie ein Etikett aufgedrückt worden, als Jesus von Gott zum Christus erhöht und bestätigt wurde. Ihr Wahrheitsanspruch ergäbe sich nicht aus dem geschichtlichen Wort Jesu, so dass jeder, der dieses Wort hört, vor seinen Anspruch gestellt wird, sondern aus der „höheren“ Wahrheit, dass Jesus der „Sohn Gottes“ ist. Während das geschichtliche Wort Jesu der historischen Frage zugänglich bleibt, ist die Erkenntnis der höheren Wahrheit, dass Jesus der „Sohn Gottes“ ist, nur dem Glauben erschwinglich.
Kirche und Theologie stehen heute in der Situation, die Botschaft Jesu in einer Gesellschaft zu verkündigen, die nicht vom Glauben an Jesus Christus geprägt ist. Die Kirche gerät mehr und mehr in die Situation, wie die Urgemeinde die Botschaft Jesu einer nicht glaubenden Umwelt zu verkündigen, zum Glauben an Jesus Christus aufzurufen. Würde die Botschaft Jesu ihre Wahrheit nicht in sich selbst tragen, sondern könnte diese nur dem aufgehen, der den Glauben an Jesus Christus zuvor vollzogen hat, wie sollte dann Jesu Botschaft in dieser Umwelt überhaupt zur Geltung gebracht werden? Wenn sie jedoch ihre Überzeugungskraft in sich selbst trägt, den Hörer also unmittelbar in die Entscheidung stellt, dann kann ihre Weiterverkündigung selbst den Christusglauben wecken und herausfordern.
Wie haben Jesus selbst und die Urgemeinde den Wahrheitsanspruch ihrer Verkündigung begründet? Jesus hat die gnädige Vergebungsbereitschaft Gottes und sein nahes „Reich“ verkündet und die Bedingungen und Forderungen genannt, um dessen teilhaftig zu werden. Wie hat er seine Botschaft begründet? Er hat prophetisch gesprochen, aber nicht als Prophet. Eine Bezugnahme auf eine Berufungsvision oder eine Botenformel suchen wir bei ihm vergebens. Einzig Lk 10,18: „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“ könnte auf eine Begründung von außen hinweisen. Jesus hat auch nicht mit der Tora argumentiert, schon gar nicht mit dem Anspruch, der Messias oder „Sohn Gottes“ zu sein. Er hat seine Botschaft offenbar überhaupt nicht von einer Instanz außerhalb ihrer selbst legitimiert. War er mithin der Meinung, dass seine Botschaft ihre Wahrheit in sich selbst trägt, eindeutig und überzeugend ist und darum letzte Autorität beanspruchen kann? Dies trifft für seine weisheitlichen Forderungen auf jeden Fall zu, aber auch für seine eschatologische Botschaft. In Lk 11,20 verweist Jesus auf sein exorzistischen Wirken als Evidenzerweis seiner Botschaft von der basileia. Wenn jetzt die Dämonen „durch den Finger Gottes“ ausgetrieben werden, dann ist Gottes „Reich“ zumindest punktuell schon erschienen. Es gilt nach Jesus, die „Zeichen der Zeit“ zu beachten und aus ihnen Schlüsse zu ziehen. Und in seinen Gleichnissen erweist sich Jesus als ein Meister der Überredungskunst, der seine Hörer von der inneren Wahrheit seiner Geschichten überzeugen will. Das kann nur bedeuten, dass für Jesus seine Botschaft aus sich sprach und keiner Autorität von außen bedurfte. Die Hörer blieben ganz auf seine Botschaft verwiesen, deren Wahrheit sie annehmen oder ablehnen konnten. Dass sie damit auch Stellung zum Träger dieser Botschaft nahmen, ihm Recht gaben oder ihn ablehnten, ist klar. Doch war diese Haltung der Hörer zu Jesus eine Folge ihrer Haltung zu seiner Botschaft. Nirgends forderte Jesus von seinen Hörern zuerst einen Glauben an seine Person, nirgends setzte er bei ihnen ein Bekenntnis zu ihr voraus, das nicht eine Funktion der Anerkennung seiner Botschaft gewesen wäre.
In der nachösterlichen Verkündigung der Urgemeinde trat zur Botschaft Jesu, die die Jünger weiterverkündeten, der Osterglaube hinzu. Er ist die Keimzelle der direkten Christologie, die Jesus als den Christus und Gottessohn bekennt. Wird jetzt der Glaube an Jesus Christus das Erste und die Annahme seiner Botschaft das Zweite? Erhält Jesu Botschaft durch das Osterereignis eine neue Qualität?
Das genau ist die Frage! War die Urgemeinde wirklich der Meinung, die geschichtliche Botschaft Jesu habe durch das Ostergeschehen eine neue Qualität erhalten, die sie vorher nicht hatte? Oder bestätigte dieses nur von Gott her Jesu Botschaft und ihren Wahrheitsanspruch? Freilich scheint es so, dass die Jünger Jesu Botschaft nach Ostern weiterverkündeten, weil Gott Jesus von den Toten auferweckt und in den Himmel erhöht hatte. Dennoch hat Jesu Botschaft in ihren Augen dadurch offenbar keine neue Qualität erhalten. Sie bleibt Jesu Botschaft, allerdings nicht nur des geschichtlich vergangenen, sondern auch des lebendigen und in den Himmel erhöhten Jesus. Er selbst spricht weiter, nun durch den Mund seiner Boten. Ostern garantiert somit die Weiterverkündigung der alten Botschaft Jesu. Es ist eben nicht so, dass im Denken der ersten Jesusboten Wahrheit und Anspruch der Botschaft sich durch Ostern qualitativ verändert hätten. Darum wird von den Hörern auch eine Stellungnahme zu Jesus gefordert (Lk 12,8f), der der irdische und himmlische Jesus zugleich ist. Die nachösterlichen Jesusboten führen also die Botschaft des irdischen Jesus weiter, freilich im Licht ihres neuen Glaubens, und sie beanspruchen, diese Botschaft weiterzuverkünden und pochen auf deren Wahrheit. Durch sie sind auch wir bleibend auf den irdischen Jesus und seine Botschaft verwiesen. Über ihre Wahrheit, die sie in sich trägt, müssen wir nachdenken.
In der Folgezeit setzte ein intensives Nachdenken über Jesus im Licht des Osterglaubens ein. Der Auferweckte und Erhöhte wurde nun Messias/Christos, Menschensohn, Sohn Gottes, Kyrios und Logos genannt. Immer aber war der irdische Jesus in diese Christologie einbezogen: Auch in seinem irdischen Wirken war Jesus der Messias/Christos, Menschensohn, Sohn Gottes, Kyrios und Logos. Der Messias/Christos ist „für uns gestorben“, der Menschensohn war verborgen auf Erden tätig, der Sohn Gottes wirkte Gottes Werke auf Erden, der Kyrios wurde im Irdischen von den himmlischen Mächten erkannt, der „Logos ist Fleisch geworden“. Die Gemeinde, die so spricht, will vom irdischen Jesus sprechen, von seinem Wirken und seiner Botschaft. Die Wahrheit der Botschaft Jesu hängt also für die nachösterliche Reflexion nicht nur von einer nachträglichen göttlichen Bestätigung ab, sondern ruht im geschichtlichen Wirken und der Botschaft Jesu selbst.
Diesen Gedanken vollziehen die Evangelisten bei ihrem Nachdenken über Jesus dann ausdrücklich. Sie wollen die Geschichte des irdischen Jesus erzählen. Freilich sehen sie dabei von ihrem Glauben nicht ab. Aber sie erzählen die Geschichte Jesu nicht so, dass darin nur der Glaube selbst seinen Ausdruck fände. Die erzählte Geschichte des irdischen Jesus geht vielmehr dem Glauben voraus. Sie fordert die Entscheidung des Glaubens oder des Unglaubens heraus. Autorität und Wahrheit tragen Person und Botschaft des irdischen Jesus somit auch nach den Evangelisten in sich selbst. Nicht erst der Glaube macht Jesu Wirken und Reden bedeutungsvoll, sie sind es in sich, und der Glaube bleibt Antwort. Auch der Unglaube entscheidet sich an der Botschaft des irdischen Jesus, indem er mit dem Anspruch seiner Botschaft konfrontiert wird und sie ablehnt. Verstockung und „Hartherzigkeit“ beziehen sich nach den Evangelisten auf die Botschaft des irdischen Jesus. Trotz ihrer „gläubigen“ Darstellungsweise wollen also die Evangelisten ihre Leser vor den irdischen Jesus stellen. Sie sind überzeugt, dass die Wahrheit seiner Botschaft aus sich selbst überzeugend und unabweisbar ist. Nicht weil Jesus der „Sohn Gottes“ ist, ist sie wahr, sondern weil sie die Wahrheit ist, bekennt der Glaube Jesus als den Messias und „Sohn Gottes“.
Aus all dem ergibt sich: Christliche Glaubensreflexion ist offenbar ihrem Wesen nach bleibend auf den irdischen Jesus und seine Botschaft zurückverwiesen. Der zwingende Grund dafür ist das Wirken und die Botschaft des irdischen Jesus selbst.
Ist die historische Rückfrage nach Jesus und seiner Botschaft im Rahmen von Theologie und kirchlicher Praxis notwendig? Bisher haben wir gesehen, dass die Rückfrage nach dem irdischen Jesus in der Urgemeinde und in den Evangelien immer erfolgt ist. Aber diese Rückfrage war nicht historisch im Sinn unseres neuzeitlichen Begriffs von historischer Wissenschaft. Sie erfolgte stets im Licht des Glaubens. Doch gilt es zu bedenken: Zumindest die ersten nachösterlichen Zeugen konnten sich unmittelbar auf den irdischen Jesus berufen, den sie gekannt und gehört hatten und dem sie persönlich nachgefolgt waren. Ihre Weiterverkündigung der Botschaft des irdischen Jesus im Licht des Osterglaubens musste den Hörern als authentisches Zeugnis gelten. Die erste nachösterliche Verkündigung hatte eine historische Rückfrage nach Jesus im neuzeitlichen Sinn gar nicht nötig, weil die Jesusboten der ersten Zeit unmittelbare Zeugen des irdischen Jesus waren. Auch die Evangelisten griffen auf solche Zeugnisse zurück, die ihnen als authentische und unmittelbare Zeugnisse über den irdischen Jesus galten.
Unser Nachdenken über Jesus ist jedoch nicht vom unmittelbaren Eindruck des Wirkens und der Botschaft des irdischen Jesus geprägt, wie noch bei den ersten Jesusboten. Die Neuzeit hat uns aber ein neues historisches Bewusstsein und reflektierte Methoden historischer Rückfrage erbracht, die beide genutzt werden müssen. Auch die Evangelisten haben „historisch“ nach dem irdischen Jesus und seiner Botschaft gefragt, allerdings mit den Mitteln der antiken Geschichtsschreibung. Wir würden ihrem Verständnis untreu, wollten wir die historische Rückfrage nach Jesus als unerheblich abtun. Sie haben mit ihren Mitteln streng daran festgehalten, dass der irdische Jesus und seine Botschaft dem Glauben vorgeordnet sind. Dieser Grundsatz scheint wesentlich für ihre Theologie zu sein und darf nicht aufgehoben werden. Wenn er noch heute gültig ist, dann ist die historisch-kritische Rückfrage nach der Botschaft Jesu und seinem Verhalten notwendig. Wenn die Lebensbotschaft des irdischen Jesus ihre Wahrheit in sich selbst trug, dann kann ihre historische Rekonstruktion auch den heutigen Menschen vor die Entscheidung stellen, diese Wahrheit anzuerkennen oder abzulehnen. In diesem Sinn ist historisches Nachdenken über Jesus heute nicht nur eine nützliche, aber zusätzliche Übung, sondern kann der erste Schritt hin zum Glauben sein.
Historisch-kritisches Nachdenken über Jesus bietet die Chance, heute neu der überzeugenden und glaubwürdigen Wahrheit der Botschaft Jesu zu begegnen, die nicht abhängig ist von einer höheren „ewigen Wahrheit“. Allerdings dürfen wir uns nicht verschweigen, dass auch historisch-kritische Rückfrage nicht voraussetzungslos und schon gar nicht neutral ist. Wie bereits die unmittelbaren Hörer Jesu seine Botschaft in unterschiedlicher, durch ihre persönliche Geschichte beeinflusster Betroffenheit gehört und beurteilt haben, so wird auch heute die Wahrnehmung und das Urteil zuerst des historisch-kritischen Forschers und dann ebenso des modernen Hörers von vielen Faktoren beeinflusst. Recht und Aufgabe des kirchlich gebundenen historischen Forschers ist zweifellos in besonderer Weise die sympathisierende Darstellung der Lebensbotschaft Jesu. Doch ist solche Darstellung keine Beeinflussung des Hörers. Zwar will sie um Zustimmung werben; doch das hat Jesus selbst auch getan. Trotz einer sympathisierenden Darstellung bleibt die freie Entscheidung der Botschaft Jesu und ihrem Wahrheitsanspruch gegenüber in Glaube und Unglaube möglich.
Das historisch-kritische Nachdenken über Jesus ist aber noch aus einem anderen Grund notwendig. Dieser ist die Kehrseite der durch die historisch-kritische Rückfrage ermöglichten, reflektierten Unmittelbarkeit zu Jesus. Unser neuzeitliches historisches Bewusstsein hat uns die Evangelienerzählungen als unmittelbaren Zugang zum irdischen Jesus und zu seiner Botschaft entzogen. Wenn das Nachdenken über den irdischen Jesus und seine Botschaft aber notwendig ist für den Glaubensvollzug, wenn diese auch für uns der Grund des Glaubens sind, dann muss unser Nachdenken über Jesus hinter die Evangelien kritisch zurückfragen. Es muss sogar noch hinter die früheste nachösterliche Verkündigung der Boten Jesu zurückfragen, obwohl die Botschaft des irdischen Jesus in diese Verkündigung eingegangen und einzig aus ihr kritisch zu erheben ist. Unser historisches Bewusstsein und Gewissen zwingen dazu, nicht der Verdacht möglicher „Verfälschung“ durch die nachösterlichen Boten. Es zwingt dazu auch das theologische Gewissen, weil auch unser Glaube Antwort auf den irdischen Jesus und seine Botschaft sein muss. Seine Botschaft muss der Mittelpunkt der christlichen Verkündigung bleiben. An ihr müssen sich Glaube oder Unglaube frei entscheiden können.
Da wir die historische Kritik an den Evangelien nicht von vornherein im Glauben überspringen dürfen, da wir auch der historischen Wahrheit verpflichtet sind, da Glaube die historische Kritikfähigkeit unseres Verstandes und unser neuzeitlich geprägtes historisches Bewusstsein nicht einfach aufheben und ersetzen kann, können wir die „Erzählung“ der Evangelien nicht mehr mit der uns vorgegebenen Geschichte der Person und Botschaft des irdischen Jesus gleichsetzen. Darum muss nicht nur das historische, sondern auch das theologische Bemühen darauf gerichtet sein, durch ein neues historisches Nachdenken die aus sich selbst überzeugende und glaubwürdige Wahrheit der Botschaft des irdischen Jesus nachzusprechen. Wenn wir wirklich überzeugt sind, dass die Botschaft Jesu wahr ist, dann müssen wir diese Botschaft und ihre Wahrheit auch in historischer Rekonstruktion zur Geltung bringen, dies insbesondere im Blick auf solche Menschen, die noch nicht zur Glaubensantwort gefunden haben. Denen aber, die zur bewussten Glaubensantwort schon gefunden haben, muss die Lebensbotschaft des irdischen Jesus immer wieder vorgestellt werden als die Wahrheit, auf die der Glaube reflektierend antwortet. Die Evangelien erhalten dann einen neuen Stellenwert als Zeugnisse solch gelungener Erinnerung der Botschaft des irdischen Jesus.
In diesem Sinn muss Theologie und Verkündigung historisch nach Jesus und seiner Botschaft zurückfragen. Es geht dabei um die historische Darstellung der Botschaft Jesu und um den Nachvollzug des in ihr selbst enthaltenen Wahrheits- und Sinnanspruchs. Ich wiederhole meine Feststellung: Not tut eine christliche Verkündigung der Lebensbotschaft Jesu, die nicht vom Dogma des Christusglaubens herkommt, sondern zu ihm hinführt. Nur die historische Darlegung der Botschaft und des Wirkens Jesu und der Aufweis ihrer inneren Sinnhaftigkeit, überzeugenden Geschlossenheit und glaubwürdigen Konsequenz auf der Basis der historischen Kritik kann diese Forderung erfüllen.
2.Ausgangspunkt: Jesu Urteil über die Menschenwelt
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!