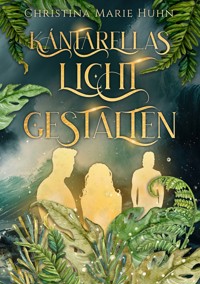
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Ich vertraue diesem Buch meine Erlebnisse an, die so aberwitzig sind, dass kein Mensch mir Glauben schenken möchte. Ich schreibe, um mich zu erinnern und gleichzeitig zu vergessen.« Durch Zufall findet die angehende Studentin Viviane den Reisebericht der jungen Lehrerin Karin Mehrendt aus dem Jahr 1907. Die ungewöhnliche Geschichte aus jener längst vergangenen Ära zieht sie komplett in ihren Bann und lässt sie das Gefühl von Raum und Zeit vergessen. Und sie fragt sich: Wie kann eine solche Liebe einfach sterben? *** Im Jahr 1906 reist die junge Lehrerin Karin Mehrendt gemeinsam mit ihrem Bruder Paul auf dem Motorschiff Stolz von Preußen nach Deutsch-Samoa, um dort als Gouvernante ihrer Nichten und Neffen tätig zu werden. Durch einen Sturm gerät das Schiff jedoch vom Kurs ab und Karin geht unfreiwillig über Bord. Sie überlebt und kommt in Cóno-Aleea wieder zu sich, einem bislang unentdeckten Inselstaat, der weit abseits der Schifffahrtsrouten irgendwo im Nirgendwo des Indischen Ozeans liegt. Karin ist nicht die erste schiffbrüchige Person, welche die Küsten des Eilands betritt, und sie erkennt, dass die dort lebenden Leute Angehörige einer uralten Zivilisation sind. Zwischen neuen Gottheiten und in einer Kultur der Gleichberechtigung aller Menschen erweist es sich als günstig, dass die junge Frau, die im deutschen Kaiserreich geboren wurde, vormals in ihrer Heimat als unliebsamer Freigeist galt. Doch jedes noch so fortschrittliche Denken bewahrt sie nicht vor dem vernichtenden Zwiespalt, zwei Brüder gleichzeitig aus tiefstem Herzen zu lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christina Marie HuhnKántarellas Lichtgestalten
Zum Inhalt:
Im Jahr 1906 reist die junge Lehrerin Karin Mehrendt gemeinsam mit ihrem Bruder Paul auf dem Motorschiff Stolz von Preußen nach Deutsch-Samoa, um dort als Gouvernante ihrer Nichten und Neffen tätig zu werden. Durch einen Sturm gerät das Schiff jedoch vom Kurs ab und Karin geht unfreiwillig über Bord.
Sie überlebt und kommt in Cóno-Aleea wieder zu sich, einem bislang unentdeckten Inselstaat, der weit abseits der Schifffahrtsrouten irgendwo im Nirgendwo des Indischen Ozeans liegt.
Karin ist nicht die erste schiffbrüchige Person, welche die Küsten des Eilands betritt, und sie erkennt, dass die dort lebenden Leute Angehörige einer uralten Zivilisation sind. Zwischen neuen Gottheiten und in einer Kultur der Gleichberechtigung aller Menschen erweist es sich als günstig, dass die junge Frau, die im deutschen Kaiserreich geboren wurde, vormals in ihrer Heimat als unliebsamer Freigeist galt.
Doch jedes noch so fortschrittliche Denken bewahrt sie nicht vor dem vernichtenden Zwiespalt, zwei Brüder gleichzeitig aus tiefstem Herzen zu lieben.
Contentwarnung(Achtung, enthält Spoiler)
Bevor du in die Geschichte eintauchst, möchte ich dir anheimgeben, dass das zentrale Thema zwar primär eine Liebesgeschichte in einer utopischen Welt ist, dennoch kommen (gewaltsamer) Tod sowie eine furchtbare Naturkatastrophe vor.
Sehr empfindsame Personen sollten gegebenenfalls von der Lektüre absehen.
Christina Marie Huhn
Kántarellas Lichtgestalten
Die Erinnerung ist ein Fenster,durch das ich dich sehen kann,wann immer ich will.
Für meinen Dad Hellmut.Ich vermisse dich.
© 2024 Christina Marie Huhn
Website: www.christina-marie-huhn.de
Korrektorat: Claudia Fluor, www.schreib-weise.ch Coverdesign und Umschlaggestaltung: Florin Sayer-Gabor, www.100covers4you.com, unter Verwendung von Grafiken von Adobe Stock: Michalsanca, Adidesigner23
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Viviane
Karin Mehrendt: Reisebericht
Prolog
Stolz von Preußen
Sturmnacht
Apfelsinen
Nächtliche Fahrt
Garten
Geschichten
Gesellschaft
Aën-Sangaa
Perspektivwechsel
Brüder
Ahnen
Aufgaben
Sternwarte
Heilende Hände
Erwachen
Freunde
Vorbereitungen
Feiertage
Fischmesser
Entdeckungen
Sonnenwende
Interim
Abschied
Schattenseiten
Zerrissenheit
Dunkelheit
Träume
Stillstand
Aufruhr
Gerechtigkeit
Endzeit
Sintflut
Ankunft
Epilog
Viviane
Nachwort
Bonusgeschichten
Anschein und Wahrheit
Magischer Moment
Ein dominanter Abschied
Knecht Ruprecht
Seife
Leipziger Kulturschock
Kántarellas Lichtgestalten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Viviane
Leipziger Kulturschock
Kántarellas Lichtgestalten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
Viviane
Nebel, so weit das Auge reicht, nur Nebel. Ich liege im Bett, wohlig in die warme Decke geschmiegt, bin zu faul zum Aufstehen, blinzle träge aus dem Fenster.
Die alten Holzfenster im Häuschen meiner Oma wirken heimelig. Gemütlich. Hinter dem Fensterkreuz wabert die Außenwelt milchig, weißlich-grau, halb verdeckt von der altmodischen Blümchengardine.
Ich greife nach meinem Mobiltelefon auf dem Nachttisch und schaue auf das Display. Es ist 9 Uhr 30. Sicher ist meine Mutter längst außer Haus. Ich genieße diese Phase nach dem Abitur. Mir bleiben ein paar Wochen, bevor das erste Semester an der Universität in Erfurt beginnen wird. Mein Aushilfsjob als Kellnerin in einer kleinen Pizzeria lässt mir viel Zeit, um auszuschlafen und mich auf den Umzug in die Universitätsstadt vorzubereiten. Heute Abend habe ich frei und spiele mit dem Gedanken, das Straßenfest in der Nachbarschaft zu besuchen.
Träge wälze ich mich aus dem Bett und schlurfe ins Badezimmer. Das kalte Wasser aus dem Wasserhahn, das ich mir ins Gesicht schöpfe, erfrischt mich. Nach dem Frühstück schlendere ich im Haus umher. Ganz in Bad Godesberg habe ich mich noch nicht eingelebt. Omi ist vor drei Monaten verstorben und Mom ist froh gewesen, keine Miete mehr zahlen zu müssen. Also sind wir kurzerhand aus unserer Mietwohnung in Troisdorf in das nunmehr verwaiste Häuschen eingezogen.
Für mich ist es ohnehin fast egal, da ich bald studieren werde. Mein Studienplatz an der Universität Erfurt liegt weit weg von zu Hause und mir bangt vor der Herausforderung, den geliebten Rhein und meinen Freundeskreis zu verlassen. Dafür winken neue Bekanntschaften mit Menschen, die nicht nur aus anderen Bundesländern, sondern auch aus fernen Staaten stammen. Dem künftigen Kontakt mit vielen fremden Kulturen sehe ich mit Neugierde und Vorfreude entgegen.
Mein zielloses Wandern durch das stille Haus führt mich nach oben. Auf der letzten Stufe zum zweiten Stockwerk stolpere ich über den Treppenläufer und fange mich an der Kommode neben der Tür zu Omis ehemaligem Schlafzimmer ab.
Ich schaue die geschlossene Tür an. Lange bin ich nicht mehr in diesem Raum gewesen. Omi war alt und wirkte gebrechlich. Dennoch hat mich ihr Tod bestürzt. Ich denke, ich habe ihn bislang nicht wirklich verarbeitet.
Vorsichtig und sachte drücke ich die Klinke herunter. Die Tür gleitet auf. Ich muss schmunzeln – schließlich bin ich allein im Haus. Warum verhalte ich mich so leise?
Ich trete ein. Der Schafwollteppich schmiegt sich unter den Haussocken an meine Füße. Ich habe das Gefühl einzusinken. Es riecht leicht süßlich, zugleich herb, ein bisschen wie im Wald. Ich mag den Geruch. Er erinnert mich an meine Kindheit, an glückliche Stunden, die ich hier im Haus bei den Großeltern verbracht habe.
Mein Blick fällt zuerst auf das Fenster. Auch wenn es heute neblig ist, kann ich die Krone des Kastanienbaums im Garten sehr gut sehen. Seine Blätter reichen bis fast an die Scheibe.
Das Zimmer selbst wirkt aufgeräumt. Auf Omis Bett liegt eine Tagesdecke mit einem Muster aus großen, orangeroten Blumen. Neben dem Bett steht der Nachttisch, gekrönt von einer Lampe mit weißem, blütenförmigem Glasschirm und goldfarbenem Fuß. Darunter ist ein Spitzendeckchen drapiert. Ich muss über das Klischee lächeln, das hier in Vollendung erfüllt wirkt.
In der Schublade des Nachttischchens hatte Omi früher Schokolade. Ich erinnere mich, wie ich sie als Kind einmal nach dem Warum gefragt habe. Dies sei sicherlich ungesund für die Zähne? Omi lachte damals, strich mir übers Haar und erklärte, dass sie manchmal schlecht träume und daher einen Trost brauche.
Ob immer noch Schokolade dort liegt? Zögernd strecke ich die Hand aus, denke gleichzeitig: Viviane, was bis du für ein Feigling.
Die Schublade lässt sich gut öffnen. Ein leichter Seifenduft steigt auf. Schokolade liegt zwar nicht in der Schublade, doch ein langer Schlüssel befindet sich gleich vorn. Säuberlich daran befestigt, hängt ein Schildchen mit der Aufschrift »Truhe Dachboden« in feiner Handschrift in veraltetem Stil. Ich nehme den Schlüssel an mich. Er ist schwarz und fühlt sich recht schwer und kühl an.
Truhe Dachboden?
Ich habe heute keine Termine und beschließe nachzusehen, was darin sein mag. Vielleicht finde ich etwas, das mir in Erfurt nützlich sein kann, wie das Lederetui für meine Schulhefte, das mir Omi im vorletzten Schuljahr geschenkt hat. Oder ein Kleid aus Omis Jugend für den nächsten Karneval?
Fast aufgeregt hole ich den Stock mit dem Haken, um die Klappe zum Speicher zu öffnen. Nachdem ich die Leiter heruntergezogen habe, klettere ich hinauf.
Staubig.
Das ist mein erster Gedanke. Und schummrig obendrein. Durch die schmalen Dachfenster dringt kaum Licht herein, zumal es heute recht trüb ist.
Wo mag diese Truhe sein? Ein paar Pappkisten stehen zuvorderst. Die sind es wohl kaum. Eine Pappkiste mit Schlüssel – das wäre mir neu. Ein leichtes Grinsen umspielt bei diesem Gedanken meine Mundwinkel.
Ich taste mich in dem spärlichen Licht um den Stapel herum und – richtig – da steht eine Truhe. Sie schaut aus, als wäre sie recht alt. Sie ist aus Holzbrettern gefertigt, mit Eisenbanden und einem eisernen Vorhängeschloss, das genauso altmodisch ausschaut wie der Schlüssel, den ich in der Hand habe. Ich bin sicher, das Ding ist selbst in leerem Zustand mindestens so schwer wie ich selbst.
Halb spähe, halb fühle ich nach dem Schlüsselloch und schiebe den Schlüssel hinein. Zwar passt er, das Drehen hingegen fällt extrem schwer. Ehrgeiz packt mich und ich strenge mich an. Es klackt. Das Schloss öffnet sich. Ich ziehe es aus der Öse, die den Truhendeckel mit dem Korpus verbindet, und klappe die Truhe auf. Es knarrt, dann kippt der Deckel nach hinten und knallt mit einem dumpfen Geräusch gegen die Truhenwand. Eine Staubwolke stiebt auf.
Warum hatte Omi den Schlüssel fast griffbereit, wenn diese Truhe dermaßen verstaubt ist? Womöglich wollte sie danach sehen und hat es nicht mehr geschafft. Der Gedanke macht mich traurig.
Die Neugier ist stärker als die Trauer. Kaum dass sich die Staubwolke gesenkt hat, beuge ich mich über die Truhe und blicke ins Innere.
Ist das dunkel.
Viel scheint allerdings nicht darin zu liegen. Ich taste in den Schatten hinein. Ein eckiges, hartes Objekt stößt gegen meine Finger. Ich hebe es heraus. Es handelt sich um eine alte Fotografie hinter verstaubtem Glas. Eine flache Schnitzerei, die stilisierte Pfingstrosen darstellt, schmückt den hölzernen Rahmen. Ich lege das Bild beiseite und krame weiter.
Der nächste Gegenstand fühlt sich weicher an. Er ist dicker und viel schwerer als das Foto und rutscht mir aus den Fingern. Mit einem dumpfen Laut plumpst er in die Truhe zurück. Ich angle erneut danach. Er entpuppt sich als ein in Leder gebundenes Buch. Auch dieses lege ich neben mich auf den Boden.
Der restliche Inhalt der Truhe erweist sich als für mich enttäuschend, besteht er doch lediglich aus Wäsche – weiße Laken, weiße Bettbezüge und Kopfkissenbezüge, alles säuberlich gefaltet und rein von der Optik her schon uralt. Es erscheint mir beinahe grotesk – neues Bettzeug, das anscheinend niemand jemals benutzt hat, und nun liegt es hier herum.
Ich schließe die Truhe und lasse das Schloss mit Schlüssel daneben liegen. Das Foto und das Buch nehme ich mit mir.
Nachdem ich beides abgestaubt habe, schaue ich mir das Bild im Licht meines Stubenfensters genauer an. Es zeigt eine junge Frau, etwa in meinem Alter, in einem hochgeschlossenen, langen Kleid mit Spitzenkragen und Hochsteckfrisur. Die Haare könnten kastanienbraun gewesen sein, so wie mein eigener Schopf. Bei intensiverem Hinsehen scheinen einige Locken hartnäckig der Friseurkunst widerstanden zu haben. Wie zarte Reiser ragen sie heraus und geben der Frau einen Hauch von Lebendigkeit in der ansonsten stocksteifen Pose.
Ich besinne mich, dass man damals Fotoplatten benutzte. Diese mussten verhältnismäßig lange belichtet werden. Wahrscheinlich wirken die Menschen deshalb auf diesen Bildern häufig so formell.
Die Gesichtsform der jungen Frau ist eine Mischung aus herzförmig und weichem Oval, der Mund voll und eher breit, dafür die Nase klein und zierlich. Die Augen sind groß und rund, möglicherweise so grün wie meine, darüber die Augenbrauen fein, dabei in gefälligem Schwung. Ob sie Sommersprossen hat, wie ich selbst welche habe? Dies kann ich leider zwischen all den Sepiatönen nicht so gut erkennen. Ich denke, dass das Bild über hundert Jahre alt sein muss.
Insgesamt … Ja … Ich könnte ihr sehr ähnlich sehen, kleidete und frisierte ich mich in diesem Stil. War sie eine Ahnherrin?
Ich will die Fotografie auf dem Nachttisch platzieren, habe aber übersehen, dass dort mein Telefon liegt. Auf der unebenen Fläche kippt der Bilderrahmen und fällt zu Boden. Zwar landet er weich genug auf dem Teppich, sodass die gläserne Abdeckung heil bleibt, doch trennen sich Glas und Rahmen und der Pappkarton mit dem Foto rutscht heraus.
»Verflixt!«, murmle ich ungehalten und hebe die Teile auf.
Auf der Rückseite des Bildes sehe ich die Prägung mit dem Fotografennamen, die Jahreszahl 1906 und den Vermerk »Die Platte bleibt für Nachbestellungen aufbewahrt«. Ich muss schmunzeln. Angenommen, das Geschäft Hermann Uhlig, Photographie Atelier in Chemnitz gäbe es noch und ich käme herein und bäte um die Nachbestellung …
Chemnitz. Ich erinnere mich flüchtig, dass die Familie meiner Omi dort vor dem Zweiten Weltkrieg ihre Wurzeln hatte. Durch die Fliegerbomben der Alliierten ist das Haus völlig zerstört worden und sie haben sich in den Kriegswirren zu einem Onkel nach Bonn durchgeschlagen. Omi war damals ein Kind, vier oder fünf Jahre alt, und hatte nur noch bruchstückhafte Erinnerungen daran.
Unter der Inschrift des Fotografen ist mit Feder und Tusche etwas Handgeschriebenes zu sehen, leider in deutscher Schreibschrift.
steht da.
Gab es da nicht mal eine App zu Schriftarten? Mein kluges Mobiltelefon muss mir hier weiterhelfen. Ein bisschen kurios fühle ich mich – ein Bild von 1906 auf dem Schoß und einen Minicomputer aus dem Jetzt in der Hand.
Die Suchmaschine liefert mir das gewünschte Ergebnis. Ein wenig rätseln muss ich, doch dann bin ich sicher, dass da »Karin Mehrendt« steht.
Zufrieden setze ich das Bild wieder in den Rahmen ein und stelle ihn, dieses Mal ohne Panne, auf den Nachttisch. Nun widme ich mich dem Monstrum aus Leder. Die Seiten sind gewellt. Der Deckel will sich zuerst gar nicht öffnen lassen. Vorsichtig, ganz vorsichtig, löse ich ihn.
Vergilbtes Papier, das brüchig wirkt, offenbart sich meinem Blick.
Schon wieder diese alte Handschrift, denke ich widerwillig.
Drei Wörter stehen auf der ersten Seite. Die ersten beiden kann ich schnell entziffern, denn sie sind die gleichen wie auf der Fotorückseite: »Karin Mehrendt«.
Nach meinen computerunterstützten Entzifferungskünsten erfahre ich, dass das dritte Wort nüchtern »Reisebericht« lautet.
Welch ein interessanter Fund, geht es mir durch den Sinn.
Hier habe ich einen handgeschriebenen Reisebericht mitsamt einem Foto der Person, die diesen verfasst hat, und das alles vermutlich aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Das Einzige, was mich regelrecht abschreckt, ist das Buchstabieren der ungewohnten Schrift. Hieroglyphen oder chinesische Schriftzeichen könnten im Moment auch nicht schlimmer sein.
Ich denke daran zurück, wie ich im Alter von elf Jahren unbedingt das Nibelungenlied lesen wollte. In Omis Bücherschrank stehen einige antike Bücher; gleich im obersten Regal thronen die Bände eines Konversationslexikons aus dem Jahr 1892 in Goldauflage. Darauf war Omi immer sehr stolz, besonders auf die Goldauflage. Ich erinnere mich an meine Fingerkuppe, die golden glänzte, wenn ich als Kind heimlich über die feinen Linien im Innendeckel dieser Bücher strich.
Ich entsinne mich an jenen speziellen Duft, der mir heute noch aus dem Bücherschrank entgegenwabert, wenn ich ihn öffne: herb, holzig, zugleich leicht süß, ähnlich süß wie der Geruch im Schlafzimmer meiner Omi. Ich bin froh, dass Mutter den Bücherschrank auf jeden Fall behalten will.
Ein anderes Buch namens Götter und Helden findet sich gleichfalls in dem Schrank. Es trägt die handschriftliche Widmung »Meinem Kollegen Heinrich Schwarz zur Hochzeit, September 1934«. Darin war das Nibelungenlied enthalten – in deutscher Druckschrift. Die ersten Seiten fielen mir schwer, dennoch habe ich mich damals durchgekämpft. Nachdem ich das ›s‹ mitten im Wort vom ›f‹ auseinanderhalten konnte, ging es auch recht gut.
Es wäre doch gelacht, wenn ich mich nicht mit gleichem Erfolg durch diesen handgeschriebenen Wust kämpfen kann.
Jetzt will ich mich der Lektüre widmen, stelle eine Flasche Wasser und eine Tüte Kekse bereit, lege mich bequem auf den Bauch. Die Welt außerhalb des Hauses versinkt immer noch im Nebel. Es kommt mir vor, als ob das Haus eine Insel sei, einsam und still und abgeschieden. Die Straßengeräusche von draußen wirken gedämpft, fast unwirklich.
Und ich selbst versinke in der Geschichte, einer unglaublichen Geschichte, die mich in ihren Bann zieht und mich das Gefühl von Raum und Zeit vergessen lässt.
Karin Mehrendt
Reisebericht
Prolog
Wo fange ich an?
Ich vertraue diesem Buch meine Erlebnisse an, die so aberwitzig sind, dass kein Mensch mir Glauben schenken möchte. Das Einzige, was man mir glaubt, ist das, was in der Zeitung stand:
Dass ich im April 1906 während der Überfahrt in die Kolonie Deutsch-Samoa bei einem Sturm mitten im Indischen Ozean über Bord ging und erst ein gutes Jahr später, im Juli 1907, nach einem Seebeben an der südindischen Küste aufgefunden wurde.
Ich schreibe, um mich zu erinnern und gleichzeitig zu vergessen.
Stolz von Preußen
Wie aufgeregt war ich, als ich die Einladung nach Übersee in der Hand hielt. Vorangegangen war ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen meinem Vater und Onkel Carl, der mit seiner Ehefrau und seinen drei kleinen Kindern das Glück in der Ferne versuchen wollte.
Nun wurde eine zuverlässige Gouvernante gesucht und ich bat Mutter und Vater voller Sehnsucht, mir die weite Reise zu erlauben, denn vor kurzem hatte ich mein Lehrerinnenseminar abgeschlossen, nachdem ich die höhere Töchterschule mit besten Zensuren verlassen hatte. Da mein Bruder Paul nach Deutsch-Samoa eingeladen worden war (ein tüchtiger Verwalter, dem man Vertrauen entgegenbrachte, war dem Onkel willkommen), nagte das Fernweh mit Macht an mir.
Mit Engelszungen redete ich auf die Eltern ein, mich mit ihm zu schicken, am Ende mit Erfolg, obgleich ich wusste, dass es ihnen nicht wirklich recht war. Galt ich doch als der Freigeist in der Familie, wollten sie dies einerseits nicht zusätzlich nähren, merkten aber auf der anderen Seite, dass ich in Chemnitz nicht stillhalten würde. So hatten sie mich mehrfach ermahnt und auch bestraft, wenn sie beispielsweise Schriften des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins in meinem Besitz fanden.
Ich vermutete, es war tatsächlich die Furcht vor zukünftigem Gerede der Nachbarn, die meine Eltern am Ende veranlasste, mich in die Ferne ziehen zu lassen.
Am Tag der Abreise war mir dennoch bange. Zusammen mit Paul bestieg ich die Eisenbahn nach Hamburg, im Gepäck zwei sperrige Überseekoffer, die nicht nur Garderobe, sondern auch eine Menge meiner geliebten Bücher enthielten, von Fontane bis Verne.
Die Lokomotive erschien mir als ein mächtiges Ungetüm mit gewaltigem Leib. Wie zwergenhaft ich mich fühlte! Und wie viel größer das Dampfschiff sein musste, das Paul und mich in einer mehrwöchigen Reise nach Übersee bringen sollte.
Unsere Eltern hatten uns zum Bahnhof geleitet. Der Abschied war tränenreich, zumindest der meiner Mutter und der meinige, waren wir uns schließlich nicht sicher, wann und ob wir uns wiedersehen würden. Selbst Vater und Paul rangen darum, ihre Gefühle zu verbergen, obschon sie sich Mühe gaben, stoisch und würdevoll zu bleiben.
Noch heute steht mir das Bild der beiden winkenden Gestalten vor Augen, die immer kleiner wurden, während der Zug den Bahnhof verließ. Mutter, die das gute, graue Kleid unter ihrem Mantel trug und ihre zerlesene Lutherbibel an die Brust presste, und Vater mit seinem prächtigen Kaiser-Wilhelm-Bart im schwarzen Sonntagsanzug und dem steifen Homburger Hut.
Paul war nie ein Mensch vieler Worte gewesen. So hatte ich Muße, aus dem Fenster zu blicken und die vorbeiziehende Landschaft im zarten Frühlingslicht zu betrachten.
Ich sorgte mich, dass ich seekrank werden würde. In einem Zeitungsartikel hatte ich gelesen, es sei um das Wohlbefinden besser bestellt, halte man sich an Deck auf. Verbleibe man unter Deck, solle man mit der Übelkeit mehr zu kämpfen haben. Und natürlich machte ich mir viele Gedanken über Deutsch-Samoa. Wie kultiviert man dort wohl leben mochte? Ob die Menschen Deutsch sprachen oder wenigstens Französisch, was ich als wichtige Handelssprache in meinen Studien erlernt hatte? Hoffentlich war es nicht Englisch, denn diese Sprache beherrschte ich lediglich in Grundzügen. Ob ich mit dem Klima zurechtkäme? Und ob ich Heimweh haben würde nach meiner Familie?
Der Hamburger Hafen überwältigte mich völlig. Die Luft roch hier gänzlich anders als zu Hause. Eine steife Brise wehte aus Nordwesten und ich glaubte, den salzigen Geruch der Nordsee riechen zu können.
Überall sah ich Menschen: schwer arbeitende Menschen, geschäftige Menschen, reisende Menschen. Und ringsumher wurde gerufen. Das dröhnende Tuten der Schiffshörner lag über alledem, fast wie die Hülle einer Käseglocke. Lastkräne schwenkten gewaltige Kisten auf das Deck der Schiffe oder hoben Frachtgut an Land. Fässer, Ballen und Taue lagen scheinbar wüst einher, dennoch musste das Auf- und Abladen der Lastenfuhrwerke einer Ordnung folgen, die sich mir nicht sofort erschloss.
Vielleicht, dachte ich, ist es wie bei einem Ameisenhaufen. Dem unerfahrenen Betrachter offenbart sich der Sinn nicht, doch alles hat Struktur.
Die Stolz von Preußen überragte uns haushoch. Zwei riesige Schornsteine bildeten den Blickfang. In der Hauptsache war das Schiff als Frachtschiff konzipiert, jedoch verfügte es auch über einige Kabinen zur Beförderung von Passagieren.
Nachdem Paul und ich unsere einfache (aber zu meiner Freude reinliche) Kabine bezogen hatten, brauchten wir nicht mehr lange zu warten. Das Schiffshorn erscholl satt und laut, die Dampfmaschine wummerte tief und schwerfällig legte das Gefährt ab. Paul und ich weilten an Deck und blickten auf die Küste unseres Heimatlandes, die nach und nach in der Ferne verschwand. In mir rang Wehmut mit Abenteuerlust. Es war eine seltsame Mischung.
Außer uns befanden sich vier weitere Passagiere an Bord, von denen allerdings niemand die gesamte Passage bis nach Deutsch-Samoa unternahm. Zwei Handelsreisende aus Hannover planten, bis Kapstadt zu reisen, wo sie auf einen Dampfmaschinenkontrakt hofften. Der junge Arzt aus Berlin wollte sein Glück in Kamerun versuchen. Ein Mitreisender, ein älterer, betuchter Herr, hatte im Sinn, ein weiteres Stück mit uns zu fahren. Er hatte von der landschaftlichen Schönheit und dem warmen Klima der Südsee vernommen und gedachte, seine vom Rheuma geplagten Gliedmaßen von der eher kühlen und feuchten Wetterlage des Sauerlandes zu befreien. All diese Herren sah ich nur zu den Mahlzeiten und ihre Absichten offenbarten sie in der zu diesem Anlass gehaltenen Konversation.
Mit der Besatzung hatte ich kaum Kontakt, was mir durchaus lieb war. Ich fühlte mich als einzige Frau an Bord wie ein wunderliches Tier. Zumindest kam es mir vor, dass man mich so ansähe. Ich dankte der Fügung, dass mein Magen keine Probleme mit dem Schwanken und Schlingern unseres Schiffes hatte, sodass ich bequem in der Kabine bleiben und mich dem Studium meiner Bücher widmen konnte.
Paul verbrachte mehr Zeit an Deck, stand dort mit seinem Feldstecher und schaute auf den endlos erscheinenden Horizont. Er unterhielt sich weitaus häufiger mit den Mitreisenden, als es für mich selbst schicklich war. Wenn ich mich auf das Deck hinauswagte, hüllte ich mich in meinen Reiseschal und zurrte die Hutschnur fest unter das Kinn, damit der Wind mir meine Kopfbedeckung nicht entreißen konnte.
Auf den Stopps unserer Route zog ich es ebenfalls vor, an Bord zu bleiben, auch wenn ich mir das Treiben in den fremden Häfen voller Faszination vom Schiff aus ansah. Wie vielfältig diese Menschen alle ausschauten, in jedem Hafen anders, und mir schien es, dass die Gesichter der Leute immer dunkler wurden. Hatten die Portugiesen in Lissabon schon recht sonnengebräunt auf mich gewirkt, staunte ich umso mehr in Lomé in Togoland und in der Kamerunstadt Duala.
Der über dem Hafen von Kapstadt thronende Tafelberg war eine großartige Augenweide. Gern wäre ich dort gewandert! Paul hingegen lachte mich aus und murmelte etwas von ›Sonnenstich‹ und ›Tropenkrankheit‹. Ich sah ihn an und dachte, dass er mit seinem schütteren, blonden Haar und dem rosigen Teint in der Tat in der südlichen Sonne, die hier gnadenlos herniederbrannte, auf sich achten müsste. Aber in Deutsch Samoa wäre es sicher kein bisschen besser.
Wie viel leichter es Männer haben, dachte ich und grollte.
Egal, was Paul tun wollte, er machte es einfach. Er musste nicht vorher um Erlaubnis bitten. Manchmal wünschte ich mir, frei wie ein Mann zu sein, wünschte mir, Hosen zu tragen und nicht diese lästigen, langen Röcke. Kurzes Haar, sodass Kämmen und Frisieren wegfielen, war sehr verlockend. Ich wünschte mir, Pfeife zu rauchen und ab und an auch einmal fluchen zu dürfen, ohne böse Blicke zu ernten.
Ich tröstete mich, dass dieses Abenteuer, das ich erlebte, den wenigsten Frauen meiner Klasse zugutekam. Die meisten meiner Freundinnen hatten einen Bräutigam. Josefine und Marie waren schon verheiratet und Fanny hatte bereits ihr erstes Kind zur Welt gebracht.
Während ich immer noch zwischen Groll und sinnlosem Wunschdenken schwankte, legte die Stolz von Preußen aus Kapstadt ab. Nach einem letzten Ladestopp sollte die lange Strecke über den weiten Ozean bis Singapur in Angriff genommen werden.
Ich hoffte, dass das Wetter uns hold sei, denn man sprach von gut zehn Tagen auf offener See. Leider erhörte keine höhere Macht meine Bitten, denn sechs Tage später verdüsterte sich das Licht und schwere Wolken erfüllten den Himmel. Ich spürte, wie das Schiff tapfer seinen Weg durch das zunehmend unruhige Wasser stampfte.
Von Deck ertönten gedämpfte Rufe, die immer aufgeregter wirkten. Der Schiffsrumpf ächzte bedenklich. Über Stunden saßen Paul und ich in unserer Kabine und kämpften mit aufkommender Übelkeit. Das Getöse wurde stetig ärger, das Geschrei, das wir vernahmen, wurde hektischer. Ob wir überhaupt noch auf Kurs waren?
Lesen konnte ich nicht mehr. Dazu schwankte es viel zu stark. Paul wirkte grünlich im Gesicht. Als es Zeit zum Abendessen war, hatte keiner von uns beiden Hunger.
»Ich werde uns entschuldigen lassen«, sagte Paul. Er zog seinen schweren Wettermantel an, griff die bauchige Schwimmweste aus dem Kabinenschrank und schaute sie kurz an. Wie zu sich selbst gewandt, schüttelte er den Kopf. »Die brauche ich wohl doch nicht.« Er lächelte, legte die Weste auf den Waschtisch und verließ die Kabine.
Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
Sturmnacht
Ich wartete auf Paul, doch er kam lange Zeit nicht zurück. Die Luft in der Kabine wurde zunehmend stickiger. Mir war mulmig. Gern hätte ich das Bullauge geöffnet, bloß konnte ich dies nicht allein, denn der Hebel saß zu fest. Davon abgesehen klatschten die Wellen ständig dagegen. Ich krümmte mich auf der Pritsche zusammen, lockerte mein Mieder, um besser atmen zu können. Nichts half.
Ich brauche frische Luft.
Ich fuhr in die festen Schuhe, ergriff mein Tuch, wickelte mich ein. (Nicht, dass das bisschen Stoff Nässe wirkungsvoll abgehalten hätte.) Neben mir auf dem Waschtisch lag die Schwimmweste.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, schlich sich der alte Spruch in meine Gedanken.
Ich legte die Weste an, wenngleich ich die Riemen nicht mit Sorgfalt festzurrte.
Froh war ich, dass die Mannschaft vollumfänglich mit dem unbilligen Wetter beschäftigt war. Niemand hielt mich zurück, als ich an Deck taumelte.
Das Schiff buckelte förmlich unter meinen Füßen. Um mich herum war es nachtschwarz, obwohl es noch gar nicht spät war. Der Wind schlug mir ins Gesicht wie eine Faust. Zum Glück hatte ich auf den Hut verzichtet, denn dieser wäre mir sicher in dem Augenblick entrissen worden.
Ich klammerte mich am Treppengeländer fest. Der Wind zerrte und riss an meiner Kleidung, Wasser peitschte auf mich ein.
Mist!
Frisch war die Luft – das war auch alles. Sofern ich überhaupt Luft bekam. Es schien mir, als ob deutlich mehr Wasser als Luft herangetragen würde. Meine Kleidung war längst durchnässt, das Deck schlüpfrig und glatt, sodass mein Stand sehr unsicher war.
Nur ein paar Atemzüge, dann gehe ich wieder hinab.
Eigentlich hatte ich von diesem Ausflug längst genug. Der heftige Wind toste in meinen Ohren. Ich starrte ängstlich und verkrampft in das unfreundliche Schwarz der Sturmnacht, das plötzlich vom grellen, zuckenden Licht eines Blitzes erhellt wurde. Für einen Sekundenbruchteil sah ich das aufgewühlte Meer mit den hohen, unbändigen Wogen. Es machte mir Angst.
Just in diesem Moment bäumte das Schiff sich regelrecht auf. Ich verlor den Halt und stürzte weg vom Treppenaufgang.
Fluchend richtete ich mich auf. Das Gute an dem Sturm war, dass mich niemand gehört hatte, auch wenn meine Worte definitiv nicht salonfähig gewesen waren. Der Gedankengang wollte mir fast an Galgenhumor grenzen.
Ein Schwall Wasser rang mich nieder und hinterließ mich auf dem Rücken liegend wie ein Käfer. Ich kämpfte mich zurück auf die Füße und versuchte, halb kriechend, halb stolpernd zur Treppe zurückzugelangen. Ein neues, heftiges Schlingern und schon glitt ich wieder davon.
Himmel, wo ist bloß diese Treppe?
Panik begann sich in meinen Eingeweiden breitzumachen. Wieder raffte ich mich hoch, mittlerweile patschnass und frierend.
Indischer Ozean, schnaubte ich im Stillen, Indien ist ein warmes Land. Warm ist das hier wirklich nicht!
Wo war die Treppe, wo meine relative Sicherheit? Ich kniete in der Nässe und versuchte, mich zu orientieren. Dunkelheit, sprühender Schaum und der peitschende Wind machten mir dies unmöglich, war ich doch nicht im Geringsten darin geübt. Konnte ich mich irgendwo verkriechen, vielleicht in einem der Beiboote? Ich musste lediglich die Reling finden, dann würde ich mich daran entlangtasten.
Wie dumm diese Idee tatsächlich war, merkte ich, als ich einen gewaltigen Schlag im Rücken spürte. Ich wurde von den Füßen gehoben und eine Woge riss mich, halb fliegend, halb schwimmend, über Bord.
Ein Hexenkessel erfasste mich. Ich verlor das Gefühl für Zeit und Raum und nach Kurzem auch das Gefühl von Kälte.
Ich huste, spuckte, keuchte, betete, weinte, jammerte, fluchte. Das Wasser zerrte an meinem langen Rock, strudelte um meine Beine. Mein Haar pappte wirr im Gesicht.
Das Einzige, was zählte, war zu atmen. Ich klammerte mich an die Schwimmweste, die wie durch ein Wunder an mir geblieben war, obgleich ich sie schlampig angelegt hatte. Ohne sie wäre ich längst mausetot, das war mir mit eisiger Gewissheit klar.
Wie lange ich verzweifelt um mein Leben kämpfte, weiß ich nicht. Es kam der Punkt, an dem meine Glieder bleischwer vor Müdigkeit wurden, ich fühlte, wie eine tiefe Erschöpfung von mir Besitz ergriff. Mein Keuchen wurde langsamer, mein Klammern erschlaffte, meine Beine erlahmten.
Atmen, flehte ich verzweifelt an mich selbst gerichtet, du musst atmen.
Ich atmete, hustete schwach, schnappte halbherzig nach Luft.
Und dann weiß ich nichts mehr.
Apfelsinen
Durst.
Langsam rückte das Wort in mein Bewusstsein vor. Im ersten Moment dachte ich, ich läge zu Hause im Bett. Doch schnell spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Das Licht, das durch meine Lider drang, war viel zu grell. Auch fühlte ich meine Kleidung steif, einem Brett gleich, an meiner Haut liegen. Ein klobiger Gegenstand drückte in meinen unteren Rücken.
Ach ja, natürlich, die Schwimmweste.
Dann brach die Erinnerung mit Macht über mich herein. Die Schiffsreise und der Sturm. Und die Woge, die mich von Deck gezerrt hatte. Erschrocken riss ich die Augen auf, nur um sie gleich wieder zu schließen, denn sie waren trocken und das gleißende Sonnenlicht blendete mich.
Ich richtete mich zum Sitzen auf, öffnete die Augen diesmal nur einen Spaltbreit und beschirmte sie mit einer Hand. Verwundert sah ich mich um.
Wo war ich hier? Es sah aus wie ein Strand.
Es ist ein Strand. Ich bin an einem Strand.
Ich hatte überlebt. Unsägliche Dankbarkeit brandete in mir auf.
Die Sonne stand ein Stück über dem Horizont und leuchtete warm und kraftvoll von einem wolkenlosen Himmel herab. Ich nahm an, dass jetzt Vormittag war. Etwa fünf Meter neben mir lag der Meeressaum, ruhig, fast völlig still. Eine sachte Brandung spülte kaum hörbar über den feinen Ufersand.
Wie absonderlich, erst benimmt sich die See wie ein Monstrum und dann ist sie so harmlos und friedlich wie ein Schoßtier.
Der brennende Durst machte sich noch stärker bemerkbar. Unbeholfen schwankend richtete ich mich auf. Meine Beine waren gummihaft und weich. Egal. Ich musste weg vom Strand, um einen Wasserlauf oder Ähnliches zu finden, sodass ich den quälenden Durst löschen konnte. Ich wandte mich vom Meer ab und blickte in ein grünes Dickicht. Hoffentlich gab es hier einen Fluss oder Bach. Ich streifte die Schwimmweste ab und nahm sie in die Hand. Die ersten Schritte waren wacklig. Sie wurden zunehmend stabiler und führten mich in den Schatten der Gewächse. Die vorherrschende Farbe war Grün. Üppiger Bewuchs, der mich an Schachtelhalme erinnerte, ragte mir bis zum Kinn. Einen Steinwurf entfernt wuchsen buschige Palmen, was ich am ruppig wirkenden Stamm und an den Wedeln erkannte. Früchte trugen sie leider nicht.
Schnell merkte ich, dass ich am Strand selbst entlanggehen musste, da das Pflanzenwerk zu dicht war, um mir einen Weg zu bahnen. Ich starrte in beide Richtungen, um auszuloten, welche mir günstiger erschien. Da im Grunde alles gleich aussah, folgte ich der bereits eingeschlagenen Route weiter.
Das Tagesgestirn stieg höher und es wurde wärmer. Scheinbar endlos zog sich der Strand entlang. Ich begann zu schlurfen, meine Kräfte waren am Versiegen.
Aber – halt – was roch ich da? Zart schwebte ein süßlicher Duft aus dem Pflanzengewirr. Ich hatte nichts zu verlieren und folgte im wahrsten Sinne des Wortes meiner Nase, bahnte mir einen Weg durch das dichte Grün. Wenige Meter hinter dem Randbewuchs befanden sich einige Bäume, die rötlich-gelbe Früchte trugen. Am Boden lagen ebenfalls Früchte, einige verrottend und aufgeplatzt. Es waren Apfelsinen!
Fast in Reichweite hing eine reife Frucht über mir. Ich hüpfte empor und griff zu. Das Obst löste sich und lag warm und verheißungsvoll in meiner Hand. Schnell hatte ich die Schale abgerissen und saugte den erquickenden Saft in meine ausgedörrte Kehle. Es war eine unendliche Wohltat. Ich schickte ein stummes Gebet des Dankes zur Bläue des Himmels empor. Dann aß ich reichlich, sodass Durst und Hunger versiegten.
Zum Abschluss steckte ich einige Früchte in meine Rocktaschen und wollte mich wieder dem Strand zuwenden. Bevor ich dies tun konnte, zupfte es an den Bändern der Schwimmweste, die ich immer noch bei mir trug.
Ich erschrak und machte einen unbeholfenen Satz rückwärts. Ein kleines Mädchen mit sonnengebräunter Haut, Grübchen, dunklen Locken und cherubenhaftem Aussehen, in ein gelbes Kleidchen gehüllt, hüpfte aufgeregt direkt vor mir auf und ab. Zwei runde, dunkelbraune Kinderaugen fixierten mich, das Kind sprudelte dazu neugierig klingende Wörter in einer gänzlich unbekannten Sprache hervor.
Ich selbst fand mich sprachlos. Mein Mund öffnete sich. Nur – ein Ton kam nicht heraus.
Die Kleine unternahm einen erneuten Konversationsversuch und plapperte etwas Längeres, für mich ebenso Unverständliches.
»Es tut mir leid. Ich spreche deine Sprache nicht …«, murmelte ich rau.
Der Ruf einer Frauenstimme erscholl plötzlich vom Strand herüber.
Das Mädchen quietschte ein kurzes Wort in meine Richtung. Es sah mich an, umschloss mit seiner zierlichen, warmen Hand vertrauensvoll die meinige und führte mich aus dem Dickicht, geradewegs einer hochgewachsenen, jungen Frau vor die Füße, die einen mit Fischen gefüllten Korb trug. Genau wie meine kleine Begleiterin hatte auch sie eine sonnengebräunte Haut, dunkle Locken, die sie mit einem geflochtenen Band zu einem Zopf gebunden hatte, und dunkelbraune Augen. Sie war in einen Umhang mit grüngrauem Karomuster aus grober Webfaser gehüllt, der bis fast zu den Knöcheln reichte. An den Füßen trug sie Ledersandalen mit langen Riemen. Ebenso aus Leder war der breite Gürtel um ihre Hüfte, in dem ein scharf aussehendes Messer steckte.
Als sie das Mädchen mit mir im Schlepptau sah, ließ sie den Korb fallen. Ein weiterer Ausruf, jetzt mit dem Unterton des Entsetzens, erklang aus ihrem Mund.
Sofort ließ ich die Hand des Kindes los und hob meine Arme, damit die Fremde erkennen konnte, dass ich keine bösen Absichten hegte. Die Schwimmweste, die ich hielt, baumelte zwischen uns einher, während die Apfelsinen meine Rocktaschen gewaltig ausbeulten und nach unten zogen. Ein Außenstehender hätte die Situation gewiss reichlich bizarr empfunden. Ich hingegen kämpfte gegen aufsteigende Panik und zwang mich, stehen zu bleiben und ruhig zu atmen. Ich hatte das Gefühl, meine Lage sei durchaus gefährlich. Ausgerechnet jetzt schossen mir Geschichten über Kannibalen, die angeblich in der Südsee lebten, durch den Kopf.
Das Kind jubilierte derweil unbeschwert in der fremden Sprache und zeigte auf meine Taschen. Die Frau richtete argwöhnisch ein fragendes Wort an mich. Dabei legte sie eine Hand auf den Messergriff und schob mit der anderen das aufgeregt hüpfende Mädchen hinter sich.
»Ich verstehe Sie leider nicht«, brachte ich heraus. Mein Hals war kloßig vor Aufregung. Mir wurde ausgesprochen flau und meine Knie schlotterten.
Die Fremde musterte mich von oben bis unten und schien zu dem Schluss zu kommen, dass ich keine Bedrohung für das Kind oder sie selbst darstellte. Ohne mich aus den Augen zu lassen, klaubte sie ihren Korb auf und gab einen knappen Befehl, der offensichtlich mir galt. Ihr Tonfall enthielt eine unmissverständliche Aufforderung. Sie gestikulierte mit dem Kinn in eine Richtung ins Gebüsch hinein, wo sich bei genauerem Hinsehen ein fast zugewachsener Pfad befand. Anscheinend sollte ich vorangehen.
Wohl war mir damit absolut nicht. Eine bessere Idee hatte ich auch nicht, also stakste ich dem Duo voran.
Wenige Minuten später wurde der Pfad breiter und wirkte hier oft begangen. Während des Marsches plapperte das Mädchen hinter mir aufgeregt auf die Frau ein, die ab und an eher einsilbig antwortete. Zweifellos teilte sie die Begeisterung des Kindes keineswegs.





























