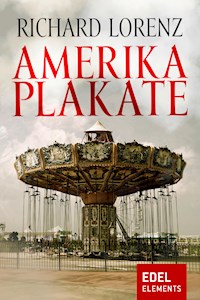1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kinderland
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Am 11. August 1999 schiebt sich der Mond vor die Sonne, ein Schatten fällt auf das Kinderland und macht das Vergessen sichtbar. Die Glut des Bösen entfacht in der Allerheiligennacht ein Fegefeuer der Gerechten. Denn die Zeit der Sühne ist gekommen. Das Weihnachtsbuch von Charles Dickens fest umschlossen, war Leonard in Roberts Bett eingeschlafen und hatte seinen Traum geträumt. »Zeig mir dein Schwänzchen«, hatte der Mann in diesem Traum gemurmelt. Ein Mann, dessen Beine dürr und so schwarz wie faule Zähne waren, Münzen klimperten in seinen geschlossenen Händen. Roberts Mutter stand neben ihm, mit grauen Mäusen auf der Schulter. Leonard blickte an sich herunter und sah, dass er nackt war. Mäuse und Ratten krabbelten an seinen Beinen empor. Mit einem stummen Schrei erwachte er und sah, dass der Morgen dämmerte und dass es schneite. Der letzte Tag im Oktober, vielleicht der letzte Tag in meinem Leben, dachte Leonard. Auf dem Fenstersims saß eine Maus und schien zu nicken. Was genau haben die Einwohner der kleinen Stadt während der Sonnenfinsternis gesehen? Was treibt sie im Hagelsturm der Allerheiligennacht auf die Straßen, den Wahnsinn im Blick? Die Untaten der Vergangenheit erhalten in dieser Nacht ein Gesicht – ein Anblick, den die Kinder von 1986 mehr als alles andere fürchten. Doch ihr Mut ist ungebrochen, denn sie sind nicht allein. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu erfahren und Erlösung zu finden. Die Wahrheit, die die Geister seit jeher flüstern, und die Erlösung, die auch in dieser Nacht nach einem Opfer ruft ... Allerheiligenwunder ist der fünfte und letzte Teil der Mystery Serial Novel Kinderland – tapfer trage fort mein Herz!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Ähnliche
Richard Lorenz
Kinderland
Fünfter Teil
Copyright der eBook-Ausgabe © 2014 bei Hey Publishing GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-95607-009-9
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Besuchen Sie den Autor im Internet:
www.richardlorenz.de
www.facebook.com/richard.lorenz
Richard Lorenz, Kinderland – Teil 5: Allerheiligenwunder
Am 11. August 1999 schiebt sich der Mond vor die Sonne, ein Schatten fällt auf das Kinderland und macht das Vergessen sichtbar. Die Glut des Bösen entfacht in der Allerheiligennacht ein Fegefeuer der Gerechten. Denn die Zeit der Sühne ist gekommen.
Das Weihnachtsbuch von Charles Dickens fest umschlossen, war Leonard in Roberts Bett eingeschlafen und hatte seinen Traum geträumt. »Zeig mir dein Schwänzchen«, hatte der Mann in diesem Traum gemurmelt. Ein Mann, dessen Beine dürr und so schwarz wie faule Zähne waren, Münzen klimperten in seinen geschlossenen Händen. Roberts Mutter stand neben ihm, mit grauen Mäusen auf der Schulter. Leonard blickte zu sich herunter und sah, dass er nackt war. Mäuse und Ratten krabbelten an seinen Beinen empor. Mit einem stummen Schrei erwachte er und sah, dass der Morgen dämmerte und dass es schneite. Der letzte Tag im Oktober, vielleicht der letzte Tag in meinem Leben, dachte Leonard. Auf dem Fenstersims saß eine Maus und schien zu nicken.
Was genau haben die Einwohner der kleinen Stadt während der Sonnenfinsternis gesehen? Was treibt sie im Hagelsturm der Allerheiligennacht auf die Straßen, den Wahnsinn im Blick? Die Untaten der Vergangenheit erhalten in dieser Nacht ein Gesicht – ein Anblick, den die Kinder von 1986 mehr als alles andere fürchten. Doch ihr Mut ist ungebrochen, denn sie sind nicht allein. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu erfahren und Erlösung zu finden. Die Wahrheit, die die Geister seit jeher flüstern, und die Erlösung, die auch in dieser Nacht nach einem Opfer ruft …
31. Oktober 1999
Die Straße der Verlorenen
Um sieben Uhr morgens fiel der erste Schnee. Arik erwachte und fühlte sich benommen, fühlte sich wie von seinem Körper getrennt. Drehte sich zur Seite und übergab sich in den Eimer, den er vor dem Schlafengehen neben das Sofa gestellt hatte. Hinter seinen Augen brannte ein Feuer, und sein Bauch war schmerzhaft angeschwollen. Er quälte sich hoch und bemerkte die Schneespuren am Fenster. Von Schnee hatte er geträumt, von viel Schnee. Schnee, der sein Grab bedeckte, auf ewige Zeit. Mit ihm im Grab seine Schwester, die Augen aufgerissen. Er erbrach sich erneut.
Karla atmete ruhig. Vermutlich hatte er sie vor vier Stunden zum letzten Mal gelagert, aber er konnte sich nicht genau daran erinnern. Er fror und schwitzte zugleich.
»Du musst es durchstehen«, sagte Karla, und er nickte. Sie sagte es, ohne die Lippen zu bewegen, sie sagte es zwischen zwei Herzschlägen, mit seiner eigenen Stimme.
Arik stand auf, wankte, versuchte, nicht umzufallen. Ein Geistergesicht, verzerrt, blickte den Jungen aus dem schmalen Spiegel zwischen den Postern von Donovan und den Bee Gees an. Seine Haut war so gelb wie nass gewordene Spielkreide auf den Straßen. Er würde sterben.
»Nimm von dem Schmerzmittel, aber immer schön vorsichtig. Du weißt ja: All you need is love!«, sagte Karla, und Arik lächelte. »All you need is love« – das hatte Schwester Ruth manchmal gesummt, während sie die Morphinspritze aufgezogen hatte. Wenn Karla einen Dekubitus gehabt hatte, so groß wie eine Handfläche. Jesus Christus, mach die Schmerzen weg, dachte Arik. In seinem Bauch hockte ein Tier, und dieses Tier nagte an seinen Eingeweiden.
Ein säuerlicher Geruch hing in der Luft. Schneeflocken schmolzen an der Fensterscheibe.
In einer der Schreibtischschubladen fand Arik drei noch ungeöffnete Ampullen Morphin, je zehn Milligramm, die sich wie Patronen eines Revolvers in seiner Hand anfühlten. Unten in der Küche betete seine Mutter, und er stellte sich vor, wie sie auf dem schmutzigen Boden kniete, den Kopf in den Nacken gestreckt. Wo sein Vater war, wusste Arik nicht. Letztendlich war es auch egal.
»Herr im Himmel, Herr im Himmel, Jesus! Gottvater!« Die Stimme seiner Mutter wurde heiser.
Zwischen Waschzetteln und leeren Medikamentenschachteln lagen die Einwegspritzen. Arik riss die Verpackung auf, seine Hände zitterten, und einige Tropfen Urin rannen an seinem Oberschenkel herunter. Die Ampulle knackte leise, als er die Spitze abknickte. Helles Kratzen der Kanüle am Glas.
»Wie der Stich einer Wespe im Sommer«, vernahm er Karlas Stimme in seinem Kopf.
Er nickte. Es fühlte sich tatsächlich an wie ein Wespenstich, als die Nadel durch die Jeans in seinen Oberschenkel eindrang. Das Morphin brannte, als hätte er sich heißes Öl injiziert.
»Komm zu mir und schließ die Augen. Gleich ist es vorbei.«
»Ja«, flüsterte Arik, wankte zu Karla und legte sich neben sie ins Bett. Ihre Augen waren halb geöffnet, sie schien ihn anzusehen und ihr Atem roch nach einem frostigen Dezembertag.
Immer leiser werdend die Stimme seiner Mutter aus der Küche, nur noch lose Gebetsfetzen ohne Sinn. Plötzlich roch er frisches Gras, so als läge er in einem Löwenzahnfeld, um den Sommerhimmel und die vorbeiziehenden Wolken zu betrachten. Ein starker und guter Geruch, der die Übelkeit von ihm nahm. Arik schloss die Augen. Er sah Karla beim roten Haus stehen, ihre Haare länger und offen. Sah die Gespenster seiner dunklen Träume, die ihn berührten und seinen Namen flüsterten. Dann waren die Schmerzen fort. Und in dem Moment, als Arik eingeschlafen war, fielen auch Karlas Augen zu.
Magdalena hatte wieder kaum geschlafen, die Nächte in dem fremden Haus durchzogen von unheimlichen Geräuschen. Alfons’ altes Bett war viel zu schmal, und obwohl sie es frisch bezogen hatte, konnte sie immer noch den Staub der letzten Jahre riechen. In den wenigen Schlafphasen weit nach Mitternacht hatte sie wirre Träume erlebt. »Wir sind alle tot. Tot und verfault. So wie du, mein Schatz«, hatte das Mädchen auf dem Stuhl neben dem Bett zu ihr gesagt. Auf der Schulter eine Maus, die sich auf die Hinterbeine gestellt und Magdalena mit mondgelben Augen angestarrt hatte. Ein Mädchen, das Magdalena fremd war. Aufgeplatzt die Haut, getrocknetes Blut in den Haaren. Kleine, augenlose Maden, die aus ihrem Mund in ihren Schoß fielen, während sie sprach. Dann war dieses Mädchen zu einer Frau geworden, zu einer hässlichen Untoten mit Rattenaugen. In diesem Moment war Magdalena aufgewacht, und jetzt, kurz vor halb acht, war dieser Traum bleich geworden, der Stuhl neben dem Bett leer.
Hinter der Dachschrägenwand hörte Magdalena Mäusebeine trippeln. Sie fror, und als sie aus dem Fenster blickte, wusste sie auch weshalb: kinderfaustgroße Schneeflocken fielen vom Himmel. Gott sei Dank hatte sie ihre Kleider angelassen, Jeans, T-Shirt, Pullover und natürlich die Socken. Die Kälte zog durch das Haus, und Magdalena vermutete, dass mindestens eines der Fenster der unteren Räume kaputt war und vermutlich bereits Schnee ins Haus wehte. Sie fragte sich, wohin die Besitzer des Hauses, Alfons Eltern, gegangen waren, ob sie noch lebten oder schon längst tot waren. Das Wetter hatte sich verändert, der Himmel schien so nahe, als könnte man ihn berühren. Magdalena erinnerte sich an ihre Kindheit in einem ähnlichen Haus. Dunkel und verzweigt die Bilder in ihrem Kopf, zerkratzt an der Oberfläche. Verloren die Vergangenheit, die nur aus Fragmenten einer Kindheit bestand. So muss der Scheintod sein, dachte sie sich.
Als sie in ihre Schuhe schlüpfte, stieß sie einen hellen Schrei aus und schreckte zurück. Einen Augenblick lang glaubte sie, eine Maus hätte sich in ihrem rechten Schuh verkrochen, ihre Zehen hatten etwas Fremdes berührt. Sie schüttelte den Schuh aus und zu Boden fiel ein Stück Pappe mit verblichenen Rändern, darauf eine Hexe auf einem Besen mit einer fauchenden Katze auf dem Rücken. Hatte sie nicht schon einmal von dieser Karte gehört, oder hatte sie nur davon geträumt? Magdalena konnte sich nicht daran erinnern. Vermutlich hatten ihr die anderen Kinder damals davon erzählt, vielleicht auf dem Schulhof, im gleichen Atemzug mit jenen Geschichten über das verfluchte Haus auf dem Grabhügel. Geschichten von Murr, der dort oben lag und böse Kinder besuchte, der sie zu sich holte in seinen Sarg. Postkarten aus dem Jenseits würde er schreiben, Hexenkarten – auf einmal fiel es ihr ein.
Nach dem Jahrhundertunwetter hatten die Menschen hier Murr für den Teufel gehalten, vermutlich, weil man immer einen Teufel sucht, wenn der göttliche Himmel schweigt. In Altötting geweihte Wetterkerzen hatten in der Küche gebrannt, während sich Magdalenas Vater mit anderen Männern beriet, ob sie das alte Murr-Haus niederbrennen sollten. Aber sie hatte es bereits damals besser gewusst. Wenngleich Karla ihr ihre eigene schreckliche Wahrheit offenbart hatte, so hatte sie ebenso die Wahrheiten dieser Stadt offenbart. Und bei Gott, Murr war sicher nicht der Teufel gewesen, er nicht. Am Ende war niemand zum Murr-Haus gegangen, auch nicht ihr Vater und seine betrunkenen Freunde, mit denen er sich manches Mal zum Saufen und Kartenspielen traf. Heute wusste Magdalena, dass sie Angst gehabt haben mussten. Zu Recht. Kurz nach dem Jahrhundertunwetter, Ende 1986, war der Krebs in die Stadt gekommen, und es hieß, die Krankheit sei die Strafe Gottes für die schlechten Kinder der Stadt. Magdalena glaubte nicht daran. Sie spürte, dass es einen anderen Grund geben musste. Kein Kind war schlecht, oh nein. Kein einziges.
Magdalena hob die Karte auf. Über der Hexe stand in winzigen Lettern schwungvoll geschrieben: Murrs beste Virginia Zigaretten. Sie drehte die Pappkarte um. Mit leiser Stimme las sie die verblassten Buchstaben aus Tinte: Damit wir es schlagen hören in der Ferne.
Am Abend zuvor hatte Leonard Roberts Zimmer gefunden, die Tür verborgen hinter einem Kleiderschrank. Es lag neben dem Elternschlafzimmer mit dem großen Blutauge auf dem Teppichboden, und als er es betreten hatte, schien die Zeit einen winzigen Sprung zurückzumachen. Eng und niedrig das Zimmer selbst, eher ein Verschlag. Der Raum unberührt. Auf dem Fußboden eine umgestülpte Jeans und ein blaues T-Shirt, wie Knochenreste in einer leeren Höhle. Abgestreifte Überreste eines Jungen, der nicht mehr nach Hause gekommen war. Spinnwebenfäden und Staubschlieren zwischen dem schmalen Bücherregal, dem Bett und dem alten Schreibtisch, der unter dem Fenster mit dem Blick zur Straße hin stand. Kaum merklich der Geruch von Magnolien und Minze in der kalten Luft, aber doch unverkennbar. Längst blind gewordenes Fensterglas, vertrocknete Nachtfalter in den Ecken.
Hier wäre alles möglich gewesen, hatte Leonard gedacht. Alles, wäre die Zeit nur eine andere und wären die Erwachsenen keine Gespenster mit bleischweren Knochen und noch schwereren Träumen. Leonard hatte sich auf das Bett gesetzt und den fast vollen Mond am Nachthimmel durch das trübe Fenster betrachtet. Verlassen das mächtige Haus auf dem Grabhügel, das er von hier aus erblicken konnte. Schattenwürfe der Zigarettenfabrik fielen auf den rissigen Asphalt, lebendig gewordene Nosferatuträume. Hinter dem Haus, entlang des schmalen Feldweges, stand der Weidenbaum mit Roberts Baumhaus. Es war noch da, verwittert und an manchen Stellen morsch, aber Leonard würde noch hinaufklettern können. Von dort aus würde er, wie Robert einst, über die Felder blicken und über sein eigenes Leben.
Über all das dachte Leonard nach in Roberts Zimmer, dort, wo die Zeit stehengeblieben war. Immer noch und für alle Zeit 1973, vergessene Herbsttage. Das Bett wartend auf den Zauberjungen, der Flusskiesel über die Straßen gleiten ließ. Der Junge, der nachts von einem Haus träumte, das nur ihm gehörte, nur ihm und seinen Freunden. Ohne Schreie und ohne Schläge, ohne die Schmerzen in seinem Herzen.
»Wären wir nur bei euch gewesen«, hatte Leonard geflüstert. Zusammen hätten sie während des Jahrhundertunwetters fliehen können, weit weg aus der Stadt. Aber nichts davon war geschehen. Der Junge lag immer noch tot im Murr-Haus, und Leonard träumte sein Leben. Das Weihnachtsbuch von Charles Dickens fest umschlossen, war Leonard in Roberts Bett eingeschlafen und hatte seinen Traum geträumt. »Zeig mir dein Schwänzchen«, hatte der Mann in diesem Traum gemurmelt. Ein Mann, dessen Beine dürr und so schwarz wie faule Zähne waren, Münzen klimperten in seinen geschlossenen Händen. Roberts Mutter stand neben ihm, mit grauen Mäusen auf der Schulter. Leonard blickte zu sich herunter und sah, dass er nackt war. Mäuse und Ratten krabbelten an seinen Beinen empor.
Mit einem stummen Schrei erwachte er und sah, dass der Morgen dämmerte und dass es schneite. Der letzte Tag im Oktober, vielleicht der letzte Tag in meinem Leben, dachte Leonard. Auf dem Fenstersims saß eine Maus und schien zu nicken.
Mäusebeine und Spinnenträume
Um kurz vor neun stand Tom vor der Toilettenschüssel und blickte fassungslos hinein. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie so viel Blut gesehen. In der Küche hörte er seine Frau das Frühstück zubereiten, roch den Kaffee. Er hatte von toten Kindern geträumt, von hohen Leichenbergen mit heraus gestreckten Armen und Beinen. Starres, dürres Geäst, auf das sich Raben und Krähen setzten und von dort aus den Himmel betrachteten. Den von Wolken bedeckten, immerwährenden Herbsthimmel. Zitternd schloss er die Augen, ihm war kalt, dennoch schwitzte er. Er hielt sich am Waschbecken fest und blickte in den Spiegel. Sein Gesicht war kalkweiß, die Augen tief und die Lippen farblos. Er versuchte zu lächeln, obwohl die Angst in seinen Knochen steckte. Tief in seinem Bauch war etwas gewachsen, ein monströses Ding, das ihn auffraß.
Es war der Tag vor Allerheiligen, jener Tag, der sein Leben verändert hatte, damals, für alle Zeit. Auch von Karla hatte er geträumt, ein seltsamer Traum zwischen Mitternacht und den Schmerzen in seinem Bauch. Hatte sie küssen wollen, hatte den Geruch ihrer Haut und ihrer Haare eingeatmet – ein Sommergeruch, der ihn hoffen ließ. Aber nichts war geschehen, der Traum war abgerissen und Karla verschwunden.
»Tom?«, rief seine Frau.
Er erschrak. Ihre Schritte auf dem Parkett, barfuß.
»Willst du einen Kaffee?«
Sie öffnete die Badezimmertür und lächelte ihn an. Dann sah sie das viele Blut, zerplatzte Tropfen auf den Fliesen, Blutschlieren auf seinen nackten Oberschenkeln. Ihre Augenlider flatterten wie Schmetterlingsflügel, ihr Mund öffnete sich einen winzigen Spalt. Dann fiel sie um in ein unendliches schwarzes Loch, einer Grube gleich.
Einer Grube gleich, aber …
Wann genau er gestorben war, wusste Moritz nicht mehr, es war auch egal. Vor langer Zeit, irgendwann nach 1986, vermutlich einige Jahre nach dem Jahrhundertunwetter. Damals war er zu dem toten Jungen im Keller geworden, auf dessen Schultern sich die Mäuse setzten und von dessen Füßen die Rattenkönige aßen. Der Bauch aufgebläht, das Krebsgeschwür mit seinen Eingeweiden verwachsen. Er war schon lange tot, als sein Vater ihn in einen großen Leinensack gesteckt und aus dem Keller getragen hatte, runter zum Grünen See. Sieben Backsteine, auf jedem davon Jesu Name, die den toten Jungen unten hielten, tief unten am Seegrund.
Er war nie wie die anderen gewesen, nicht im Leben und nicht im Tod. Diese Dummköpfe waren zum Murr-Haus gegangen, anstatt zu vergessen. Seine Schwester Sara und die anderen Jammerlappen, von denen nur noch einer übrig war. Der Knochenmann, dieser armselige alte Mann mit den Träumen von einer besseren Zeit, die nichts wert waren.
Moritz blickte vom Mauervorsprung über die Oktoberstadt, über eine Stadt, die ihrem Ende entgegensah. Sie alle würden qualvoll verrecken wie tollwütige Hunde. Er lachte laut auf. Ein Mann ging über den Marktplatz und blieb plötzlich stehen. Er sah zu Moritz hinauf, dann schüttelte er den Kopf und ging weiter. Moritz kicherte. Niemand konnte ihn hier oben auf dem Dachfirst sehen, niemand der Lebenden. Nur den Schnee, der in ihre Augen fiel, bemerkten sie.
Die anderen Kinder hatten Rache genommen – während des großen Unwetters 1986 hatten sie die Ungeheuer aus ihren Häusern getrieben und ihre Seelen zerschnitten wie dünnes Papier. Hatten den Krebs in die Stadt gebracht wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für jene, die leiden sollten. Für jene, von denen sie glaubten, der Krebs würde sie bekehren wie das Abendgebet in der Kirche. Aber er wusste es besser. Denn wenn alle krank sind, ist das Sterben keine Vergeltung mehr, sondern eine Erlösung.