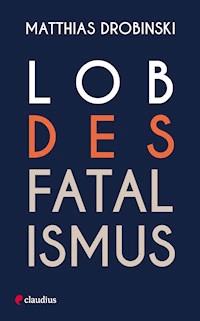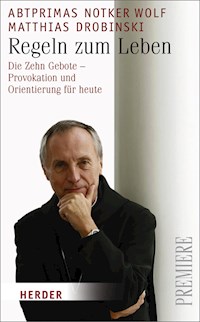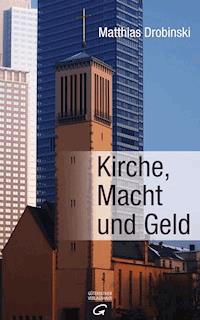
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wie reich und mächtig sind die Kirchen wirklich?
Die Kirchen, katholisch wie evangelisch, sind die größten Institutionen in Deutschland und die zweitgrößten Arbeitgeber nach dem Öffentlichen Dienst. Ihr Einfluss ist in der Verfassung festgeschrieben.
Ist ihre Stellung im Staat noch gerechtfertigt, obwohl die Zahl ihrer Mitglieder stetig abnimmt? Was wäre durch eine strikte Trennung von Staat und Kirche gewonnen?
Matthias Drobinski zeigt in diesem Buch, warum es gut ist, wenn Staat und Religionen zusammenarbeiten. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich das Verhältnis von Staat und Kirche ändert und zu einem Religionenrecht wandelt.
- Spielt Religion in einem säkularisierten Deutschland noch eine Rolle?
- Ein Buch über Probleme und Widersprüche des Staat-Kirchen-Verhältnisses
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Frieden ist dahin. In Limburg an der Lahn empören sich die Gläubigen über den Bischof Tebartz-van Elst und werfen ihm vor, Geld verschwendet und die Öffentlichkeit angelogen zu haben. Die Medien diskutieren: Wie reich dürfen und sollen die Kirchen sein? In Rauschendorf bei Bonn soll die Leiterin eines katholischen Kindergartens entlassen werden, weil sie geschieden ist und mit einem neuen Mann zusammenlebt – doch die Eltern sehen das anders und suchen sich lieber einen neuen Träger für die Einrichtung, statt sich den Regeln des kirchlichen Arbeitsrechts zu beugen. Oder: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi reicht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde ein – auch bei der Caritas und der Diakonie, bei den kirchlichen Sozialträgern mit insgesamt 1,3 Millionen Beschäftigten, sollen Streiks nicht länger verboten sein. Im beschaulichen Staufen bei Freiburg wiederum geht eines schönen Tages der katholische Kirchenrechtsprofessor Hartmut Zapp zum Standesamt und erklärt, er sei und bleibe zwar ein gläubiger Mensch – doch aus der Kirchensteuergemeinschaft wolle er jetzt austreten.
Wenn es um das Verhältnis von Staat und Kirchen geht, ist mittlerweile der Ärger nicht weit und das Misstrauen groß. Warum sammelt der Staat die Kirchensteuer ein, garantiert und zahlt den konfessionellen Religionsunterricht, gesteht den Kirchen zu, eigene Regeln beim Arbeitsrecht aufzustellen, finanziert weitgehend kirchliche Sozialträger, zahlt seit 1803 für enteignete Grundstücke jedes Jahr Millionen Euro als Ausgleich? Versuchen die Kirchen da nicht, ihren Reichtum und ihre Macht zu halten, obwohl ihnen die Gläubigen weglaufen und die alten Ansprüche bröckeln? So richtig erregt werden die Debatten, wenn die neue, fremde Religion ins Spiel kommt: der Islam. Warum dürfen die bei uns Moscheen bauen, Knaben beschneiden, Tiere schächten – und die Frauen wollen Beamte werden und trotzdem ihr Kopftuch tragen?
Ja, noch steht das für die Kirchen ausgesprochen vorteilhafte Staat-Kirche-Verhältnis der Bundesrepublik fest. Schließlich sind diese Kirchen die größten Institutionen der Bundesrepublik und werden es wohl auch bleiben. Das deutsche Kirchensteuersystem gilt weithin als bewährt, es gibt keine politische Mehrheit, die Kirchenartikel im Grundgesetz zu ändern. Länder und Kommunen sind froh um die kirchliche Sozialarbeit. Die Schulen und Kindergärten in evangelischer oder katholischer Trägerschaft haben mehr Anmeldungen, als sie Plätze vergeben können. Doch das Selbstverständliche ist dahin im Verhältnis der Gesellschaft zur Religion, zu den Kirchen. Es ist weg, weil inzwischen ein Drittel der Bundesbürger keiner Volkskirche mehr angehört und auch unter den Katholiken und Protestanten die Kirchenbindung abgenommen hat. Und so ist auch die Zahl derer gestiegen, die keine Erfahrung mit Kirchengemeinden oder kirchlichen Einrichtungen gemacht haben, keine tiefergehenden jedenfalls als die eines fernen Kunden oder Konsumenten. Viel mehr aber als von abstrakten Verfassungsgrundsätzen lebt das Staat-Kirche-Verhältnis vom gesellschaftlichen Konsens – es ist dieser Konsens, der bröckelt. Die Gleichgültigkeit gegenüber den Kirchen hat zugenommen, das Wissen über und die Akzeptanz von Glaubenssätzen und Morallehren hat abgenommen. Laizistische Strömungen haben an Argumentationskraft gewonnen und manchmal auch an Aggressivität.
Die Kirchen wiederum sind auf diese Entwicklung schlecht vorbereitet. Sie geben oft ungern Auskunft über ihre Finanzverhältnisse und sind beleidigt, wenn jemand kritische Fragen stellt. Und dann ist da seit März 2013 in Rom ein neuer Papst, beunruhigend für die reichen Christen Europas: Franziskus lebt bescheiden im Gästehaus des Vatikans und lässt sich in einem Mittelklassewagen fahren, er will eine bescheidene Kirche an der Seite der Armen. Wie verträgt sich das mit teuren Bischofshaus-Sanierungen und PS-starken Dienstwagen von Mercedes, Audi, BMW? Wie mit kirchlichen Sozialträgern, die zu Dienstleistungsunternehmen mit Millionenumsatz geworden sind, die auch nicht anders wirtschaften und Löhne drücken als die weltliche Konkurrenz?
Schließlich ist eine neue Religion in Deutschland sichtbar geworden: der Islam. Vier Millionen Muslime suchen einen Platz in Deutschland – auch mit ihrer Religion, mit ihrer Frömmigkeit. Das deutsche Staatskirchenrecht hat auf diesen berechtigten Wunsch noch keine befriedigende Antwort gefunden. Wenn es künftig islamischen Religionsunterricht geben soll, wer bestimmt die Inhalte, wer bildet die Lehrer aus – der Staat, die islamischen Verbände? Und wenn das alles so schwierig ist, sollte man dann nicht besser Religion zur Privatsache erklären und den Staat so weit wie möglich religionsfrei halten?
Befürworter und Kritiker des gegenwärtigen Staat-Kirche-Verhältnisses leben häufig in unterschiedlichen Wahrheiten und von unterschiedlichen Grundannahmen. Die Befürworter gehen davon aus, dass starke Religionsgemeinschaften eine Gesellschaft besser machen, jedenfalls, wenn sie nicht fundamentalistisch auftreten und alle Andersgläubigen und Nichtgläubigen abwerten. In ihren Augen sollte der Staat also den christlichen Kirchen, den Juden und – so sie sich in das vorgegebene System einordnen – auch den Muslimen um seiner selbst willen einen angemessenen Platz schaffen. Für die Gegner haben sich die Kirchen – immer mit der Behauptung, nur das Beste für die Menschen zu wollen – Geld, Privilegien und Macht gesichert, die ihnen nicht zustehen. Für sie ist es an der Zeit, diesen verfassungswidrigen Zustand zu beenden. Und manchmal geht es auch Kirchenvertretern tatsächlich vor allem darum, den eigenen Einfluss zu sichern, und Kirchengegnern darum zu zeigen, dass Glaube in Wahrheit Aberglaube ist und ein Staat schön dumm, der so etwas unterstützt.
Dieses Buch will nun weder einfach die Kirchenposition verteidigen noch einer laizistischen Verfassung das Wort reden. Es geht davon aus, dass, bei allen Problemen, die es gibt, Religionen und Religionsgemeinschaften insgesamt einer Gesellschaft guttun und dass ein Staat, der die Religionsfreiheit schützen will, diesen Religionen auch einen Platz in der Öffentlichkeit garantieren muss – Religion ist eben nicht einfach eine Privatsache. Andererseits geht es aber auch davon aus, dass dieses Staat-Kirche-Verhältnis sich ändern muss, wenn es eine Zukunft haben will, wenn es den Islam fair integrieren will. Das Buch soll informieren, weil es in der Debatte oft an Informationen fehlt: darüber, wie das Staat-Kirche-Verhältnis historisch gewachsen ist und wie es heute aussieht, wie genau das kirchliche Arbeitsrecht funktioniert und wo nicht, wie sich die Kirchen finanzieren und wofür sie welches Geld ausgeben. Es stellt aber auch Grundsatzfragen: Wie viel Macht und Geld sollten Kirchen haben, deren Gründer arm lebte und der von sich sagte, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei? Wie sehr sollen sie sich einmischen in diese Welt, wie sehr sollen sie sich »entweltlichen«, wie das Papst Benedikt XVI. bei seinem Deutschlandbesuch 2011 forderte? Es erzählt von vielen Menschen, denn Macht, Geld, Staat und Kirche sind nie abstrakt – es sind Themen mitten aus dem Leben, und der Glaube oder Nichtglaube hat immer mit Emotionen und Lebenserfahrung zu tun. Das Buch vertritt auch eine Meinung: Es plädiert dafür, aus dem alten Staat-Kirche-Verhältnis ein neues Religions-Gesellschafts-Verhältnis zu entwickeln, das dem Wandel in den Kirchen und der Gesellschaft gerecht wird. Die institutionelle Stärke dieser Kirchen wird abnehmen, der Glaube der Deutschen wird individuell, eine neue Religion wird ihren Platz in diesem System finden müssen.
Und doch werden diese Kirchen wichtig bleiben für das Land, wird gelten, was der Verfassungsrechtler Wolfgang Böckenförde schon 1976 so formulierte: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.« Er kann die Kräfte nicht schaffen, die ihn tragen, dazu braucht er die Zivilgesellschaft, braucht er Menschen, die mehr tun, als sich einfach nur an die Gesetze zu halten und ansonsten ihren Egoismus pflegen, die sich für andere einsetzen. Der Staat braucht auch Kräfte, die ihm Grenzen setzen; ein allmächtiger Staat wird ein totalitärer Staat. Allerdings werden sich auch die Kirchen fragen müssen, ob sie nicht neue Freiheiten gewinnen, wenn die enge Bindung an den Staat sich lockert – wenn sie nicht mehr Erfüllungsgehilfen einer problematischen Sozialpolitik sein müssen, wenn sie nicht mehr quasiverbeamtete Pfarrer haben oder immer noch einige Bischöfe, die indirekt der Staat bezahlt.
Der Autor versichert an dieser Stelle: Er ist katholisch, hat aber keinen Kirchenkomplex. Er ist kein abgesprungener Priesterseminarist, der nun wütend auf alles Kirchliche ist; niemand hat ihm als Kind Höllenangst gemacht, und nie war ein Kirchenmitarbeiter zudringlich. Er ist auch kein reumütig Heimgekehrter oder frisch Bekehrter, der nun im Überschwang jeden Weg und Holzweg der Kirchen verteidigen muss, der Schwarzes weiß redet, weil es irgendwie der großen Sache dient. Er schreibt als Journalist nun schon seit einigen Jahren über Kirchen und Religionsgemeinschaften und damit auch über das Verhältnis der Religionen und Gemeinschaften zu Staat und Gesellschaft. Er hat als Journalist gelernt: Selten ist etwas einfach gut oder böse, schwarz oder weiß. Manchmal sind die Dinge grau – noch öfter aber sind sie zum Glück bunt – bunt wie das Leben. Und wenn das Buch auch ein wenig zum Bunten beiträgt, ist er zufrieden, ein wenig sogar glücklich.
TEIL I:
Die Lilien auf dem Feld, Kaiser Heinrich und Konrad Adenauer: Wie das deutsche Staatskirchenrecht entstand
1. Von der »schmutzigen Kirche« zur Staatsreligion
Ein Kapitel, in dem es um Jesus und seine Jünger geht, um das Himmelreich, um Lilien auf dem Feld und das nahe Ende der Welt, um reiche Frauen und arme Witwen, um Tertullian, den Moralisten, und Clemens, den Realisten, schließlich um den großen Kaiser Konstantin.
Niemand weiß, wie arm oder reich Jesus war. Seine Eltern bringen, so berichtet es das Lukasevangelium, zum Dank für seine Geburt im Tempel zwei Turteltauben dar, das Opfer der armen Leute, die sich kein Lamm oder Zicklein leisten können. Andererseits ist Joseph, sein Vater, ein Bauhandwerker – und nur vier Kilometer von Nazareth entfernt bauen die Römer die Stadt Sepphoris aus; kaum vorstellbar, dass da nicht auch für den Nährvater Jesu Aufträge hereinkommen. Vermutlich also sind Jesu Eltern nicht wirklich arm, sondern eher kleine Leute, die halt so über die Runden kamen, mal besser und mal schlechter. Eins allerdings ist sicher: Jesus sind Geld und Macht und Institutionen nicht wichtig, sogar so unwichtig, dass ihn auch die Reichtums- und Machtkritik der Propheten nur am Rande interessiert. Er will vom nahenden Reich Gottes erzählen und seinem Vater im Himmel, der die Liebe und Güte ist. Er bringt seine Anhänger dazu, ihre Fischerboote und ihre Familien zu verlassen und mit ihm um den See Genezareth zu ziehen, ohne festen Wohnsitz. Zu seiner eigenen Familie hat er offenbar nur losen Kontakt; als Basisstation der Wandernden dient das Haus des Petrus. »Seht die Lilien auf dem Feld«, predigt er, den irdischen Reichtum fressen die Motten und der Rost. Die Händler vertreibt er aus dem Tempel. Andererseits sagt Jesus seinen Jüngern auch, sie sollten sich Freunde mit dem ungerechten Mammon machen. Er hat nichts gegen gutes Essen und Trinken, so wenig, dass seine Kritiker ihn einen Fresser und Säufer nennen. Er ist kein Büßer, der sich kasteit, wie Johannes der Täufer. Die irdischen Dinge sind einfach unwichtig geworden angesichts des Großen, das sich da ankündigt: ein ganz anderes Reich, eine Herrschaft jenseits der irdischen Dimensionen. »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist«, hält er den Pharisäern entgegen, als die ihn auf seine politische Gesinnung hin prüfen wollen. Und dann, als der Mann aus Nazareth, aus der hintersten Provinz, vor Pontius Pilatus steht, dem Statthalter des römischen Kaisers, des mächtigsten Mannes der damaligen Welt, da hält er dem entgegen: »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« Die angebotenen Kompromisse lehnt er ab und stirbt furchtbar am Kreuz.
Doch die Geschichte des Mannes aus Nazareth ist mit dem grausigen Tod am Kreuz nicht zu Ende. Auferstanden sei er von den Toten, erzählen seine Anhänger, aufgefahren in den Himmel, und bald werde der Gedemütigte und Hingerichtete in Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Es beginnt eine schier unglaubliche Geschichte: Die Anhänger des Gescheiterten zerstreuen sich nicht in alle Winde. Sie bleiben zusammen, gewinnen neue Anhänger, und der glühendste von ihnen, Paulus, der Konvertit, reist über Kleinasien und Griechenland bis nach Rom, um den neuen Glauben zu verkünden. Die Apostelgeschichte berichtet, die ersten Jünger hätten in Eintracht und Liebe zusammengelebt und »alles gemeinsam« gehabt. Das ist wohl eine kleine Schönfärberei, daran stimmt aber wohl: Besitz und institutionelle Strukturen sind den ersten Jüngern Jesu gleichgültig. Sie erwarten die baldige Wiederkunft des Herrn, alles Irdische ist für sie vorläufig. Sie sorgen füreinander, wo einer Not hat. Die Solidarität der neuen Gemeinschaft, die einen Schmerzensmann verehrt, muss in der antiken Welt faszinierend fremd gewirkt haben, mit ihrer Verehrung der Schönheit und des Erfolges, des Reichtums und der Macht.
Und dann bleibt das Ende der Welt aus – eine echte Glaubenskrise für viele Anhänger Jesu. Irgendwann aber stellen sie sich darauf ein, dass ihre Gemeinschaft wohl noch länger auf dieser Erde existieren würde. Sie halten die Worte und Taten Jesu in den Evangelien schriftlich fest. Sie nehmen auch Unbeschnittene in die Gemeinschaft auf, es entstehen Strukturen einer frühen Kirche: Es gibt Männer, die dem Gedächtnismahl vorstehen, und Frauen, die Gemeindedienste versehen, andere kümmern sich um die Armen und um die Witwen, die nach römischem Recht eine Strafsteuer zahlen müssen, wenn sie nicht bald wieder heiraten. Das bewundernswerte Sozialsystem der schnell wachsenden Christengemeinde zeigt aber auch: Es gibt dort Mitglieder, die gut situiert, sogar wohlhabend sind. Trotz aller Verfolgungen und Diskriminierungen: Hundertfünfzig Jahre nach dem Tod Jesu ist die frühe Kirche keine »ecclesia sordida« mehr, keine »schmutzige Kirche« der Armen und Unterdrückten. Sie umschließt alle Gesellschaftsschichten. Und sie hat ein Problem: Wie soll sie mit den Reichen und Ihrem Reichtum umgehen, wie mit ihrer gesellschaftlichen Position, wo doch Jesus die Armut predigte und die Distanz zur weltlichen Macht? Die christlichen Kirchen haben das Problem bis heute nicht gelöst.
Es geht um ganz schön viel Geld, das zeigt die Geschichte des reichen römischen Reeders Marcion. Er begeistert sich für die Sache Jesu, er zahlt der jungen Christengemeinde 100.000 Sesterzen in die Gemeindekasse – nach heutigen Maßstäben ein Millionen-Euro-Betrag. Allerdings hat Marcion auch eigene theologische Vorstellungen: Er findet, dass die Christen sich ganz vom Judentum und der hebräischen Bibel trennen müssten. Das aber lehnt die Mehrheit der Gemeinde ab, Marcion verlässt enttäuscht die Christen und bekommt die 100.000 Sesterzen wieder ausgezahlt. Die Gemeinde von Rom ist die reichste der jungen Gemeinschaft, sie wird auch aufgrund ihres Reichtums immer wichtiger; Jerusalem rückt machtpolitisch an den Rand des entstehenden Christentums. Nicht allen Christen gefällt dieser Aufstieg, diese Verbürgerlichung. In Karthago in Nordafrika zum Beispiel polemisiert der Theologe Tertullian gegen diese Entwicklung. Er ist ein strenger Moralist, er schimpft über die Christenmänner, die Soldaten werden, über ihre Frauen, die sich nach der neuesten Mode kleiden, über Bildhauer, die sonntags die Gemeindeversammlung besuchen und am Montag wieder an heidnischen Götterstatuen meißeln. Für ihn ist dies alles Verrat und falsche Verweltlichung. Für Historiker sind Tertullians Schriften wertvolle Quellen der Sozialgeschichte: Sie gehen davon aus, dass es das alles unter den Christen tatsächlich gab, worüber sich Tertullian mokierte. Allein, er setzt sich nicht durch, zieht sich enttäuscht zurück. Und doch hat der Mann aus Karthago die Frage gestellt, die sich durch die Geschichte des Christentums ziehen wird: Wie viel Reichtum verträgt der Glaube an den Gekreuzigten, wie viel Nähe zur weltlichen Macht? Kann einer reich und mächtig sein und zugleich Christ? Kann die Christengemeinschaft reich und mächtig sein?
Die Antwort, die über Jahrhunderte hinweg kirchliche Autoritäten auf diese Frage geben werden, findet der Theologe und Philosoph Clemens von Alexandrien. Quis Dives salvetur – »Welcher Reiche gerettet werden wird«, heißt seine kleine Schrift, die er Ende des zweiten, Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus verfasst. Clemens beginnt beim Markusevangelium: Ein reicher Jüngling kommt und möchte Jesus nachfolgen, Jesus fordert ihn auf, alles zu verkaufen, was er hat, der Jüngling aber geht beschämt davon. Jesus sagt daraufhin das berühmte Wort vom Kamel, das eher durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Der Herr, so folgert Clemens, gebietet dem jungen Mann nicht im Wortsinn, allen Besitz zu verkaufen, um vollkommen zu werden, sondern seine Gedanken frei zu machen vom Streben nach dem Besitz – daran scheitert der Jüngling. Nicht der Reichtum an sich ist also Sünde; man kann ihn ja auch zum Guten nutzen. Sündhaft sind die Gier und die Abhängigkeit vom Besitz. Wer sich davon frei macht, wer mit seinem ehrlich erworbenen Reichtum und seiner Macht Gutes tut, der kann in den Himmel kommen. Noch werden die Christen immer wieder verfolgt. Noch ist es gefährlich, sich zu der neuen Religion zu bekennen.
Die junge Kirche vereint Arme und Reiche, sie zieht viele wohlhabende Frauen an (weil die Christen die Frauen besser behandeln als die anderen Männer ihrer Zeit), sie schafft Strukturen der Solidarität. Im zunehmend krisengeschüttelten und zerfallenden römischen Reich ist die Gemeinschaft ein Faktor der Stabilität und auch durch Verfolgung nicht mehr zurückzudrängen. 313 schließen der westliche Kaiser Konstantin und der Herrscher des östlichen Teils des römischen Reiches, Licinius, einen Pakt, demzufolge die Christen nicht mehr verfolgt werden. Die meisten der konfiszierten Grundstücke sollen den Christen zurückgegeben werden. Wie viel Realpolitik und Anerkennung des Faktischen und wie viel echte Bekehrung hinter dem vor allem auf das Betreiben von Konstantin zustande gekommene Werk steht, ist nicht zu sagen. Das Christentum aber ist vom römischen Staat als gesellschaftlicher und politischer Faktor anerkannt – im so genannten »Toleranzedikt« von Mailand definiert zum ersten Mal das Römische Reich ein positives Verhältnis zu der neuen Religion, die dann im Jahr 380 zur Staatsreligion werden wird. Gelöst ist die Frage, wie reich und mächtig die Kirche Jesu sein soll, damit nicht. Zur gleichen Zeit, da die ersten Kirchen im Staatsauftrag gebaut werden, ziehen die ersten christlichen Mönche und Eremiten in die Wüste: Sie wollen arm und abgeschieden von dieser Welt leben.
2. »Entweltlichung«: Von den christlichen Kaisern zu den ersten modernen christlichen Politikern
Ein Kapitel, in dem es um einen Kaiser im Büßergewand geht und einen Papst, der im Gefängnis landet, um Franz von Assisi und viele andere Armutsprediger, um Martin Luther und die weltliche Gewalt, um kleine Fürstbischöfe und den großen Kaiser Napoleon, um den fast genauso großen Kaiser Joseph, zudem um Fürst von Bismarck und den guten alten Kaiser Wilhelm. Und zwischen all den großen Herrschern um das Leben der kleinen Landpfarrer.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!