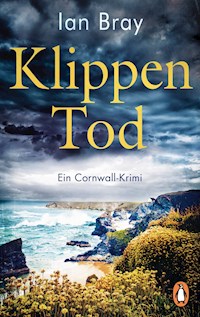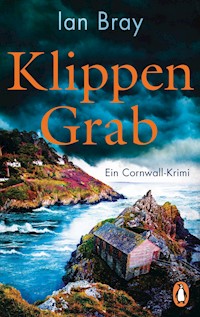
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Simon Jenkins ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Leiche, eine Vermisste, eine Lüge. Ein neuer Fall für den Kommissar, der nie mehr ermitteln wollte.
Der ehemalige Polizist Simon Jenkins genießt sein ruhiges Leben im beschaulichen Küstenort Cadgwith. Die rauen Klippen und die tosenden Wellen lassen den passionierten Maler die schmerzhaften Erinnerungen an seine Vergangenheit vergessen. Als jedoch eine Frau plötzlich verschwindet und zur gleichen Zeit im Nachbarort eine weibliche Leiche gefunden wird, deren Identität nicht festgestellt werden kann, erwacht sein Instinkt. Handelt es sich um dieselbe Frau oder gibt es eine Verbindung zwischen den zwei Fällen? Und was hat es mit dem mysteriösen Filmemacher auf sich, der zu viel wissen will? Jenkins kann nicht anders, als erneut zu ermitteln …
»Viel Lokalkolorit mit Pub-Besuchen und Folkmusik macht den Krimi zu einem spannenden Urlaubsbegleiter.« Rheinische Post über »Klippentod«
Lesen Sie auch die anderen Bände der atmosphärischen Cornwall-Krimireihe unabhängig voneinander:
Band 1: Klippentod
Band 2: Klippengrab
Band 3: Klippenrache
Band 4: Klippensturm
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Ähnliche
Ian Bray, geboren 1954, ist das Pseudonym des deutschen Krimiautors Arnold Küsters. Wenn er sich nicht gerade spannende Mordfälle ausdenkt, ist er als freiberuflicher Journalist im Einsatz. Cornwall wurde vor vielen Jahren zu seinem liebsten Reiseziel, und Cadgwith hat es ihm ganz besonders angetan. Daher verbringt er dort nicht nur regelmäßig seinen Urlaub, sondern verlegt neuerdings auch seine Kriminalfälle in das beschauliche Fischerdorf.
Klippentod in der Presse:
»Ein spannender Schmöker zum Wegträumen, garniert mit genau dosiertem Herzklopfen.« WDR 4 Bücher
»Spannend, und mit viel Liebe zu den Figuren erzählt.« Allgemeine Zeitung
»Viel Lokalkolorit mit Pub-Besuchen und Folkmusik macht den Krimi zu einem spannenden Urlaubsbegleiter.« Rheinische Post
Außerdem von Ian Bray lieferbar:
Klippentod. Ein Cornwall-Krimi
Ian Bray
Klippen Grab
Ein Cornwall-Krimi
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2022 der Originalausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München. Covergestaltung: bürosüd Coverabbildung: Getty Images / joe daniel price / www.buerosued.de Satz: GGP Media GmbH, Pößneck E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-26732-2V002
Fisher keels lie still as daylight dies / And dusk enfolds them as they take their nap / Old cottages stand guard with watchful eyes / Whilst seagulls cover everything in crap!!
Jan Morgan
And shall Trelawny live? / And shall Trelawny die? / Here’s twenty thousand Cornish men / Will know the reason why!
Trelawny
Figuren und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären damit rein zufällig. Die im Buch beschriebenen Handlungsorte entsprechen weitgehend den tatsächlichen Gegebenheiten. Abweichungen sind allein der Fantasie des Autors geschuldet.
I.
Die Luft flirrte. Das Auto stand am Rand der schmalen Straße, die Scheiben heruntergelassen. Er blieb stehen und sah hinein. Auf dem Rücksitz bemerkte er zwischen zerlesenen Zeitschriften eine leere Mineralwasserflasche. Der Wagen stand da, als habe ihn die Fahrt hierher erschöpft. Nein, er stand dort wie tot.
Jede Bewegung war zu viel. Simon Jenkins wandte langsam den Blick ab. Er wusste nicht genau, was ihn erwartete. In die dichte Weißdornhecke gegenüber war eine breite Einfahrt geschnitten. Er zögerte kurz und überquerte dann die Straße. Als er den breiten Hof betrat, stieß er auf scheinbar wahllos abgestellte Kisten und Kästen, unterschiedlich groß. Die meisten von ihnen enthielten Metallschrott in allen denkbaren Formen. Zwischen den Behältern wucherten Gras und andere Pflanzen.
Er blieb nahe des Zugangs stehen und nahm jedes Detail in sich auf. Rechts neben dem Haus lehnten weiße Säcke mit blauem Aufdruck an den Resten einer Feldhaubitze. Der graue Putz des eingeschossigen Baus wurde nahezu vollständig von Efeuranken verdeckt. Vor der Tür standen zwei verwaiste Plastikstühle. Von dort waren es nur wenige Schritte bis zu einem Seecontainer. Seine Flügeltür stand weit offen.
Links von sich erkannte er in dem Durcheinander ein dünnbeiniges Metallgestell. Vorsichtig bahnte sich Jenkins seinen Weg an dem geschweißten Rahmen vorbei. Er bemerkte an der oberen Querstange Hängevorrichtungen, die aussahen wie die soliden Haken in einer Metzgerei. Über dem Hof lag der Geruch aus altem Öl, Rost und Hitze.
Es war immer noch früher Nachmittag. Der Himmel über dem Lizard war von einem intensiven monochromen Blau, wie so oft zu dieser Jahreszeit. Aber er spürte, dass heute etwas anders war. Sein Blick wanderte vom Himmel zurück zum Seecontainer – ein Wal aus Stahlblech, der mit offenem Maul stumm und gefräßig auf den nächsten Fang wartete.
Dann wusste Jenkins, was ihn störte. Es war die Stille. Das Leben fehlte. Keine Zikaden, kein Rotkehlchen, das in der Hecke raschelte, kein Zwitschern der Feldlärchen, die üblicherweise um diese Tageszeit über den Feldern standen. Diese Ruhe war ebenso beklemmend wie die Sommerhitze.
Die Anstrengung der letzten Stunde hatte ihn abgelenkt. Er hätte mehr trinken sollen, denn nun hatte er Durst und schwitzte. Er verdrängte den Gedanken und nahm weiter jedes Detail, jede Kleinigkeit in sich auf – eine Routine, die sich über Jahre an zahlreichen Tatorten eingeschliffen hatte und doch jedes Mal neu war.
Als er den Fuß in den Seecontainer setzte, fielen ihm zuerst ihre Augen auf: groß, weit aufgerissen, der Blick starr nach vorne gerichtet, so als habe sie gerade erst in einen furchterregenden Abgrund geschaut. Auffällig war auch die Nase. Sie war kräftig, mit breitem Rücken, aber gerade. Die anmutig geschwungenen Lippen waren für seinen Geschmack eine Spur zu grell geschminkt. Um den Hals trug sie eine dreireihige Kette aus dicken Perlen. Den Kopf schmückte eine Art Krone oder Diadem. Das etwas plump wirkende Schmuckstück hielt ein weißes Tuch, das die braunen Locken weitgehend bedeckte. Dem Körper fehlten die Unterarme, die Beine waren nicht mehr als Stümpfe. Der Torso war in ein Kleid gehüllt, das im Unbestimmten endete. Weiße Rüschen am grünen, mit gezackten Goldstreifen verzierten Oberteil bedeckten züchtig den Ausschnitt des leblosen Körpers. Das Kleid war im unteren Bereich dunkelblau.
Die Frau war mittleren Alters und machte einen kräftigen Eindruck, trotz ihrer sichtbaren Verstümmelung. Der Torso stand aufrecht, ein wenig vorgebeugt. Die ungewöhnliche Haltung wurde durch einen breiten Gurt gesichert, der an der Innenwand des Containers befestigt war.
Jenkins ließ die Szene auf sich wirken und stützte sich dabei mit beiden Händen auf seinen Gehstock. Der Anblick ließ in ihm eine geradezu absurde Vorstellung aufkommen. Der Torso wirkte, als sei in der Anordnung des Körpers ein Moment des Aufbruchs eingefroren.
Er hatte erst vor knapp einer Stunde den Tipp bekommen und sich umgehend zu Fuß auf den Weg gemacht. Da die Zeit drängte, hatte er nicht auf Luke und seinen Pick-up warten wollen. Die Wegstrecke zwischen seinem Cottage, das nicht ganz in der Mitte des Dorfes lag, und diesem Hof an der Straße nach Lizard war unerwartet anstrengend gewesen. Er hatte wieder einmal vergessen, dass die Straße stetig anstieg. Zum Glück hatte er bei seinem Aufbruch an die Medikamente gedacht und seine mittägliche Dosis eingenommen. Daher war er nun zumindest frei von Schmerzen. Seit fast vier Wochen hatte sein Leben eine andere Qualität. Sein Neurologe hatte ihm endlich Tabletten mit einem anderen Wirkstoff verschrieben, und die waren deutlich effektiver als die bisherigen Schmerzmittel.
Jenkins ließ den Blick auf dem Gesicht der Frau ruhen. Ihre fast schwarzen Augen ließen ihn nicht los. Darin lagen Schmerz, unerfüllte Sehnsucht und Erfahrung. Ihr Blick und die markanten Gesichtszüge erinnerten ihn an jemanden. So sehr er sich auch konzentrierte, er kam nicht darauf. Langsam umrundete er den Torso. Er würde schon noch auf den Namen kommen.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren.
»Oh, du bist tatsächlich früh dran.« Hinter ihm stand eine schlanke Frau mittleren Alters in ausgewaschenen Jeans und heller Bluse. In der einen Hand hielt sie einen Becher Tee und in der anderen eine Zigarette. »Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr erschreckt.« Sie grüßte mit dem Becher in seine Richtung und warf mit einem entschuldigenden Lächeln ihr dunkelblondes Haar zurück.
»Hallo. Nein, Sarah. Ich wollte mir die Figuren in aller Ruhe anschauen, bevor hier gleich die Menschenhorden einfallen.« Er lächelte zurück. Er kannte Sarah Stephens seit seinem Umzug nach Cadgwith. Sie arbeitete wie er als Künstlerin und war mit einem Partner seit Monaten mit der Restaurierung der Galionsfiguren beschäftigt gewesen.
»Die gute Kalliope. Ist sie nicht schön?« Sarah trank einen kräftigen Schluck und trat näher. Als sähe sie sie zum ersten Mal, ruhte ihr Blick bewundernd auf der Figur. »Wir sind tatsächlich eben erst mit unserer Arbeit fertig geworden.« Sie hob die Schultern, so als müsse sie sich bei Jenkins erneut entschuldigen.
»Ihr habt wirklich Großartiges vollbracht.« Er deutete eine Verbeugung an. Dem mächtigen Torso sah man die Witterungseinflüsse durch die Jahrhunderte und die Zerstörungen durch Holzwurmfraß kaum noch an. Die Konturen ließen wieder das Werkzeug des Schnitzers erahnen. Die Farben waren frisch und kräftig und hatten dennoch nicht den kitschigen Touch von Jahrmarktfiguren.
Jenkins wandte sich ab, denn in diesem Augenblick trat ein Mann aus dem Haus. Er war groß und hatte eine kräftige Statur. Auch er trug einen Becher Tee mit sich. Gelassen lächelnd hob er die freie Hand.
»Ian Henn kennst du ja.« Sie zog an ihrer Zigarette und schüttelte den Kopf. »Horden? Keine Ahnung, was uns gleich erwartet.« Sie drehte Jenkins für einen Augenblick keck ihr Hinterteil zu. In einer Gesäßtasche steckte ein Notizheft. »Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die Leute werden sicher eine Menge Fragen haben.«
Jenkins nickte. »Kalliope also?«
»Yep.« Sarah musterte ihn wie die Geschichtslehrerin ihren Schüler und drückte dann burschikos die Zigarette an ihrer Schuhsohle aus. »Du kennst dich sicher ein bisschen aus in der griechischen Mythologie?« Sie grinste breit, denn sie kannte die Antwort.
»Nicht wirklich, um ehrlich zu sein.«
Die Malerin zückte nachsichtig ihr Notizbuch und schlug es auf. »Also. Kalliope ist eine der, Moment, neun Töchter des Zeus.« Sie legte den Zeigefinger auf die Stelle in ihren Aufzeichnungen. »Sie ist die Muse unter anderem der Wissenschaft, des Saitenspiels und des Epos. Madame gilt als die weiseste der neun Musen.« Sie schaute auf.
»So, aha.«
»Hab ich mir jedenfalls so notiert.« Sie bemerkte Jenkins’ zweifelnden Blick und lächelte erneut. »Guck dich doch noch ein wenig um, noch hast du sie für dich allein. Wie du siehst, haben wir noch andere Galionsfiguren im Angebot. Wie wäre es mit unserem stolzen bärtigen Zentauren hier? Geschaffen im Jahr 1842. Ich finde besonders seine Körperhaltung bemerkenswert«, dozierte sie. »Die rechte Hand ruht auf seinem pferdeartigen Unterkörper, die linke geballte Faust auf der Stirn. Oder im anderen Container unsere Aurora. Ich liebe sie. Da ist dann noch der König von Theben, 1855 geschnitzt für die HMS Cadmus. Der Rest ist aber auch nicht ohne. Insgesamt sind es vierzehn.« In ihrer Stimme lag nun der ganze Stolz einer Museumsführerin, die über die Jahre mit dem Objekt ihrer Leidenschaft verschmolzen war.
Jenkins hob eine Augenbraue.
»Wir haben hier natürlich nicht alle vierzehn Figuren restauriert. Es haben mehrere Teams an ihrer Wiederherstellung gearbeitet.« Sie fuhr mit der Hand prüfend über den hölzernen Körper des Zentauren. »Es hat eine Weile gedauert, bis ich die richtigen Farbtöne gefunden habe. Aber nun ist er wieder so schön wie zu seiner Jungfernfahrt.«
»Und warum hat man ausgerechnet Kalliope als Galionsfigur genommen?« Jenkins’ Interesse war geweckt. »Die Muse des Saitenspiels?« Er musste lächeln.
»Man nahm an, dass die mythologische Bedeutung der Figuren auf das jeweilige Schiff selbst überging. Sie waren sozusagen die Seele des Schiffs.« Sie hob ihr Notizheft. »Ich habe es extra aufgeschrieben. Man nimmt an, dass etwa zweihundert Figuren die Zeiten überdauert haben. Es galt als schlechtes Karma, sie zu zerstören, wenn die Schiffe ihren Dienst getan hatten und abgewrackt wurden. Es gab diese Figuren massenweise. Sie landeten unter anderem auf Marinestützpunkten, Piers, in Parks. Da auch unsere hier über so viele Jahre Wind und Wetter trotzen mussten, waren sie in einem erbärmlichen Zustand, als wir sie bekommen haben. Sie waren von innen weitgehend verrottet und wurden nur noch durch die Farbe zusammengehalten. Jeder einzelne Torso musste erst vorsichtig von innen ausgehöhlt und anschließend aufwändig stabilisiert werden. Dieser technische Teil war Ians Job. Hat er großartig gemacht.« Sie nickte Ian zu, der ihr Lob, bis auf ein verlegenes Lächeln, unkommentiert ließ. Er nippte stattdessen an seinem Tee.
Jenkins hob anerkennend einen Daumen.
»Jede Figur kann ihre eigene Geschichte erzählen. Und eine ist so spannend wie die andere. HMS Kalliope zum Beispiel war in den frühen 1850er-Jahren in Australien stationiert und wurde im Jahr 1848 in Neuseeland eingesetzt, während der Kriege gegen die Maori, einschließlich des Angriffs auf Ruapekapeka.« Sie grinste. »Ich habe allerdings nicht die geringste Ahnung, worum es dabei ging.«
Er zuckte mit den Schultern. »Jedenfalls nicht sonderlich taktvoll von der Royal Navy, ausgerechnet eine Muse in einen Krieg zu verwickeln.«
Sarah Stephens lachte schallend. »Nun ja, das lag vielleicht daran, dass in der Mythologie Kalliope auch die Richterin war im Streit zwischen Aphrodite und Persephone. Soweit ich weiß, ging es damals um Adonis.« Sie warf ihm einen schelmischen Blick zu. »Die uralte Geschichte der Liebe.«
»Möglich.« Jenkins musste ebenfalls lächeln.
»Tee?« Sie hob den Becher und wandte sich dann an Ian, um ein bestätigendes Kopfnicken zu erhalten. »Wir haben in den letzten anderthalb Jahren bei der Arbeit wahrlich große Mengen davon getrunken. Tee war sozusagen unser wichtigstes Handwerkszeug.«
Stimmen und Lachen näherten sich dem Container.
»Lass gut sein. Ich habe genug gesehen. Außerdem kommen die ersten Neugierigen. War ’ne sehr gute Idee, den Leuten die Chance auf eine Besichtigung zu geben, bevor die alten Schätzchen abtransportiert werden. Die Torsi sind schließlich Teil unserer Geschichte.« Jenkins wandte sich zum Gehen. »Wirklich schön, dass die Galionsfiguren gerettet werden konnten. Sozusagen in letzter Sekunde. Ich muss dich unbedingt wieder einmal in deinem Atelier besuchen.«
»Ach«, winkte sie ab, »es gibt nichts wirklich Neues von mir. Bin kaum zu eigenen Arbeiten gekommen. Aber ich hab ja jetzt wieder mehr Zeit. Kommenden Mittwoch werden meine Schätzchen abgeholt. Demnächst kannst du sie im neuen Museum in Plymouth bestaunen.« Als er beinahe schon an der Einfahrt war, rief sie ihm scherzhaft hinterher: »Torso für Torso kehrt nun sozusagen an den Tatort zurück, Mr. Ex-Detective. Die Galionsfiguren wurden nämlich auch in Plymouth hergestellt.«
II.
Wer vom Rathaus aus die abschüssige Straße hinabsah, streifte mit dem Blick womöglich das Blue Anchor Inn, das mit seiner Steinfassade gelassen und weitgehend unscheinbar seit dem 15. Jahrhundert auf der linken Seite lag. Am Fuß der Coinagehall Street würde der neugierige Blick schließlich auf das leicht deplatziert wirkende Grylls Monument treffen. Gotisch anmutend, war das Monument aus hellem Stein Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut worden, zum Andenken an Humphrey Millet Grylls. Der Banker und Anwalt hatte sich seinerzeit während einer Rezession um den Erhalt von 1200 Arbeitsplätzen bemüht, die von einer der größten und reichsten Zinnminen Cornwalls abhängig waren.
Wer den Blick daran vorbei in die Ferne hob, blieb gern an dem grünen Flanken der sanften Erhebungen hängen, in die Helston eingebettet war und die seinen verschlafenen Charakter am Eingang zum Lizard unterstrichen.
Es war ein mitunter trügerisches Bild, denn regelmäßig lag das laute und stetige Knattern von Hubschrauberrotoren in der Luft. Die grau lackierten Helikopter waren zumeist zu Übungsflügen unterwegs und gehörten zur nahen Royal Naval Air Station Culdrose, Europas größter Basis für Hubschrauber.
Von so viel Militärpräsenz unbeeindruckt, plätscherte munter Wasser durch schmale und flache Wasserrinnen, die die Straße links und rechts flankierten. Fußgänger und Motorisierte mussten indes höllisch achtgeben, sich nicht in ihnen zu verfangen. Das Wasser floss in das Kanalsystem der Kleinstadt. Im Sommer erzeugten die Wannen aus Granit die Illusion erfrischender Bachläufe und absoluter Sauberkeit. Ihre Planer mochten eben diese Botschaft im Sinn gehabt haben: Hier bleibt nichts schmutzig in unserem Städtchen.
Die Rinnen waren so etwas wie die entfernten Nichten des Flüsschens Cober, an dem Helston lag und das keine drei Kilometer weiter in südwestlicher Richtung in den Loe Pool mündete.
Bereits ab dem 13. Jahrhundert war gegen Ende des Mittelalters an der Flussmündung eine Sandbank gewachsen. Sie trennte seitdem den Cober vom Meer, mit fatalen Folgen für Helston. Der Stadthafen ging verloren, und damit sank auch die Bedeutung Helstons als Bergwerkstadt.
Die natürliche Verstopfung der ursprünglichen Flussmündung führte andererseits zu einem landschaftlichen Phänomen: Der Cober staute sich auf und wurde zum größten natürlichen Süßwassersee in Cornwall und damit zugleich zu einem begehrten Naherholungsgebiet unweit der Stadt.
Über eine ganz andere Art der Verstopfung zerbrach sich seit geraumer Zeit Collin Dexter den Kopf. Am Morgen hatte er sich noch gut gelaunt und in Erwartung eines unspektakulären Arbeitstages von seinem Lebensgefährten verabschiedet. Sie hatten bei Orangensaft und Toast in seltener Übereinstimmung die letzten Einzelheiten für ihre demnächst anstehende Hochzeit besprochen. Aber seit einigen Stunden war nichts mehr, wie es sein sollte.
Die dauerhafte Konzentration auf die Vorgänge auf seinen Bildschirmen hatte ihn müde gemacht. Er musste gähnen, wandte den Blick von den Überwachungseinheiten ab und massierte sich die Schläfen. Warum passierte das ausgerechnet heute und ausgerechnet in seiner Schicht? Aber es half alles nichts. Einfach so tun, als sei nichts passiert, und die Bewegungen in den Zahlenkolonnen, Daten und Grafiken zu ignorieren, machte die Sache nicht besser. Ganz im Gegenteil. Dexter sah für die kommenden Tage, wenn nicht sogar Wochen, eine Menge Arbeit auf sich und seine Mannschaft zukommen. Er brauchte dringend einen Tee und nahm den Wasserkocher in Betrieb. Dann setzte er sich wieder vor die Bildschirme und scrollte mit der Maus die Seiten rauf und runter. Sie ließen keinen Zweifel. Das Wasser aus den Rinnen lief zwar ab wie üblich, aber irgendetwas stimmte nicht im großen Kanalsystem.
Der zuständige Manager von South West Water nahm seinen Job ernst. Auf solche Situationen war er trainiert und daher bestens vorbereitet. Jedenfalls auf dem Papier. In Wirklichkeit hatte er in den vergangenen Jahren kaum mit Problemen am und im Kanalsystem zu tun gehabt. Nichts, was ihn in irgendeiner Form herausgefordert hätte. Aber das hier hatte eine andere Qualität. Dexter stellte das Radio leiser. Der überdreht fröhliche Kommentator von BBC Radio Cornwall nervte nun doch. Und die Frage nach den besten Hits des Jahres 1974 hätte ihn auch unter normalen Umständen nicht interessiert. Bevor er zum Telefonhörer griff, richtete Dexter seine Krawatte und drückte den Rücken durch. Half ja nichts. Die Fließgeschwindigkeit des Abwassers hatte über einen Zeitraum von zwei Tagen kontinuierlich abgenommen. Irgendetwas schien die Röhren zu verstopfen. Er hoffte inständig, dass es nicht das war, was er befürchtete.
Während er auf die Verbindung wartete, dachte er an Sidmouth in Devon. Er erinnerte sich nur zu gut an die Meldung. 64 Meter lang, so lang wie sechs Busse: Der Fettberg in dem Küstenort war hart wie Beton gewesen und der größte, den man bis dato in einem Abwasserkanal der Grafschaft gefunden hatte. Die Kollegen waren wochenlang mit der Beseitigung beschäftigt gewesen. Er war damals heilfroh gewesen, dass es nicht seinen Abschnitt getroffen hatte. Und nun das.
»Vincent? Gut, dass ich dich erreiche.« Erleichtert lehnte er sich zurück. »Wo steckst du gerade? Was machst du? Okay, das kannst du später noch. Du musst runter und nachsehen, was da los ist. Und nimm Jason mit. Was? Ja, ich weiß, wie warm es heute ist und wie es stinken wird. Hör auf zu jammern und mach dich auf die Socken Vince.«
Seit Tagen schon stand die Hitze wie eine Glocke über der gesamten Grafschaft Cornwall. Sie hatten bei South West Water alle Hände voll zu tun, um die Wasserversorgung im Griff zu behalten. Die Menschen wässerten ihre Gärten und Beete nahezu ununterbrochen. Noch war das Trinkwasser nicht knapp, aber schon wurde darüber spekuliert, wann es rationiert und ein Gießverbot erlassen werden würde. Collin Dexter griff zur Wasserflasche und nahm einen Schluck. Mehr konnte er im Augenblick nicht tun, als Grey in Marsch zu setzen, seinen zuverlässigsten Mann. Das Wasser für den Tee hatte er längst vergessen.
Keine Stunde später stand Wasserwerker Vincent Grey, ausgestattet mit Helm, starker Lampe und dunkelgrüner Wathose, mit einem Seil gesichert am Einstieg. Sein Kollege hatte den Deckel beiseitegeschoben und war ein Stück zur Seite getreten. Mit den Händen tief in der Arbeitshose vergraben und einer dünnen Selbstgedrehten im Mundwinkel beobachtete er, wie Grey seinen Mundschutz höher schob.
»Viel Spaß, Vince.« Jason nahm die Kippe zwischen die Finger und deutete feixend gegen den tiefblauen Himmel. »Wenigstens ist es da unten nicht so heiß.«
Grey brummte ein kurzes »Du mich auch« und drehte sich mit dem Rücken zum Einstieg. Jason hatte gut reden. Noch. Er würde auf jeden Fall später ebenfalls in den Kanal hinuntersteigen müssen. An dieser Stelle war die Abwasserleitung breit genug, um versetzt hintereinander stehend arbeiten zu können. Über Greys Gesicht huschte ein Lächeln. Wenn sein Kollege eines mehr als ein schales Bier hasste, dann waren es die Ratten, die dort unten auf sie warteten.
Stufe für Stufe tastete er sich in Helstons Unterwelt hinab. Er machte den Job seit mehr als zwanzig Jahren, aber an den Gestank würde er sich nie gewöhnen. Grey lebte aus demselben Grund die meiste Zeit allein. Frauen hielten es nie lange bei ihm aus. Im Gegensatz zu dem Geruch in den Kanälen hatte er sich längst daran gewöhnt. Seine freie Zeit verbrachte er als Fan des Helston Athletic F. C. auf Fußballplätzen oder im Pub. Da störte sich niemand an seinem Job.
Grey blieb am unteren Ende der Leiter stehen. Das Wasser mochte den meisten Dreck wegspülen, aber den Gestank kümmerte das wenig, der krallte sich in die rauen Backsteinwände – und nun auch in die Poren seiner Haut. An solchen Tagen wie heute würde er sich erst umziehen müssen, bevor er sein Feierabendbier im Pub in Auftrag gab.
»Alles okay so weit?«, klang es routinemäßig von oben in die Röhre hinein. Er zog zur Bestätigung zweimal am Sicherungsseil.
Greys Augen mussten sich erst an die Lichtverhältnisse im Kanal gewöhnen. Die feuchte Luft hier unten war schwer. Ohne es wahrzunehmen, hielt er den Atem an. Von der halbrunden gemauerten Decke tropfte in unregelmäßigen Abständen Kondenswasser. Schon nach wenigen Metern spürte er, wie sich die Feuchtigkeit auf seine Jacke legte, so als habe sie lange auf eine Gelegenheit wie diese gewartet. Sein T-Shirt klebte ihm unter der Schutzjacke längst am Rücken. Klammer als hier konnte es auch bei Hochbetrieb in einer Wäscherei nicht sein. Er musste unwillkürlich an seinen Onkel denken. Der hatte als Metzger in einer Schlachterei gearbeitet. Als Kind hatte Grey ihn einmal besuchen dürfen. Vor lauter Schwaden hatte er ihn in dem Schlachthaus kaum erkannt.
Er schob die Erinnerung beiseite, denn er hatte unvermittelt wieder diese Mischung aus tierischen Exkrementen, offenen warmen Leibern und Blut in der Nase. Sein Onkel war längst tot, aber diesen Geruch würde er nie vergessen.
Langsam tastete er sich tiefer in die Dunkelheit hinein. In den Spinnweben, die sich von der Decke zu den Wänden aus Backstein zogen, hingen Tröpfchen wie feiner Nebel im Herbst. Je weiter er watete, umso stärker roch es nach abgestandenem Waschwasser, Fäkalien und faulem Gemüse.
In der Tat, die Fließgeschwindigkeit der Brühe zu seinen Füßen ging gegen Null. Sie staute sich regelrecht. Er wandte sich nach links und setzte vorsichtig einen Schritt nach dem anderen. Jetzt nur nicht ausrutschen. Nach einer kurzen Strecke roch er verdorbenes Bier. Er überschlug in Gedanken die zurückgelegte Entfernung. Demnach musste er nun fast unter dem Helston Cober Inn sein. Je näher er dem Abwasserrohr des Pubs kam, umso intensiver wurde der säuerliche Gestank nach Pisse und abgestandenem Bier. Überall klebten Reste ranzigen Fetts.
Das Pub hatte keinen guten Ruf. Angeblich verkaufte der Wirt kein ordentliches Bier, legte weder Wert auf Haltbarkeitsdaten noch auf saubere Leitungen. Außer in Tütchen abgepackte Essig- oder Käse-und-Zwiebel-Chips sowie gesalzene Erdnüsse konnte man dort nichts essen, was schmeckte. Jedenfalls erzählten das diejenigen unter seinen Arbeitskollegen, die dem Pub wider besseres Wissen die Treue hielten. Angesichts des Drecks wunderte sich Vincent Grey einmal mehr, warum der Laden nicht schon längst geschlossen hatte.
Je weiter er vordrang, desto mehr wuchsen an den Wänden und auf dem Boden die Ablagerungen aus verkrustetem Fett. Durchzogen von dunklen Schlieren leuchteten sie wachsbleich im Licht seiner Lampe. Greys Ahnung verlagerte sich immer stärker Richtung Fettberg. Sicher nicht so ein riesiger wie damals in London, aber ganz sicher würde seine Beseitigung richtige Drecksarbeit bedeuten.
Das fettige Grauen, hatten die Zeitungen damals reißerisch getitelt. Das fettige Grauen lauerte im Untergrund. Ein Monster-Fettberg von unfassbaren 250 Metern Länge und 130 Tonnen Gewicht blockierte die Londoner Kanalisation. Die Folge davon, dass die Londoner Fette, Öle und Schmiermittel in Waschbecken hinunterspülten und Massen von Feuchttüchern in die Toilette warfen.
Er wusste von einem Kollegen, der einen Kumpel in London hatte, dass Spezialkräfte neun Wochen gebraucht hatten, um tief im Bauch der Metropole den Berg abzubauen. Außerdem war ihm auch das Ding in Sidmouth noch gut in Erinnerung.
Vincent Grey schreckte auf. Keine fünf Meter weiter duckte sich eine Ratte im Kegel des Scheinwerfers und verschwand mit einer blitzschnellen Drehung in die Dunkelheit. Er wusste, sie war nur die Vorhut.
Von oben zog Jason an der Leine. Das Seil straffte sich mehrfach.
Grey antwortete nicht.
III.
»Hier? Bei uns?« Stevyn Collins schüttelte den Kopf. »Der Schatz aus dem Buch? Das Gold der Piraten?« Collins hatte Mühe, ernst zu bleiben. »Das Gold aus Die Schatzinsel?«
Diese Touris wurden wohl nie schlau. Was nur fanden sie an diesen alten Geschichten? Egal wo sie herkamen, ob nun von der Insel oder von drüben, jenseits des Kanals. Die meisten von ihnen waren auf der Suche nach dem Abenteuer. Die Glücksjäger wollten den einen Hinweis finden – und sei er noch so klein –, dass der Mythos doch keiner war, sondern Realität. Sie alle kamen mit der naiven Gewissheit in diesen Landstrich, nur in der richtigen Höhle oder Bucht entlang der Küste suchen zu müssen, und sie hatten alle ihre eigene Schatzkarte im Kopf. Und mehr noch: Sie waren sicher, dass es irgendwo den einen gab, der sie ihnen in echten Sand und Felsen übersetzen konnte. Den galt es zu finden, der Rest wäre dann nur noch ein Kinderspiel.
Der pensionierte Kapitän stützte sich mit dem Ellenbogen lässig auf den Tresen und blickte in sein fast leeres Rumglas, als läge dort die Antwort wie glitzernde Dublonen auf dem Grund der See, die kaum hundert Schritte vom Pub entfernt in sanften Wellen in der engen Bucht auslief.
Stevyn Collins nahm einen letzten Schluck, schob das Kinn vor und kratzte ausgiebig seinen dichten Backenbart. »Der Robert Louis Stevenson? Der Schriftsteller?« Er drehte das Glas in der Hand, als müsse er ausgiebig nachdenken. Mal sehen, wie weit der Typ neben ihm gehen würde. »Sie fragen am besten Martin. Wenn einer mehr weiß, dann ganz sicher Martin.«
»Auch noch einen?« Jamie Morris hatte verstanden. Er drehte sich zu der Bedienung des Cadgwith Cove Inn um und hob stumm zwei Finger.
Die Frau nickte kaum merklich, dafür aber umso freundlicher, und hielt jeweils ein frisches Glas gegen den Hahn der hinter ihr kopfüber hängenden Flasche Rum & Shrub. Sie kam mit der Arbeit kaum nach. Das Pub füllte sich zusehends mit Touristen und Bewohnern des Küstendorfes. Der stetig wachsende Geräuschpegel spiegelte die Vorfreude auf die dienstägliche Folk Night.
Jamie Morris, der Filmemacher, war erst im Verlauf des Nachmittags aus London in Cadgwith eingetroffen. Die Fahrt hier herunter hatte deutlich länger gedauert als geplant. Die A 30, die von einer westlichen Londoner Vorstadt bis nach Land’s End reichte, war seit dem 17. Jahrhundert die Hauptverbindung runter nach Cornwall. Bis Truro war sie an zahlreichen Abschnitten verstopft gewesen. Eine schier endlose und nervende Autofahrt lag also hinter ihm. Und zu allem Übel war er nun im Pub auf einen Ureinwohner getroffen, der in seiner Beschränktheit nur eines im Sinn zu haben schien, nämlich ihn auf seine behäbige Art zu nerven.
Jamie Morris hatte für ein paar Tage oben in Ruan Minor das Häuschen neben dem Lebensmittelladen gemietet. Er müsse »einfach mal raus aus der Tretmühle und was anderes sehen«, hatte er seiner Freundin an einem der selten gewordenen gemeinsamen Abende offenbart. In Wahrheit aber wollte er in diese Gegend, weil er hier Stoff für ein neues Projekt vermutete. Chloe war naturgemäß wenig erfreut gewesen über die Ankündigung, und er hatte sie nur mit Mühe besänftigen können.
Morris war schon längere Zeit und, wenn er ehrlich zu sich selbst war, wenig erfolgreich auf der Suche nach ungewöhnlichen Stoffen, die sich für das Fernsehen eigneten. Ungewöhnlich bedeutete in seinem Sprachgebrauch die ganze Bandbreite zwischen spannend, schräg und aufregend. In erster Linie aber bedeutete »ungewöhnlich« für ihn möglichst viel Geld.
Auch wenn er noch weit vom Rentenalter entfernt war, zählte er in der schnelllebigen Londoner Szene als Urgestein der Medienbranche. Tatsächlich musste er lange überlegen, um sich zu erinnern, wann er seine erste Dokumentation abgeliefert hatte. Buch, Kamera, Schnitt und Produktion – alles aus einer Hand. Seine Firma lief zwar ganz ordentlich, aber das ungeschriebene Gesetz der Branche verlangte, dass der Nachschub an fernsehtauglichen Stoffen nicht abreißen durfte. Im immer rasanter laufenden TV-Geschäft waren die verantwortlichen Redakteure und Senderchefs eh von Geburt an vergesslich.
Gregg, Freund aus Kindertagen und seines Zeichens leitender Bibliothekar im King’s College, hatte ihm bei einem ihrer regelmäßigen bierseligen Abende im The Orchard die »total abgefahrene Story« von den kauzigen Schatzsuchern am Ende Cornwalls erzählt. Und dass Stevenson, der Autor der Schatzinsel, eines der Dörfer dort unten, Cadgwith, nicht nur gekannt, sondern sich dort auch eine Zeitlang aufgehalten hatte. Jedenfalls sei das die Überzeugung eines schrulligen Heimatforschers. Gregg hatte ihm das mit dem wohligen Unterton eines Bücherwurms erzählt, dem das Studium alter Schriften mehr Sonne ins Herz zauberte, als das ein sonniger Tag im heimischen Garten könnte.
Nach seinen blumigen Schilderungen gab es ganz in der Nähe des Dorfes vier Höhlen, die von Schmugglern genutzt worden waren – und somit den Schluss nahelegten, dass an der Küste immer noch verborgene Schätze lagen, die nur darauf warteten, gehoben zu werden. »Piratengold«, hatte Gregg geraunt, ähnlich dem Schatz aus dem berühmten Roman. Alles vergraben und vergessen. Das Pub in dem Kaff sei auf jeden Fall die Blaupause für Jim Hawkins’ Heimstatt gewesen.
Zunächst hatte sich Morris mehr um sein in Knoblauchsoße ertränktes Chicken Kiev gekümmert, als wirklich interessiert zuzuhören. Er hatte Greggs Bericht für eine seiner üblichen mit geheimniskrämerischen Details verzierten Übertreibungen gehalten. Gregg war schon mal kreativer gewesen. Zu den Treffen in ihrem Lieblingspub in Croydon gehörte nämlich traditionell, sich mit möglichst skurrilem Unsinn zu übertreffen.
Aber als Gregg gar nicht mehr aufhörte, von diesen merkwürdigen Fischerleuten zu erzählen, die sich da unten selbst noch im 21. Jahrhundert für die legitimen Nachfahren der Piraten hielten, dazu selbst ständig auf der Suche nach Wracks und Schätzen waren, war er doch neugierig geworden und hatte das Chicken Kiev achtlos zur Seite geschoben. Jim Hawkins, wie lange hatte er den Namen des Helden aus DieSchatzinsel nicht mehr gehört? Natürlich hatte er als Junge die Abenteuergeschichte verschlungen. Damals, als er noch nicht an das Abenteuer Mädchen gedacht hatte.
Und nun stand Jamie Morris, müde von der langen Fahrt und doch aufgekratzt, neben einem wahren Prachtexemplar dieser Spezies, von der ihm Gregg mit leuchtenden Augen erzählt hatte. Und dieser »Ureinwohner« kleidete sich dazu noch so, als sei er geradewegs einem Roman von Stevenson entstiegen: dichte Locken, volles rundes Gesicht, Backenbart, ein aus grobem Leinen gewirktes knopfloses Hemd, das über dem stattlichen Bauch spannte, weite Hose. »Stevyn«, hatte er sich vorgestellt, als Morris neben ihn an den Tresen getreten war, um ein Pint zu bestellen.
Morris zwinkerte der Bedienung zu, als sie die beiden gefüllten Rumgläser vor ihm abstellte und kassierte. Mit einem »Cheers, Stevyn. Ich heiße Jamie, bin Filmemacher« hielt er seiner neuen Bekanntschaft ein Glas hin. »Wo finde ich denn diesen Martin?«
Collins zuckte mit den Schultern und ließ Morris’ Beruf unkommentiert. »Weiß man bei Nutty nie so genau. Kommt drauf an.«
»Nutty?« Morris nippte an seinem Bier. Er spürte, dass er Hunger hatte. Vielleicht sollte er doch einen halben Hummer mit Pommes …? Jedenfalls sah der volle Teller verlockend aus, der in diesem Moment an den Tisch neben dem offenen Kamin gebracht wurde.
»Aye. Alle nennen ihn Nutty. Ein bisschen verrückt ist er. Keine Ahnung, wo Nutty sich gerade rumtreibt. Vielleicht hat er ’ne Fuhre zu machen. Fährt Taxi. Übrigens das einzige hier in der Gegend, solltest du Bedarf haben. Davon mal abgesehen, weiß man nie, wo er gerade steckt.«
»Weil?«
»Mehrere Gründe.« Stevyn Collins hielt das Glas erst gegen das Licht und dann genießerisch an die Nase. »Cheers.«
»Aha. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?« Das konnte ja heiter werden, wenn er dem Typen jedes Wort aus der Nase ziehen musste. Er schickte ein zappeliges »Bitte« hinterher. Dieser Stevyn war ja der geborene Entertainer.
»Er macht alles Mögliche.«
»Aha.« Den Drink konnte er abschreiben. Stevyn kam sich wohl sehr witzig vor. Besser, er gönnte dem Eingeborenen eine kleine Pause.
Das Pub unmittelbar am winzigen Naturhafen von Cadgwith war nun bis auf den letzten Platz gefüllt. Sah man einmal von den Musikern ab, die sich auf der Bank gegenüber der Bar niedergelassen hatten, überwogen die Touristen. Lachen, kleine Scherze und entspannte Neugier flogen durch den Raum wie Schwalben auf Nahrungssuche. Die Stimmung war gelöst. Kein Wunder nach dem sonnigen Tag. Der Sommer war nach einem eher holprigen Anfang endgültig in Cornwall vor Anker gegangen. Im Hin und Her der Stimmen identifizierte Morris auch ein paar deutsche und niederländische Sätze.
»Was interessiert dich das eigentlich? DieSchatzinsel? Ist doch nur ’n Buch.« Stevyn Collins musterte ihn aus dunklen Augen.
Morris wollte bereits antworten, hielt dann aber inne und wog ab, ob er sich die Mühe nicht sparen konnte. Dann aber siegte die Neugier.
»Stevenson soll damals eine Zeit lang hier in der Gegend unterwegs gewesen sein. Angeblich stimmen ein paar Beschreibungen in dem Roman mit den Gegebenheiten hier perfekt überein. Und es soll hier einen Schatz geben. Von dem könnte Stevenson gehört haben. Sagen meine Quellen. Jedenfalls soll er die Örtlichkeiten und die Erzählungen der Leute hier als Vorlage für seinen Roman genommen haben. Und warum, denke ich mir, sollen sie ihm nicht die Wahrheit gesagt haben? Das mit dem Schatz kann ja stimmen. Ist irgendwo vergraben und wartet auf seinen Finder, um ihn reich zu machen. Die Leute hier waren ja«, er warf Collins einen bedeutungsvollen Blick zu und räusperte sich dann verlegen, »nun ja, Piraten.« Er zog mit dem Zeigefinger die Haut am Auge hinunter. Verschwörerischer ging’s nicht. »Es gibt ja hier jede Menge Schatzsucher.«
»Sagt wer? Ich verstehe, dein Mittelsmann in London.« Collins drückte das Kreuz durch und schob den Bauch ein Stück weiter vor.
»Er ist eine zuverlässige Quelle.«
Morris warf einen Blick in den Raum. Es war nun kaum mehr ein Durchkommen. Alle Plätze an den Tischchen und auf der Bank waren belegt. Zwei Gitarristen und ein Banjospieler im Streifenhemd und mit langen grauen Locken, der sich auf der Bank neben den Eingang platziert hatte, stimmten ihre Instrumente. Ein Sänger blätterte durch seine mitgebrachten Texte. Bis zum Beginn der Folk Night konnte es nicht mehr lange dauern.
»Ich möchte meine Quellen und Informanten nicht offenlegen«, sagte Morris und ärgerte sich gleichzeitig über seine gestelzt klingenden Worte, die arrogant wirken mussten. »Ist ja klar«, schob er jovial hinterher.
»Wie gesagt, frag Martin.«
»Wird er heute hier sein?« Morris deutete mit dem Kopf in den Raum.
»Wenn er nicht gerade gebucht ist.« Collins hob sein Glas und grüßte einen Musiker, der sich durch die dicht an dicht stehenden Pubbesucher drängte, um auf der Bank doch noch einen Platz zu ergattern.
Ein Hoffnungsschimmer, immerhin. Morris blähte die Wangen und ließ die Luft langsam entweichen. »Und wo wohnt dieser Nutty?«
»Mit deiner Londoner Ungeduld kommst du hier nicht weit, mein Freund. Wenn die Zeit da ist, ist auch Martin da. In der Regel taucht er erst spät hier auf, auf ein Pint oder zwei. Um den Tag und das Leben zu begießen, sagt er immer. Und um mit ein paar selbst komponierten Liedern die Touristen zu unterhalten.«
In diesem Augenblick wehte vom Eingang ein vielfaches Hallo durch den Raum. Morris wandte sich um. Im Türrahmen stand ein schlanker, rothaariger Mann mit Brille und Sommersprossen, vom Alter her mochte er so um die siebzig sein. Bei sich trug er eine Art Handtasche, schmal und schwarz, und suchte mit den Augen nach einem Platz an dem niedrigen Tischchen, das eigens für die Musiker reserviert war.
Stevyn Collins winkte ihn zu sich und drehte sich dann zu Morris. »Mein alter Freund Brian. Wir kennen uns von Kindesbeinen an. Vielleicht weiß er, wo Martin ist. Brian, darf ich vorstellen? Das ist Jamie. Aus London. Er dreht Filme.« Collins betonte das letzte Wort vielsagend und legte seinem Freund beide Hände auf die Schultern, mit einem spöttischen Blick Richtung Brians Tasche. »Hast du deine Mundharmonikas geputzt?« Er lachte schallend, wobei nicht ganz klar war, ob er über seinen eigenen Witz lachte oder eher über Morris’ Anliegen. »Jamie möchte wissen, wo er Nutty finden kann. Hast du eine Ahnung?«
»Hi.« Brian Kernow nickte dem Filmemacher flüchtig zu und sah sich zu den übrigen Musikern um. »Am Vormittag kam er an unserem Haus vorbei. Ich war gerade dabei, die Einkäufe aus dem Wagen zu räumen. Er hat kurz angehalten. Er war auf dem Weg zur Bucht von Poltesco. Hatte seinen Metalldetektor dabei.« Brian versuchte sich auf seinen Freund zu konzentrieren. »Wie immer. Er hat mir erzählt, dass er in der Nacht eine Eingebung hatte, wo er suchen muss. Er sah wirklich sehr zuversichtlich aus. Nutty, halt.«
»Genau darum geht es unserem Freund hier aus der Hauptstadt. Er ist auf der Suche nach einem echten Schatzsucher. Da ist unser Nutty doch genau der Richtige, was?« Er schlug Morris jovial auf die Schulter.
Brian nickte geistesabwesend. Er hatte auf der Bank eine winzige Lücke zwischen zwei Musikern entdeckt. »Klar. Ich setz mich dann mal.« Mit einem »Viel Glück« steuerte er auf den Sitzplatz zu.
»Heute scheint dein Glückstag zu sein. Wenn Nutty wieder eine seiner Eingebungen hatte …«
Na prima. Morris sah auf die Uhr. Er würde jetzt noch ein Pint kaufen und einen halben Hummer mit Beilagen bestellen. Im Restaurantbereich im Nebenzimmer würde er sicher einen freien Tisch finden. Vorfreude vertrieb seine Müdigkeit. Nicht die schlechteste Art, auf einen schatzsuchenden Taxifahrer zu warten. Und wenn dazu die Musik auch noch gut war …
»Ich brauch jetzt ein Ale. Du auch?«
Stevyn Collins nickte zufrieden.
IV.
»Ihr Name?« Constable Allan Easterbrook hielt erwartungsvoll den frisch gespitzten Bleistift gezückt. Er bewahrte stets mehrere davon in der Schreibtischschublade auf. Obwohl er in seinem Büro der Devon and Cornwall Police vor einem nigelnagelneuen PC-Bildschirm saß, machte er sich lieber erst einmal handschriftliche Notizen. Das verlieh ihm bei den Rat- und Hilfesuchenden, die ihn in seinem Büro an der Godolphin Road aufsuchten, ein deutlich höheres Maß an Autorität, wie er fand. Die Aufzeichnungen übertrug er dann in aller Ruhe in den PC, wenn die Besucher gegangen waren.
»Bennett. Terry Bennett. Ich … wir wohnen in Cadgwith.«
»Ich brauche Ihre genaue Anschrift.«
Bennett begann zu schwitzen. Das lag nicht nur an der Hitze draußen. Erst die Fahrt herüber vom Lizard nach Helston, und dann dieser selbstgefällig wirkende Constable. Der machte ihn nervös. Außerdem hielt er sich schon viel zu lange in dem Raum mit den Fahndungsplakaten, behördlichen Aufrufen, den Abzeichen befreundeter Polizeieinheiten und den aufgehängten Mitteilungen und Verordnungen auf. Er konnte Polizeiwachen nicht ausstehen. Der Geruch nach Akten, Putzmitteln, die argwöhnischen Blicke der diensthabenden Constables, die in jedem einen potenziellen Täter sahen, die Enge und die Macht des Staates, die aus jeder Ecke kroch, waren nicht auszuhalten. Er wusste, er würde seinen Fluchtimpuls nicht mehr lange unterdrücken können. Dazu noch die Streifenwagen vor der Wache, der steinerne Schriftzug County Police über dem Portal und den beiden spitzen Giebeln. Selbst die drei Palmen vor der grauen Steinfassade von 1902 spiegelten die strenge Staatsmacht wider.
Nein. Die Begegnung mit der Polizei war Bennetts Sache nicht. Ganz und gar nicht. War sie noch nie gewesen. Nicht erst seit dem »Vorfall« in Manchester. Das war lange her, aber er existierte immer noch als dunkles Wabern in seinem Kopf, das stets ohne Vorwarnung wellenartig in Bedrohung umschlug. Wenn er ehrlich war, passierte das an jedem verdammten Tag.
»Ihre Anschrift?«, wiederholte der Constable und klopfte mit dem Bleistift leise auf seinen Notizblock.
Der Rhythmus schien Bennett zu irritieren. »Oh, sorry.« Er nannte Straße und Name seines Anwesens. »Wir wohnen noch nicht allzu lange dort, wissen Sie. Ein echtes Schnäppchen.« Er spreizte sein Gefieder. »Wir werden es demnächst bei einer kleinen Feier ganz offiziell Cadgwith Hall taufen.«
»Und Ihre Frau, Liz Bennett, seit wann ist sie denn nun genau verschwunden?«
»Genau genommen seit drei Tagen.«
Irgendetwas stimmte mit dem Mann nicht. Der Constable nahm unwillkürlich den frisch gespitzten Bleistift in beide Hände. Wie ein Hindernis, über das ein Reiter im Parcours mit seinem Pferd musste. Bennetts Schwitzen hatte deutlich an Intensität zugelegt.
»Sie wirken ein wenig nervös.« Der Constable musterte ihn aufmerksam. »Ist es die Hitze? Soll ich ein Fenster öffnen?«
»Ich vermisse meine Frau, Constable. Da ist es doch nicht verwunderlich, dass man nicht gerade ausgeglichen wirkt, oder? Sind Sie verheiratet, Constable?«
DC Allan Easterbrook überhörte mit dem Anflug eines Lächelns den leicht aggressiven Unterton und die damit einhergehende Unterstellung, keine Ahnung zu haben. »Seit drei Tagen also. Hm.« Nachdem er das notiert hatte, sah er von seinem Schreibblock auf. Bennett stammte garantiert nicht aus der Gegend. Dem Tonfall nach kam er von viel weiter nördlich. Vielleicht der Großraum Manchester. Ein Großcousin lebte dort, der hatte eine ähnliche Sprachfärbung. Bennett machte auf ihn den Eindruck des typischen Neureichen. Ein hochnäsiger Emporkömmling. Easterbrook sortierte ihn in den Finanzsektor ein. Banker oder Finanzmakler, vielleicht auch Unternehmer. Auf alle Fälle gewohnt, Anweisungen zu geben, und mit einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Er freute sich darauf, ihn mit dem nächsten Satz endgültig auf die Palme zu bringen. »Und dann kommen Sie erst jetzt?«
Bennetts Gesicht, ohnehin von Bluthochdruck und der Hitze gezeichnet, lief wie erwartet dunkelrot an. »Heißt es nicht immer, warten Sie ein, zwei Tage, bevor Sie die Polizei informieren?«
Easterbrook nickte. Natürlich ging es immer schön der Reihe nach. Man hatte seine Vorschriften. Ein wunderbares Gerüst nicht nur für den beruflichen Alltag. Vorschriften waren dazu da, Stress zu vermeiden. Das galt in seiner momentanen Verfassung einmal mehr. Ohne zweites Frühstück vertrug er nicht mal den Anflug von Stress, schon gar nicht an einem Sommertag wie diesem.
»In der Tat, das stimmt. In den allermeisten Fällen gibt es für das Verschwinden eine ganz harmlose Erklärung. Sie glauben ja gar nicht, Mr. Bennett, womit wir es hier …«
»Hören Sie, meine Frau ist verschwunden«, unterbrach Bennett ihn kurzerhand. »Unternehmen Sie endlich etwas.«
»Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ist es das erste Mal, dass Ihre Frau über Tage nicht nach Hause gekommen ist?«
»Was erlauben Sie …«
»Kein Grund, laut zu werden, Mr. Bennett. Ich habe nur eine einfache Frage gestellt«, unterbrach ihn der Constable mit erhobener Hand.
»Nun.« Bennett musste sich sichtlich beherrschen. »Sie wissen ja, wie das ist. Mann und Frau sind nicht immer einer Meinung. Was ich sagen will …« Er beugte sich ein wenig vor. »In den vergangenen Jahren hat sich meine Frau die eine oder andere Auszeit gegönnt. Wenn Sie wissen, was ich meine.« Er lehnte sich wieder zurück. »Aber sie ist nach unseren kleinen Streitereien stets in meine Arme zurückgekehrt. Schließlich weiß sie, wo sie hingehört. Und«, nun suchte sein Blick Zustimmung unter Männern, »sie hat dann auch jedes Mal ihre Belohnung bekommen. Einen Blumenstrauß, ein wenig Schmuck. Eine neue Handtasche. Im Grunde sind Frauen doch alle gleich …«
»Aber?«
»Mein Gefühl sagt mir, dass es diesmal anders ist.«
»Sie hatten also einen Streit?«
»Das ist es ja gerade, was mir Sorgen macht. Es gibt keinen Anlass für ihr Verschwinden, nicht den geringsten.«
Easterbrook sah zweifelnd drein.
»Es ist, wie ich es sage.«
»Könnte es einen Anlass geben, der, sagen wir mal, unter Umständen grundsätzlicher Natur ist?« Wie gesagt, alles schön der Reihe nach.
»Was wollen Sie damit andeuten?« Terry Bennetts Stimme vibrierte.
»Nichts.«
»Ich liebe sie. Meine Frau und ich, wir lieben uns, Constable. Liz, also meine Frau, hat sich Dienstagvormittag gut gelaunt von mir verabschiedet. Sie wollte den Sonnenschein nutzen und von Cadgwith Richtung Lizard wandern.«
»Warum dieser Abschnitt des Wanderwegs?«
»Da kommt man schließlich am Housel Bay Hotel an. Von der Terrasse hat man einen schier endlosen Blick auf die See. Bei ruhigem Wetter kann man sogar Seehunde sehen und Delfine. Wunderschön.«
»Ich weiß, ich bin ab und an mit meiner Frau dort, zum Tee. Das Abendessen können wir uns nicht leisten.«
»Wenn Sie das wissen, warum fragen Sie dann? Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen über Cream Tea zu fachsimpeln. Meine Frau ist verschwunden. Und Sie müssen endlich in die Gänge kommen. Ich habe wirklich Angst um Liz.«
Der Constable legte seinen Stift zur Seite und sah zur Uhr. Schon fast dreißig Minuten über seine Frühstückszeit. »Sehen Sie, wir machen in solchen Fällen Folgendes: Ich schicke gleich eine Beschreibung Ihrer Frau raus an alle Kollegen. Wir haben einen Spezialisten für verschwundene Personen, der hält alle Fäden in der Hand. Wir können im Notfall auf Suchhunde zurückgreifen und die Küstenwache einschalten, für den Fall, dass jemand auf den Küstenpfaden vermisst wird. Und es gibt die Coast Watch. Das sind Freiwillige, die ein Auge auf die Küste haben. Wir haben in Exeter einen Polizeihubschrauber stationiert, den können wir, wenn nötig, jederzeit alarmieren. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir gehen jetzt Stufe für Stufe vor. Sie sehen, wir haben eine Menge Möglichkeiten. Wir werden Ihre Frau finden. Sie geht nicht einfach so verloren.«
Terry Bennett blickte in das rosige, fleischige Gesicht des Constable. »Tun Sie endlich was. Egal was, nur machen – Sie – endlich – Ihren – Job.«
»Bleiben Sie entspannt, Mr. Bennett. Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen. Noch ist nichts passiert. Lassen Sie uns mit ein paar Fakten beginnen. Welche Angaben können Sie zu Ihrer Frau machen? Größe? Alter? Besondere Merkmale? Ein Tattoo vielleicht? War an dem Tag etwas anders als sonst? Was hatte Ihre Frau am Tag ihres, ähm, Verschwindens an? Vermissen Sie etwas? Hat sie ihren Schmuck mitgenommen? Bargeld? Anderes? Was ist Ihnen aufgefallen?«
Detective Constable Easterbrook dachte an seine eigene Frau. Alice war auf Besuch bei ihrer Patentante, die mit einer gebrochenen Hüfte im West Cornwall Hospital in Penzance lag. Er wusste, sollte Alice eines Tages verschwinden, würde für ihn eine Welt zusammenbrechen.
Bennett schien nicht zuzuhören. »Alles war wie immer. Wir haben uns beim Frühstück nett unterhalten, es gab keinen Streit. Bitte, Constable, Sie kümmern sich besser höchstpersönlich.«
Bennett machte mit einem Mal den Eindruck, als sei er in einen Wespenschwarm geraten. Er hatte es plötzlich sehr eilig. Der Constable lächelte ungerührt sein dienstliches Lächeln, während Bennett aufstand und ziemlich unvermittelt den Raum verließ.
Easterbrook griff nach dem batteriebetriebenen Handventilator in seiner Schreibtischschublade, den Alice ihm im vergangenen Herbst zum fünfjährigen Dienstjubiläum geschenkt hatte, und schob seine Notizen beiseite. Das Durcheinander auf dem Schreibtisch und in seinem Kopf gefiel ihm nicht. Also nahm er den Block wieder auf und legte ihn auf den Stapel unbearbeiteter Fälle rechts auf dem Tisch. Er ließ zufrieden den Blick schweifen. DC Allan Easterbrook brauchte jetzt erst einmal eine Abkühlung.
V.
Der Lichtstrahl zitterte, aber er ließ keinen Zweifel. Vincent Grey, langjähriger und erfahrener Mitarbeiter von South West Water, stand vor einem gewaltigen Klumpen ausgehärteten Fetts. Aber der Begriff traf es nicht. Ein Berg versperrte ihm den Weg, bedrohlich und braun, ein zusammengebackenes Etwas bestehend aus Frittierfett, Damenbinden, Kondomen, Papier und wer weiß was sonst noch. Trotz seines Mundschutzes konnte er den Ekel, der in ihm aufstieg, nicht in Schach halten.
Heilige Scheiße, das würde eine Menge Kraft und Zeit kosten, den ganzen Dreck aus dem Kanal zu brechen. Ohne Presslufthammer oder Spitzhacke hätten sie nicht die geringste Chance. Aber dieses Fettgebilde war es nicht allein, das ihm explosionsartig heftigen Brechreiz verursachte. Er wollte seine erste, flüchtige Bestandsaufnahme schon beenden, als ihm klar wurde, was er in diesem Dämmerlicht und dem tanzenden Lichtkegel wirklich sah.
Gegen den Berg gedrückt lag etwas.
Etwas Wulstiges, Helles, Teigiges.
Ein menschlicher Körper.
Auf dem Rücken, weiblich. Die Haut war fleckig und grauweiß.
Keine Arme, keine Beine. Ein Torso.
Vincent Grey wollte schreien, aber er konnte nicht.
Ein Berg aus Fett und ein Klumpen Fleisch.
Der Wasserwerker wollte fliehen, weg aus diesem stinkenden Kanal. Er wollte weg aus dieser Umgebung, aus dieser Szene, wollte raus, frische, unschuldige Luft atmen, die Sonne sehen, seinen Kollegen, der oben auf ihn wartete.
Ein schlechter Scherz, durchfuhr es ihn. Jemand hatte eine Schaufensterpuppe entsorgt. Was auch sonst? Kannte man ja. Die Menschen warfen heutzutage alles Mögliche auf den Müll. Wirf es in den Kanal, und es hört auf zu existieren. Selbstbetrug, der aber nicht funktionierte. Alles kam wieder ans Tageslicht, irgendwann. Nichts verschwand auf ewig. Was hatte er nicht schon alles wieder ans Tageslicht befördert: Tampons, Ausweise, Geld, den Kopf und die Innereien eines Hammels. Einmal sogar ein dickes Bündel Pfundnoten. Aber niemals zuvor eine Leiche.
Vincent Grey wollte weg, aber etwas Unbekanntes in ihm zog ihn zu dem Stück Fleisch und Knochen, das mal ein Mensch gewesen war, ein lebendes Wesen voller Gefühle, Lachen, Tränen, Wut und mit Sehnsüchten und Wünschen. Und nun lagen da nur noch die massiv beschädigten Überreste. Das Fett und dieser Klumpen hielten ihn in ihrem Bann. Unwillkürlich machte er einen weiteren Schritt nach vorn.
Wie ein Kind, das aus Angst vor dem verbotenen Horrorfilm im Fernsehen die Augen zu Schlitzen verengt, um einerseits die Handlung verfolgen und andererseits die Augen jederzeit blitzschnell schließen zu können, ließ er den Blick schweifen. Soweit er das beurteilen konnte, ließ der Torso darauf schließen, dass die Frau relativ jung gewesen war, als sie starb, vielleicht etwas über dreißig. Selbst in diesem Zustand und in der schlammigen, stinkenden Umgebung hatten ihre kleinen Brüste etwas absurd Lockendes.
Neben dem Bauchnabel war ein Fleck zu sehen. Nein, kein Fleck. Rot und dennoch nicht rot. Keine offene Wunde – ein Tattoo. Vincent Grey konnte es nicht eindeutig identifizieren. Er wollte nicht noch näher treten, der Gestank war mit einem Mal kaum auszuhalten. Der Fleck war eine kleine aufbrechende Knospe. Eine Rosenknospe.
Nun sah er auch Bissspuren. Wunden, verteilt über den ganzen Torso. Ratten hatten ihn aufgerissen.
Vincent Grey stolperte mehr, als dass er zurück in Richtung Einstieg lief. Dort stützte er sich an der schmierigen Ziegelwand ab und riss den Mundschutz herunter. Er bekam keine Luft mehr und würgte. Noch auf der untersten Stufe der rostigen Eisenleiter erbrach sich der Mitarbeiter von South West Water gegen die feuchte Tunnelwand.
VI.
Morris schob die Sonnenbrille zurück auf den Nasenrücken. Der Abend hatte ihn regelrecht umgehauen. Daran war nicht nur die Musik schuld. Die war für das Kaff überraschend gut gewesen. Vor allem Paul McMinn und sein Billy-Idol-Cover Plastic Jesus hatte ihn begeistert. Der Plastikjesus, der auf dem Armaturenbrett eines Autos wackelte – er musste immer noch schmunzeln bei dem Gedanken. Ewigkeiten nicht mehr gehört, und genauso lange hatte er schon nicht mehr einen Song mitgesungen.
Morris schloss die Augen. Wenn nur die Kopfschmerzen nicht wären. Bier und Rum waren eine unheilige Allianz.
Wie er viel später erfahren hatte – da war er längst nicht mehr nüchtern gewesen und hatte kaum noch geradeaus denken können –, war McMinn der Lokalmatador. Morris hatte ihm erzählt, er sei der beste Freund vom Wirt des The Orchard und könne ihm mit einem Anruf problemlos einen Auftritt in London verschaffen, sozusagen als Start einer wunderbaren Karriere. McMinn hatte nur freundlich genickt und unbeeindruckt sein Pint getrunken. Es stimmte also offenbar, was man sich in der Hauptstadt über die Typen am äußersten südwestlichen Ende Englands erzählte. Schon ziemlich merkwürdige Vögel.
Jamie Morris legte vorsichtig den Kopf in den Nacken und versuchte ein zaghaftes Blinzeln in die Sonne. Das hätte er besser sein lassen. Er brachte den Kopf wieder in die Ausgangsposition. Schön langsam. Nach »last order« und einem Rum als Absacker hatte er mit seinem neuen Kumpel Stevyn Arm in Arm das Cadgwith Cove Inn verlassen. Kein übler Kerl. Gemeinsam waren sie das kurze Stück hinunter zum Hafen gegangen, besser gesagt, gewankt. Wobei Stevyn ihn hatte stützen müssen. Entweder hatte er nicht so viel getrunken, oder der alte Seebär konnte deutlich mehr vertragen als er.
Einsilbig hatten sie nebeneinander die Stille in der Bucht genossen. Die wenigen Wellen plätscherten kaum hörbar, in den umliegenden Häuschen brannte kein Licht. Sie hatten über das »grandiose Leben des Mannes im Mond« philosophiert und ausgiebig den silbernen Streifen bewundert, den die runde Scheibe aus dem schwarzen Himmel auf das ebenso schwarze Wasser warf.
Anschließend hatte sich Stevyn mit einem seligen Kuss auf Morris’ Stirn verabschiedet, um dann festzustellen, dass sie beide doch den gleichen Weg hinauf nach Ruan Minor hatten. Was sich für Morris als Glücksfall erwiesen hatte, denn das schmale Sträßchen wurde beinahe ganz von der üppigen Vegetation links und rechts des Weges verschluckt, und außerdem gab es bis zu den ersten Häusern nicht eine einzige Lichtquelle.
Auf dem Heimweg hatte Stevyn ihm dann die Legende erzählt, dass es im Pub spuke. Angeblich lebten in der 300 Jahre alten Schänke die Geister eines alten Fischers und eines Schmugglers. Dafür gäbe es sogar einen Zeugen. Der habe nach dem Schließen der Bar vor dem Pub eine Zigarette geraucht und um das Haus herum Schritte gehört, ohne jemanden zu sehen …
Morris hatte daraufhin tief geschlafen und von wilden Gestalten geträumt, die ihm Hände voll Goldstücke entgegenhielten. Jedes Mal, wenn er danach greifen wollte, lösten sich die glitzernden Dublonen unter dem Gelächter der Piratenwesen in Luft auf.
Erst spät am Vormittag war er aufgestanden und hatte sich nach einer Tasse starkem Tee und einem trockenen Toast auf den Weg ins Dorf gemacht. Ohne die frische Seeluft würde er den Tag über nicht klarkommen.
Nun saß er auf einer Bank auf einem Felsvorsprung oberhalb des Hafens und hatte von dort den besten Blick auf das gemächliche Treiben zu seinen Füßen. Die Bucht lag weitgehend verlassen da. Die kleinen Kutter der wenigen aktiven Fischer waren noch draußen auf See. Ein in die Jahre gekommener Pick-up stand ohne Fahrer und mit offener Fahrertür auf der betonierten Fläche zwischen dem alten Schuppen aus Bruchstein, in dem unter anderem ein Fischhändler seine winzige Theke hatte, und einem ebensolchen grauen Gemäuer, in dem die mit Strom betriebene Winde stand, mit der die Fischerboote nachmittags zurück auf den Strand gezogen wurden.
Ein paar Touristen in Shorts und Sandalen liefen mit gesenkten Köpfen den kurzen steinigen Strand ab, wohl auf der Suche nach besonders geformten Kieseln. Sie folgten einem Urinstinkt, der wohl in den meisten Menschen wach wurde, sobald sie auf Wasser und Strand trafen. Morris erinnerte sich an die Aufenthalte als Kind am Strand von Brighton. Profane und zufällig geformte Steine wurden für den Augenblick unversehens zu Schätzen, die aus dem Urlaub nach Hause mitgenommen werden mussten, um die Erinnerung an den Urlaub zu konservieren.
Morris sah zwei Kinder bis an die Wasserlinie gehen, jedes eine Eistüte in der Hand. Ein paar Dohlen hüpften in gebührendem Abstand neugierig um sie herum. Wie aus Müßiggang zupften die Vögel gelegentlich an einem Fischtorso, der auf den Kieseln lag. Der Kopf fehlte und der hintere Teil. Auf den Felsvorsprüngen der natürlichen Bucht dösten Silbermöwen. Vom Wasser stieg der Geruch nach Salz und feuchtem Tang bis zu ihm hinauf. Die Sonne versprach einen heißen Tag.
Er drehte den Kopf Richtung Pub, das sich links von ihm hinter dem Maschinenhaus schuldbewusst zu verstecken suchte, als wisse es um Morris’ Qualen. Er war unfähig, den Kopf zurückzudrehen. Falsche Bewegung, ganze falsche Bewegung. Ihm wurde übel. Er fragte sich, wie er nur den Weg ins Dorf geschafft hatte. Der Filmemacher stöhnte leise, aber das brachte keine Erleichterung. In seinem Kopf hämmerte irgendwas gegen die Schädelwand, unablässig und mit teuflisch exaktem Beat. Wenigstens half die Brille ein wenig gegen die Sonne, die sich unbarmherzig auf sein Gesicht legte. Nirgendwo auch nur ein Hauch Schatten. Am besten, er setzte sich auf dem Hof des Pubs unters Dach. Kein weiter Weg, aber er würde es nicht hinbekommen. Später vielleicht. Wobei allein der Gedanke ans Pub in seinem Magen Aufruhr verursachte.
Vorsichtig wandte er sich um. Rechts hinter ihm waren Stufen in unregelmäßigen Abständen in die Felsnase geschlagen, die wie eine Wand den Hafen vom steinigen Strandabschnitt trennte. An der schmalen Treppe gab ein rostiges Eisengeländer Halt. Das Ganze wirkte nicht gerade vertrauenerweckend, vor allem nicht in dem Zustand, in dem Morris sich befand. Allerdings hatte er auch nicht die Absicht, über die Treppe auf einen der vorgelagerten Felsen zu steigen. Von dort drang seit seiner Ankunft auf dem Todden, wie die befestigte Felsnase genannt wurde, das fröhliche Hin und Her einer Handvoll Jugendlicher in Neoprenanzügen hinauf. Zu hören war außerdem ein gelegentliches lautes Jauchzen und sattes Platschen, wenn die Jungen und eines der drei Mädchen übermütig ins Wasser sprangen. Cadgwith machte einen friedvollen Eindruck. Morris schloss die Augen. London war mit einem Mal weit weg.
Ein plötzliches Klappern ließ ihn aufhorchen und die Augen öffnen. Keine drei Meter neben ihm baute ein Mann eine Staffelei auf. Neben einem Klappstuhl lehnte eine Umhängetasche, aus der ein Malkasten und eine Palette lugten.
»Sorry. Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Jamie Morris deutete ein Nicken an. Der Mann mit Hut kam ihm bekannt vor. Als er seinen Gehstock an die niedrige Mauer lehnte, die an der schmalsten Stelle der Felsnase als Absturzsicherung diente, wusste er es: Er war einer der Musiker von gestern Abend und hatte auf etwas gespielt, das wie eine Ukulele aussah.
»Ein wunderbarer Tag zum Malen.«
»Hm. Die See zeigt sich wahrlich von ihrer besten Seite«, meinte der Maler mit einem kurzen Blick auf Morris. Dann nahm er einen Pinsel zwischen die Zähne und konzentrierte sich auf die Auswahl der Farben.
Deutlicher ging es nicht. »Ich will Sie nicht stören, sorry.«
»Im Grunde wird die Natur auf ewig ein Rätsel bleiben. Ich denke oft, ich bin ein Sammler dieser Schönheit und ihrer vielen Facetten«, kam es undeutlich zwischen den Zähnen hervor.
Der Typ sprach wohl mit sich selbst. Meine Güte, ein spinnerter Esoteriker und Weltverbesserer. Morris schloss erneut die Augen und beschloss, den Maler zu ignorieren. Er hatte schon genug Kopfschmerzen.
Eine Zeit lang war es tatsächlich still. Zu still, wie Morris fand. Er öffnete die Augen einen Spalt weit. Der Maler hatte sich ganz auf sein Motiv konzentriert und den stummen Mann auf der Bank offensichtlich völlig aus seiner Wahrnehmung ausgeklammert. Mit hoher Konzentration flog der Blick zwischen Leinwand, See und der Farbpalette hin und her.
Schließlich hielt Morris es nicht länger aus. Seine Neugier war stärker.
»Sind Sie hier aus der Gegend?« Er verschränkte die Arme. Vielleicht wusste der Typ ja, wo er diesen Nutty finden könnte.
Der Maler nickte, ohne den Blick von der Leinwand zu nehmen.
»Die Aussicht ist ja wirklich toll.« Er wollte den Mann nicht überfordern, sich langsam an das eigentliche Thema heranarbeiten. Vor allem aber wollte er seinen schmerzenden Schädel nicht überfordern.
Der Maler reagierte nicht, stattdessen maß er mit dem Pinsel den Blickwinkel ab.
Morris seufzte und stand auf. Sofort war das Hämmern wieder da. Langsam näherte er sich der Staffelei. »Maler bewundere ich. Sie haben den besonderen Blick.« Er nickte anerkennend Richtung Leinwand, auf der lediglich erste grobe Umrisse zu erkennen waren. »Ich habe es mal versucht, bin aber kläglich gescheitert. Ich bin sicher, dass es großartig wird.«
Immer noch Schweigen.
»Ist das Meer hier immer so glatt?« Morris deutete über die Bucht hinaus. Was für eine blöde Frage, dachte er, aber der Typ machte es ihm mit seiner Einsilbigkeit nicht eben leicht. »Heute ist es auch besonders still, oder?«
Der Maler nickte und blieb stumm.
Am Horizont war ein Containerschiff aufgetaucht, das Richtung Ärmelkanal unterwegs war. Portsmouth, Plymouth oder Rotterdam. Morris entschloss sich zum Frontalangriff. Vermutlich verstand der Maler nur eine klare Ansprache. »Ich suche einen Mann namens Nutty. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich ihn finden kann?«
»Ich habe davon gehört. Ich habe Sie gestern Abend im Pub gesehen. Sie haben lange mit Stevyn gesprochen. Aber nein, ich weiß nicht, wo Martin stecken könnte. Er ist meist an der Küste unterwegs.«
An wen war er denn da geraten? In einem Dorf blieb aber auch nichts unkommentiert. »Er sucht wohl immer noch nach dem Schatz.« Morris’ Lachen geriet eine Spur zu sarkastisch. Warum nur fühlte er sich in Gegenwart dieser Eingeborenen immer so verdammt unsicher?
»Nutty, ich meine, Martin Ellis ist überzeugt, dass er auf der richtigen Spur ist.« Damit hatte der Maler wohl alles gesagt, was er zu sagen hatte.
Morris blinzelte gegen die Sonne. Die Temperatur stieg unaufhörlich. Ein paar Meter weiter ließ sich ein Rabenvogel auf einem Stück Fels nieder. Er duckte sich tief, spreizte seine Flügel, öffnete den Schnabel und begann zu hecheln. Sein schwarzes Gefieder schimmerte an einigen Stellen grünlich.
Er hatte plötzlich das irrwitzige Verlangen nach einem frisch gezapften Bier.
VII.
»Wie gesagt, kein Problem. Also, dann …«
Mary Morgan legte das schnurlose Telefon beiseite und atmete erst einmal tief durch. Ihr Blick ging durch das breite Panoramafenster auf die Bucht hinaus.