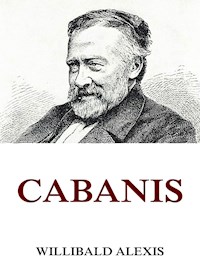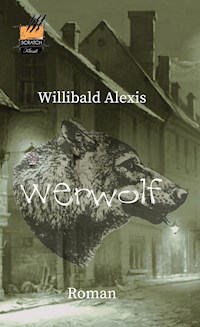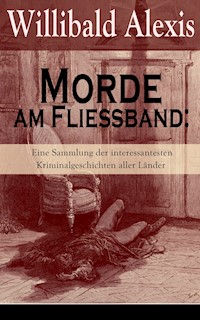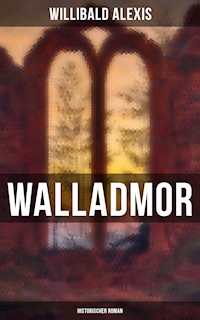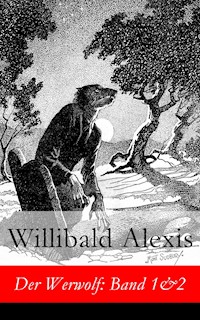Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Diese Sammlung der interessantesten Kriminalfälle der Geschichte beinhaltet 120 dokumentarerzählerische Darstellungen von Kriminalfällen, die nach Justizakten oder anderen Überlieferungen für ein Publikum bearbeitet wurden. Die Fälle stammen aus der Zeit des 17. bis 19. Jahrhunderts und werden detailliert aufgearbeitet. Aus dem Inhalt: Gescha Margaretha Gottfried Die Frau des Parlamentsrats Tiquet John Sheppard Louis Mandrin James Hind, der royalistische Straßenräuber Die Kindesmörderin und die Scharfrichterin Francesco Fava Anna Margaretha Zwanziger Eine Entführung Die Marquise von Brinvillier Blaize Ferrage Nickel List und seine Gesellen Die schöne Würzkrämerin Miß Ellen Turner Hans Kohlhase und die Minckwitz'sche Fehde. Die Ermordung des Typographen J. W. Lackner. Die Gebrüder Streicher. Anna Böckler. Marschall Bazaine. Der Buchbindermeister Ferdinand Wittmann Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit. Die Fenier-Verschwörung. Timm Thode, der Mörder seiner Familie. Der Bootsmann Paulino Torio aus San-Tomas. Miles Weatherhill. Der Wildschütz Hermann Klostermann. Die Selbstanzeige der Witwe Kruschwitz in Gassen. Der Tod des Rentier Peter Tixier. Karl Friedrich Masch, sein Räuberleben und seine Genossen Benedikt Accolti. Kaspar Trümpy aus Bern Ein Mord im Criminalgefängniß von Nürnberg Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit. Die Meuterei aus der Insel du Levant. Der Giftmörder Dr. Eduard William Pritchard Jakob Friedrich Hadopp. Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit. Johann Heinrich Furrer. Der Kindermörder Heinrich Götti. Friseur Dombrowsky Hortense Lahousse Die unsichtbare Mistress Blythe Der Wunderdoctor Frosch Das Wundermädchen aus der Schillerstrasse Wilhelmine Krautz Die Familie Tomascheck Der Nürnberger Kassendiebstahl ... u.v.m. ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 7109
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kriminalfälle der Geschichte
Willibald Alexis
Inhalt:
Willibald Alexis - Biografie und Bibliografie
Gescha Margaretha Gottfried
Die Frau des Parlamentsrats Tiquet
John Sheppard
Louis Mandrin
James Hind, der royalistische Straßenräuber
Die Kindesmörderin und die Scharfrichterin
Francesco Fava
Anna Margaretha Zwanziger
Eine Entführung
Die Marquise von Brinvillier
Blaize Ferrage
Nickel List und seine Gesellen
Die schöne Würzkrämerin
Miß Ellen Turner
Hans Kohlhase und die Minckwitz'sche Fehde.
Die Ermordung des Typographen J. W. Lackner.
Die Gebrüder Streicher.
Anna Böckler.
Marschall Bazaine.
Der Buchbindermeister Ferdinand Wittmann
Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit.
Die Fenier-Verschwörung.
Timm Thode, der Mörder seiner Familie.
Der Bootsmann Paulino Torio aus San-Tomas.
Miles Weatherhill.
Der Wildschütz Hermann Klostermann.
Die Selbstanzeige der Witwe Kruschwitz in Gassen.
Der Tod des Rentier Peter Tixier.
Karl Friedrich Masch, sein Räuberleben und seine Genossen
Benedikt Accolti.
Kaspar Trümpy aus Bern
Ein Mord im Criminalgefängniß von Nürnberg
Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit.
Die Meuterei aus der Insel du Levant.
Der Giftmörder Dr. Eduard William Pritchard
Jakob Friedrich Hadopp.
Criminalistische Miscellen aus Nürnbergs Vergangenheit.
Johann Heinrich Furrer.
Der Kindermörder Heinrich Götti.
Friseur Dombrowsky
Hortense Lahousse
Die unsichtbare Mistress Blythe
Der Wunderdoctor Frosch
Das Wundermädchen aus der Schillerstrasse
Wilhelmine Krautz
Die Familie Tomascheck
Der Nürnberger Kassendiebstahl
Straßen-, Eisenbahn- und Bankräuber in Amerika.
Die Rinderhirten im Südwesten von Nordamerika
Der Proceß Nicotera.
Der Proceß Szedlaczeck.
Ein Lynchgericht.
Ein sonderbarer Geschworener.
Eine Lotteriespielerin.
Der Proceß Pokorny.
Marie Köster.
Fieschi
Alibaud
Francois Ravaillac
Jacques Clement
Damiens
Louvel
Francesco Fava
Papavoine
Mathias Lenchauer
Eine Entführung
George Frederick Manning und Maria Manning
Eine Hinrichtung in Appenzell
Constantin Weise
Der Duc d'Enghien
Georges Cadoudal's Verschwörung
Major John André
Die fünf Mörder auf der Esperance
Die Müllerin von Fockendorf
Euphemie Lacoste
Obrist Charteris
Delacollonge
Der Jahrmarkt zu Leerdam
Der blinde Zeuge
Bletry
Don Antonio Perez und die Prinzessin Eboli
Der Kerker von Edinburg
Die Schlieffen und die Adebar
Bathseba Spooner
Peytel
Die schöne Würzkrämerin
Karl Grandisson
Die Soldprinzessin
Miguel Serveto
Eine erste Conventiklerin
Die Quäker in Boston
Eliçabide
Die beiden Markmann
Der Dieb als Vatermörder
Der Sohn des Bettlers
Contrafatto
Wilster, genannt Baron von Essen
Das papistische Complot
William Lord Russell
Der blaue Reiter
Der verrätherische Ring
Das Gelöbniss der drei Diebe
Die Tragödie von Salem
Jochim Hinrich Ramcke
Warren Hastings
Der Sohn der Gräfin von St. Geran
Ludwig Christian von Olnhausen
Mary Hendron und Margaret Pendergras
Zur Geschichte der englischen Highwaymen
Der neue Messias in Berlin
Die Geheimrätin Ursinus
Exner
Der Magister Tinius
Karl Ludwig Sand
Gerhard von Kügelgens Ermordung
Winkelmanns Ermordung
Gesche Margaretha Gottfried
Die Goldprinzessin
Das Gelöbnis der drei Diebe
Geständnis des Räubers Karl Friedrich Masch
Kriminalfälle der Geschichte, W. Alexis
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849604608
www.jazzybee-verlag.de
Willibald Alexis - Biografie und Bibliografie
Eigentlich Georg Wilhelm Heinrich Häring, bekannter Romandichter, geb. 29. Juni 1798 in Breslau, gest. 16. Dez. 1871 in Arnstadt, entstammte einer französischen Refugiésfamilie aus der Bretagne, die ihren französischen Familiennamen Hareng ins Deutsche übersetzt hatte, besuchte das Werdersche Gymnasium in Berlin, machte als Freiwilliger den Feldzug von 1815 mit, widmete sich hierauf in Berlin und Breslau juristischen Studien und wurde Auskultator und Kammergerichtsreferendar in Berlin. Bald entsagte er jedoch der juristischen Laufbahn und widmete sich ausschließlich der schriftstellerischen Tätigkeit, wobei er mitten im Gewirr publizistischer Vielgeschäftigkeit große poetische Pläne festhielt und künstlerisch gestaltete. 1856 hatte H. das Unglück, bald nach seiner Übersiedelung nach Arnstadt in Thüringen, wo er sich ein anmutiges Heim gegründet, von einem Gehirnschlag getroffen zu werden, von dem er sich nie wieder vollständig erholte. Seine eigentliche literarische Tätigkeit begann H. mit einem idyllischen Epos in Hexametern: »Die Treibjagd« (Berl. 1820), dem zwei Novellen: »Die Schlacht bei Torgau und der Schatz der Tempelherren« (das. 1822), folgten. Aus einer Wette im Freundeskreis ging ein dreibändiger Roman: »Walladmor« (Berl. 1823–24, 3 Bde.), hervor, eine kecke Mystifikation, indem der Verfasser das Werk für eine Schöpfung Walter Scotts ausgab und damit überall Glauben fand. Der Roman wurde ins Englische und mehrere andre Sprachen übersetzt. Unter derselben Maske erschien auch der Roman »Schloß Avalon« (Leipz. 1827, 3 Bde.), dem die »Geächteten« (Berl. 1825) vorausgegangen waren. Bald aber trat H. mit selbständigern Produkten auf, in denen sich Anklänge an Scott und Tieck mit seinen eignen, von der jungdeutschen Bewegung beeinflußten Reflexionen mischten, ohne daß der Objektivität der Darstellung dadurch Eintrag geschah. Unter seinen »Gesammelten Novellen« (Berl. 1830–31, 4 Bde.) und »Neuen Novellen« (das. 1836, 2 Bde.) sind einzelne, wie »Venus in Rom« und »Acerbi«, vortrefflich in Ausführung und Darstellung. Sein eigenstes Gebiet, das der historischen Romandichtung mit dem Hintergrund märkisch-preußischer Geschichte, betrat H. zuerst in seinem umfangreichsten Werke: »Cabanis« (Berl. 1832, 6 Bde.; 7. Aufl. 1893), einem charakteristischen Bild aus der Zeit Friedrichs d. Gr. Aber bereits mit dem Roman »Das Haus Düsterweg« (Leipz. 1835) schien H. wieder in andre Bahnen einzulenken. Als Reiseschriftsteller trat er in seiner »Herbstreise durch Skandinavien« (Berl. 1828, 2 Bde.), den »Wanderungen im Süden« (das. 1828) und den »Wiener Bildern« (Leipz. 1833) auf, welch letztere in Preußen verboten, während umgekehrt seine »Schattenrisse aus Süddeutschland« (Berl. 1834) von den Liberalen angefeindet wurden. Seine »Zwölf Nächte« (Berl. 1838, 3 Bde.) leiden an einer gewissen Nüchternheit und Breite des Räsonnements, die der sonst trefflichen Darstellung Eintrag tun. Sein »Urban Grandier« (Berl. 1843, 2 Bde.) war als Nachtgemälde des Fanatismus von Interesse. Zwischen der Folge seiner historischen Romane erschienen noch: »Der Zauberer Virgilius« (Berl. 1851), »Märchen aus der Gegenwart« (das. 1852) und das Bruchstück eines unvollendet gebliebenen Zeitromans, das Idyll »Ja, in Neapel« (das. 1860). Für die Bühne schrieb H. in früherer Zeit die Lustspiele: »Der Prinz von Pisa« und »Die Sonette« (1828), das Drama »Ännchen von Tharau« (1829) und den Fastnachtsschwank »Der verschwundene Schneidergesell« (1841). Auch gab er »Balladen« (Berl. 1836) und mit E. Ferrand und A. Müller »Babiolen« (Leipz. 1837, 2 Bde.) heraus. Die längere Zeit geführte Redaktion des »Berliner Konversationsblattes«, womit 1830 »Der Freimütige« verbunden wurde, gab er 1835 auf. Das von ihm mit Hitzig begonnene Werk »Der neue Pitaval« (Leipz. 1842–63, Bd. 1–33) behauptet unter allen für ein größeres Publikum bestimmten Sammlungen von Kriminalgeschichten den Vorrang. Seine eigentliche Bedeutung in der neuern deutschen Literatur errang aber Willibald Alexis lediglich mit den vortrefflichen historischen Romanen, zu denen »Cabanis« der Vorläufer gewesen war. Nacheinander erschienen: »Der Roland von Berlin« (Leipz. 1840, 3 Bde.; 6. Aufl. 1902), der die letzten Kämpfe des altmärkischen Bürgertums gegen den neuaufstrebenden Hohenzollernstamm im 15. Jahrh. zum historischen Hintergrund hat; »Der falsche Woldemar« (Berl. 1842, 3 Bde.; 5. Aufl. 1893), der die denkwürdigste Episode der mittelalterlichen Geschichte der Mark Brandenburg behandelt; der Doppelroman »Die Hosen des Herrn von Bredow« (das. 1846–48, 5 Bde.; 14. Aufl. 1900), in zwei Abteilungen: »Hans Jürgen und Hans Jochem« und »Der Werwolf« (in 3 Büchern, 7. Aufl. 1899), welche die Zeit des Kurfürsten Joachim I. und der Reformation zum Hintergrund haben; »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht« (das. 1852, 5 Bde.; 5. Aufl. 1898), die traurigste Zeit Preußens vor der Katastrophe von Jena darstellend; »Isegrimm« (das. 1854, 3 Bde.; 5. Aufl. 1899), aus den Tagen der Erhebung und des Aufschwunges nach 1806, und endlich »Dorothe« (das. 1856, 3 Bde.; 4. Aufl. 1896), welcher Roman wiederum in die letzte Zeit des Großen Kurfürsten zurückgreift. Alle diese Romane, obschon nicht völlig von prosaischen Elementen frei, erheben sich doch in der Hauptsache durch die Fülle charakteristischer Gestalten sowie durch die Wiedergabe der Zeitstimmung und die Schilderung märkischer Landschaften, aus denen die Eigentümlichkeiten der Menschen erwachsen, zu wahrhaft poetischer Bedeutung. Härings »Gesammelte Werke« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1374), die »Vaterländischen Romane« besonders in 8 Bänden (zuletzt das. 1884); seine »Erinnerungen« gab M. Ewert heraus (das. 1899). Vgl. Julian Schmidt, Neue Bilder aus dem geistigen Leben unsrer Zeit (Leipz. 1873); G. Freytag in den »Gesammelten Werken«, Bd. 16 u. 23; Ad. Stern, Zur Literatur der Gegenwart (das. 1879).
Gescha Margaretha Gottfried
1831
Ein junger Radmachermeister zu Bremen mit Namen Rumpf hatte ein dort in der Pelzerstraße gelegenes Wohnhaus im Jahre 1825 gekauft. An Warnungen von seiten seiner Freunde, daß er den Kauf unterlassen möge, hatte es nicht gefehlt. Man sagte, das Haus wäre ein Unglückshaus, in dem die Männer stürben. Vor allem aber solle er sich vor der bisherigen Besitzerin in acht nehmen und sie nicht im Hause wohnen lassen. Denn wenn auch keiner der Madame Gottfried etwas Böses nachzusagen wußte, so herrschte doch bei vielen, die sie näher kannten, eine gewisse Furcht vor ihr, die allerdings einigen Grund hatte.
In dem Hause, welches die verwitwete Madame Gottfried bis jetzt besessen hatte, waren in den letzten Jahren nicht wenige Todesfälle vorgekommen. Sie hatte ihren ersten Mann, dann ihre Mutter, ihren Vater, ihre Kinder, ihren Bruder, den zweiten Mann, alle nach einem kurzen Krankenlager, plötzlich verloren. Ja, wenn man es zusammenzählte, so hatte die unglückliche Witwe im Verlauf von vierzehn Jahren nicht weniger als dreizehn Särge bei dem Tischler Bolte, der ihr gegenüber wohnte, bestellen müssen, alle für liebe, teure Angehörige; und so auffällig war das ungewöhnliche Unglück dieser Frau geworden, daß ein hochberühmter Kanzelredner in Bremen, Dräseke, selbst auf der Kanzel für die »christlich starke Dulderin« öffentliche Fürbitten hielt.
Gegen die anständige, allgemein geliebte und wohltätige Frau selbst konnte kein Verdacht obwalten, ihr Ruf war, wenn nicht ganz unbescholten, doch durch einen untadeligen Wandel gegen alle Verdächtigung wirklicher Verbrechen gekräftigt. Wenn einige meinten, daß sie schon bei Lebzeiten des ersten Mannes mit dem zweiten in vertrauterm Umgänge gelebt habe, als erlaubt ist, so wußten diese zugleich, daß jener durch sein wüstes Leben ihr dazu Anlaß gegeben, ja wahrscheinlich diesen Umgang gewissermaßen als Ersatz für seine eigenen Untugenden zugelassen und nicht ungern gesehen hatte; vielleicht daß er sogar auf dem Totenbette gewünscht hatte, daß der Hausfreund seine Witwe heirate und gut mache, was er schlimm gemacht hatte. Und wenn sie da gefehlt hatte, so hatte sie durch ihre unerhörten Leiden gebüßt. Durch ihre religiöse Gesinnung, durch ihre christliche Wohltätigkeit, mit der sie die Lager der Kranken besuchte, liebevoll pflegte und Spenden über ihre Kräfte austeilte, sowie durch ihr bescheidenes Benehmen gegen Höhere und durch ihre Leutseligkeit gegen Untergebene war sie überall beliebt und gern gesehen. Viele wußten überdem von ihrer früheren Schönheit und Lieblichkeit zu erzählen, und auch jetzt, im angehenden Matronenalter, hatte sie eine Anmut sich zu bewahren gewußt, die überall für sie einnahm.
Madame Gottfried, von Geburt mehr dem mittleren Bürgerstand angehörend, zählte durch ihre Heiraten, ihre anscheinende Bildung und ihren Umgang schon zu den höheren Ständen. Im Hannöverschen Nachbarlande verkehrte sie freundschaftlich mit angesehenen Familien und wurde ihres Charakters wegen nicht allein gern gesehen, sondern man fand sich durch den Besuch der liebenswürdigen Frau geschmeichelt, und sie konnte nicht genug den wiederholten Einladungen nachkommen. Ihre Wohnung in dem ansehnlichen Hause, welches sie bis da besessen hatte, war elegant und mit Geschmack ausgestattet. Fußteppiche, Blumen, Kupferstiche und alle die Kleinigkeiten, welche den Aufenthalt behaglich machen und seine weibliche Sorgfalt verraten, schmückten ihr Zimmer. Auch eine kleine Bibliothek neuerer Schriftsteller fand sich darin, mit Geschmack gewählt, schönwissenschaftlichen und religiösen Inhaltes; alle im elegantesten Einbande, nur oft den Goldschnitt von Staub geschwärzt. Ihre Toilette war die einer Dame der höheren Stände, und man bemerkte die Sorgfalt, womit sie das, was das modernste war, zugleich am passendsten und am mindesten auffällig sich anzueignen wußte.
Höhere suchten ihren Umgang, Gleichstehende fühlten sich darin behaglich, Niedere waren durch ihn geschmeichelt. Ihre Dienstboten hingen ihr mit rührender Liebe und Treue an; Bewerber um ihre Hand näherten sich, wie dem jungen Mädchen und der Jungfrau, so noch der Matrone und Witwe, die jetzt um die Vierzig zählte, weniger leidenschaftlich, die meisten schüchtern, durch anständige Freiwerber. Familienväter hätten es für ein Glück geachtet, wenn eine so herzliche, teilnehmende, gefühlvolle Frau von feinen Sitten und einem hübschen Vermögen in ihre Kreise gekommen wäre. Sie pflegte indessen die Anträge in freundschaftlicher Art abzulehnen: sie habe es ihrem seligen Gottfried auf dem Totenbette versprochen, sich nicht wieder zu verheiraten. Dennoch stand ihr furchtbares Schicksal als nicht wegzuleugnende Tatsache da: die in ihrer Nähe sich immer wiederholenden Todesfälle. Einige hielten sie für schwere, unergründliche göttliche Prüfungen; andere flüsterten sich zu von einem pestartig giftigen Atem, welcher der eigentümlichen Frau als ein krankhaftes Übel anhafte.
Rumpf aber war ein entschlossener Mann, ein entschiedener Feind alles Aberglaubens, wofür er jene Meinungen und Warnungen hielt. Er kaufte nicht allein das Haus, sondern behielt auch Madame Gottfried als Mieterin in ihren bisher bewohnten Zimmern. Außerdem ließ er ihr den vertraglich ausbedungenen Mietertrag zweier Nebenhäuser.
Zu Anfang schien er allen Grund zu haben, mit seinem Entschlusse zufrieden zu sein. Man konnte sich kein angenehmeres Verhältnis denken, als welches zwischen der jungen Familie des Käufers und der früheren Besitzerin eintrat. Die freundliche Witwe, welche für nichts in der Welt zu sorgen hatte, lebte nur für die Rumpfsche Familie. Aber kaum acht Wochen, nachdem diese eingezogen war, starb die Gattin im Wochenbette. Sie hatte die Entbindung glücklich überstanden, als ein heftiges Erbrechen und Durchfall sich einstellten, welche den Tod zur Folge hatten.
Niemand konnte sich trostloser und liebevoller zeigen als Madame Gottfried. Sie war nicht vom Krankenlager der Leidenden gewichen. Die Sterbende sah in der Todesnähe nur darin einen Trost, daß sie eine solche Pflegerin für ihr verwaistes Kind und für ihren armen Mann zurückließ. Sie übergab ihr das teure Vermächtnis, für beide zu sorgen, und die Gottfried erfüllte den Willen der Gestorbenen. Sie pflegte das Kind, sie besorgte die Wirtschaft, die Küche; sie heiterte durch Unterhaltung und religiöse Zusprüche den tiefbetrübten Mann auf. »Tante Gottfried« hieß sie in der Familie.
Aber das Unglück, das die Freunde prophezeit hatten, war doch im Anmarsche. Bald darauf erkrankte, ebenfalls an Durchfall und Erbrechen, die für den Säugling in Dienst genommene Amme, und ebenso die Hausmagd. Die Amme erklärte, in dem Hause könne sie nicht gesund werden, und ging in ihre Heimat zurück.
Nun erbrachen sich Gesellen und Lehrlinge. Einer der letzteren lief auch fort. Rumpf selbst fing wenige Monate nach dem Tode seiner Frau an demselben Übel zu leiden an. Ein strenger und tätiger Mann, tat er das Seine, es nicht aufkommen zu lassen, und glaubte zuerst, die Burschen wollten sich nur über ihn lustig machen und äfften ihm deshalb nach. Er fuhr mit strenger Züchtigung unter sie, aber ohne Erfolg.
Das eigene Unbehagen des Meisters ward immer größer. Was für Speisen er auch zu sich nahm, sie erregten ihm das fürchterlichste Erbrechen. Seine früher blühende Gesundheit sank von Tag zu Tag mehr dahin. Zuerst wollte er sich selbst kurieren, er hielt seine Krankheit für die Folge einer Magenerkältung. Aber weder die eigenen noch die Mittel des Arztes schlugen an.
Eine niederdrückende Schwäche hatte sich seines Körpers bemeistert. Der kräftige, rüstige Mann war mutlos und träge geworden. Er scheute die geringste körperliche und geistige Anstrengung. Zehen und Fingerspitzen hatten das Gefühl verloren, und die entsetzliche Angst, daß er wahnsinnig werden könnte, quälte ihn. Er glaubte weder an eine Vergiftung noch an unerklärliche Einflüsse; er wollte einen natürlichen Grund auffinden, und in diesem unermüdlichen Bestreben gewann seine schon geisterhafte Erscheinung noch mehr Gespensterhaftes.
Gleich als suche er einen verborgenen Schatz, von dessen Dasein er dunkle Kunde hatte, durchstreifte er sein Haus vom Keller bis zum höchsten Boden. Er wollte in der Örtlichkeit den geheimen Grund entdecken, warum er krank sei und so viele vor ihm krank geworden seien. Er dachte an eine verderbliche Zugluft und schloß und öffnete alle Türen und stopfte alle Ritzen. Vielleicht dunstete der Fußboden, irgendein vermodernder Stoff brütete dort Gift. Er roch, atmete und lüftete die Dielen: alles vergebens.
Fast erlag er schon dieser doppelten Pein und kämpfte einen neuen Kampf, ob es wirklich geheimnisvolle Mächte gäbe, welche die Sinne der Menschen verrückten und ihren Körper heimlich verwüsteten. Da erschien die Tante Gottfried als einziger Trost des armen Leidenden. Sie pflegte ihn mit mehr als mütterlicher Sorgfalt. Jeden Morgen war sie die Erste, sich zu erkundigen, wie er geruht habe, und wenn sie hörte, daß er wieder eine qualvolle Nacht durchwacht habe, wünschte sie ihm nur etwas von dem sanften Schlafe, womit Gott sie erquicke.
Dieses Leiden dauerte jahrelang, ohne daß in Rumpfs Seele der geringste Verdacht aufstieg. Später entsann er sich wohl, daß die Magd ihm – etwa zwischen Ostern und Pfingsten 1827 – einmal Salat gebracht hatte, auf dessen Blättern er etwas Weißes, Zuckerähnliches bemerkt hatte. Da er süßen Salat nicht liebte, schalt er und ließ ihn wegwerfen. Später hatte er auch in einer Tasse Bouillon einen dicken weißen Bodensatz bemerkt; nach der Bouillon hatte er an heftiger Übelkeit gelitten. Erst im März 1828 sollte die Entdeckung erfolgen.
Er hatte sich für seine Haushaltung ein Schwein schlachten lassen. Von einem ausgesuchten Stücke, welches ihm der Schlächter brachte, genoß er einen Teil und verschloß das übrige in einen Schrank. Das Fleisch war ihm wider Gewohnheit sehr wohl bekommen; also wollte er am folgenden Tage den Rest verzehren. Bei der Öffnung des Schrankes bemerkt er, daß der Speck nicht mehr die gestrige Lage hatte. Er hatte ihn mit der Schwarte nach unten gelegt: jetzt findet er die Schwarte oben. Als er den Speck umkehrt, entdeckte er zu seinem Erstaunen darauf wieder solche weißliche Körner wie früher auf dem Salat und in der Bouillon. Tante Gottfried, die herbeigerufen wird, erklärt es für Fett. Aber jetzt steigt eine Ahnung in dem Unglücklichen auf, er schweigt und ruft in der Stille seinen Hausarzt. Die weiße Substanz wird abgestreift, durch einen geschickten Chemiker untersucht, und es findet sich darin eine nicht unbedeutende Beimischung Arsenik.
Dies geschah am 5. März; schon am 6. März wurde dem Kriminalgericht Anzeige gemacht, und nachdem dasselbe eine summarische Vernehmung der Zeugen veranlaßt hatte, begab sich eine Kommission in das Rumpfsche Haus. Die Gottfried wurde, angeblich krank, im Bette gefunden. Nach einem Verhör, das sie noch verdächtiger machte, wurde sie indessen beim Eintritt des Abenddunkels zur vorläufigen Verhaftnahme ins Stadthaus abgeführt.
Noch am gleichen Abend verbreitete sich das Gerücht davon. Eine in allgemeiner Achtung stehende Frau hatte ihre Hand in Gift getaucht, um das Leben eines Familienvaters zu verderben, mit dem sie in freundschaftlichsten Beziehungen stand. Staunen und Erschrecken bemächtigte sich aller Bewohner einer friedlichen, wegen ihres Religionseifers berühmten Stadt, in deren Mauern so selten ein Kapitalverbrechen vorfällt. Aus dem Schrecken aber wurde Entsetzen, als man mit dem einen ausgesprochenen Falle die bisherigen dunklen Todesfälle in dem Unglückshause in Verbindung brachte, Ahnungen stiegen auf, die man auszusprechen zauderte, und doch sollte die Wirklichkeit noch diese Ahnungen an Gräßlichkeit übertreffen und ein Ungeheuer ans Licht gezogen werden, das an Scheinheiligkeit, Mordlust und Furchtbarkeit alle bisher bekannten Verbrecherinnen weit hinter sich ließ.
Der Name Gottfried schwebte auf allen Zungen, bei jedem Gespräch, in jeder Gesellschaft war sie das Losungswort, und weit über das Weichbild der Stadt Bremen hinaus, ja man kann wohl sagen, in aller Welt wurden ihre Taten mit Entsetzen erzählt, wurde ihr Name mit Abscheu genannt. Aber ehe noch das volle Maß der ersteren ermittelt war, hatte sich schon die Sage derselben bemeistert, und das Gerücht vervollständigte das Gräßliche in der Art, wie es der Fassungskraft der großen Menge zugänglicher ist.
Der Heißhunger nach dem Entsetzlichen liegt in der menschlichen Natur, unzertrennbar von dem Hange nach dem Wunderbaren. Hier aber war es sehr erklärlich, daß die ungeläuterte Wißbegierde des Volkes zu dem Unerhörten auch einen wunderbaren Schlüssel suchte; der psychologische wurde erst nach unsäglicher Mühe und nach Jahren von wissenschaftlichen Männern gefunden. Was davon erfuhr das Volk? Eines ausführlichen Werkes bedurfte es, um nur die gebildete Welt über die Motive und den inneren Organismus dieser Verbrecherin ohne Beispiel aufzuklären; was aber konnte man davon dem Volke geben, dem man doch die schreienden Tatsachen nicht verbergen konnte? Es lag also in der Natur der Dinge, daß das Volk sich selbst einen Schlüssel zu all dem Entsetzlichen suchte, das zutage gekommen war.
Im Stadthause versuchte die Gottfried anfänglich zu leugnen; aber ihr ganzes zusammengeknicktes Wesen verriet die Verbrecherin, deren Kraft und Mut dahin war mit dem Scheine, den sie durch so lange Jahre aufrechterhalten hatte. Mit Erstaunen und Entsetzen zogen die Wärterfrauen der wohlgebildeten Madame Gottfried, als sie ihr der Vorschrift zufolge die Kleider wechseln mußten, dreizehn Korsetts, eines über dem andern, aus. Ihre lieblichen roten Wangen waren Schminke, und nachdem alle Toilettenkünste entfernt waren, stand an der Stelle der blühenden, wohlbeleibten Dame vor den erschreckten Weibern ein blasses, angstvoll verzerrtes Gerippe. Aber mit dem äußeren Scheinbild sank zu gleicher Zeit das moralische Trugbild zusammen, das sie seit zwanzig Jahren und mehr vor den Menschen zur Schau getragen hatte. Die Kraft zur Lüge, welche ihr Wesen zusammenhielt, zerbrach. Dazu erwachten und sprachen in ihr plötzlich die allerfurchtbarsten Traumbilder. Sie bekannte, aber nicht gestachelt von Gewissensunruhe, nicht gerührt durch den Zorn Gottes, sondern weil sie nicht mehr Kraft hatte, die Lügen aufrechtzuerhalten. Das Bekenntnis erfolgte nicht mit einem Male, es war ein fortgesetztes zweijähriges Bekennen, und auch dies Bekennen war ein fortgesetztes neues Lügengewebe: nicht mehr jene großartige Lüge, keine, die sie vom Untergang hätte retten können, sondern ein kleinliches Ableugnen, durch das sie, nachdem das Gräßlichste heraus war, noch hier und dort einen Anhalt, eine kleine Entschuldigung zu gewinnen hoffte; noch letzte Versuche, mit sich schön zu tun und das Mitleid und Interesse für sich anzuregen.
Das ungeheure Leichentuch, unter dem eine noch jetzt vielleicht nicht ganz bestimmt ermittelte Zahl von Opfern ruhte, konnte weder sie selbst mit einem Male aufdecken, noch wagten es ihre Richter, die so Unerhörtes gern selbst dämonischen Einflüssen beigemessen hätten. Die Gottfried hatte nach den ersten Verhören schon genug bekannt, um das Leben zehnfach verwirkt zu haben; die Untersuchung wurde deshalb nicht mit der Eile geführt, die bei anderen Verbrechen nötig ist, um Spuren, die verloren gehen könnten, zu verfolgen. Man durfte vielmehr, da der rächenden Gerechtigkeit auf jeden Fall ihr Recht ungeschmälert blieb, den wissenschaftlichen und humanioren Rücksichten nachgeben, um das furchtbare Rätsel eines so entarteten menschlichen Wesens gründlich zu studieren. Rechtsgelehrte, Theologen, Mediziner experimentierten an dieser Rarität, und eben um dieser Absichten willen hegte man das moralische Scheusal und pflegte es mit einer rücksichtsvollen Menschlichkeit, welche über die Begriffe von dem Verhältnis zwischen dem Richter und dem Verbrecher, wie sie in früheren Jahrhunderten geherrscht hatten, gegangen wäre.
Nie war wohl ein Strafurteil begründeter als das, welches auf Grund der Verhandlungen die Gottfried zum Tode verdammte. Die Aktenberge schienen das Tatsächliche erschöpft zu haben; und doch liefern sie nur einen Beleg für die Mangelhaftigkeit aller menschlichen Einrichtungen. Der äußere Mensch, die Gottfried, wie sie straffällig vor dem Gesetz erscheint, ist darin vielleicht splitternackt dargestellt. Aber durch kein artikuliertes Verhör und durch keine Protokolle, die ein Richter führt, kann eine Erscheinung wie die ihre psychologisch ergründet werden. Um die feineren Fäden zu verfolgen, wie aus der menschlichen Natur ein solches entmenschtes Wesen werden konnte, sind die Federn der Gerichtsstube und das Aktenpapier zu grob. Es ginge auch vielleicht über die richterliche Aufgabe hinaus. Die Akten, so klares Licht sie über die Tatsachen verbreiten, blieben doch im Rückstande über die Motive; ja, bei dem fortgesetzten Lügengespinste der eitlen Frau soll sich dort manches eingeschlichen haben und nicht wieder fortzuwischen gewesen sein, was nicht in der Wahrheit, sondern in der erfinderischen Nachhilfe, sich, wenn nicht besser, doch interessanter darzustellen, seinen Grund hat.
Ihrem erwählten Defensor, dem Dr. Voget, blieb es vorbehalten, diesem rätselhaften Wesen weiter nachzufolgen in seine scheinbar verborgensten Schlupfwinkel, um der Mit- und Nachwelt darzutun, daß hier weder dämonische Einflüsse gewaltet haben, noch daß die Gottfried eine Ausgeburt der Hölle war, sondern ein menschliches Wesen gleich uns, das nur, in Eitelkeit gesäugt, von der Sünde genährt und gesättigt, von Stufe zu Stufe immer tiefer sank. So wenig es ihm gelang und gelingen konnte, sie vor dem weltlichen Richtstuhle zu verteidigen, um so erfolgreicher war er, durch eine unermüdliche Behandlung in ihr innerstes Sein einzudringen: eine Aufgabe, die durch bloßen Pflichteifer nicht zu lösen war. Es gehörte mehr dazu, ein ganz besonderes Interesse, bei ihm durch religiöse Motive warm und frisch erhalten, um nicht durch die beständigen Rückfälle der Heuchlerin ermüdet und gereizt zu werden. Er mußte bei ihren proteischen Windungen jeden Silberblick der Wahrheit, der aus ihrer erschöpften, hohlen Seele kam, erhaschen und schnell festzuhalten versuchen; er mußte jede Gemütsbewegung benutzen, um ihrer schnell vorübergehenden Zerknirschung ein Geständnis abzupressen, welches sie aus Eitelkeit und Furcht vor strenger Bestrafung jeden Augenblick bereit war wieder zurückzunehmen oder durch eine neue Lüge zu trüben. So gelang es ihm endlich nach einer Arbeit, wie sie selten ein Geistlicher, noch seltener ein gerichtlicher Verteidiger übernimmt, ein vollständiges Bild dieses Wesens, das eigentlich nur noch ein Schemen war, zusammengehalten von der Eitelkeit, zu entwerfen, welches er in einem ausführlichen Werke »Lebensgeschichte der Giftmörderin Gescha Margaretha Gottfried, geborenen Timm. Nach erfolgtem Straferkenntnisse höchster Instanz herausgegeben von dem Defensor derselben, Dr. F. L. Voget« (Bremen 1831) niedergelegt hat. Diesem ließ er in demselben Jahre ein zweites Werk folgen: »Die Giftmörderin Gescha Margaretha Gottfried in der Gefangenschaft bis zur Hinrichtung. Nach Vollzug des Todesurteils herausgegeben von dem Defensor usw.«, dessen Inhalt sein Titel besagt. Zu Hilfe kam ihm hierbei eine Autobiographie, welche die Gottfried, wohl vorzüglich aus dem Motiv der Eitelkeit, in ihrem Gefängnisse zu schreiben bewogen wurde. Sie selbst wünschte, daß ihre Geschichte geschrieben und dem Publikum bekannt gemacht würde, sie selbst trug dies ihrem Defensor auf. Wenn ihr nichts auf Erden bliebe als ihr gräßlicher Ruf, so wünschte sie doch dies letzte Besitztum sich zu erhalten, und wenn sie in religiöser Demut zu hoffen vorgab, daß ihr Beispiel warnend auf andere einwirken werde, so gab sie daneben doch auch der schmeichelnden Hoffnung Raum, daß man sie etwas besser und interessanter darstellen werde, als wofür sie die Menge hielt.
Bei diesem Kriminalfall kommt es nicht auf eine Geschichte des Prozesses an. Dieser ist einfach genug. Die Lügenwindungen, in denen die Gottfried sich erging, um nicht mit einem Male die ganze Last aller ihrer Giftmorde auf sich gewälzt zu sehen, und die widerwärtigen Versuche, ein freundlicheres Licht auf ihre Untaten zu werfen, kommen nicht auf gegen die interessanten Zwischenfälle, die den Prozeß der Brinvillier lebendig machen. Die Verbrechen an sich sind hier die Hauptsache, vor der die gerichtlichen Verhandlungen als Nebensache verschwinden. Wir glauben unserem Zwecke genugzutun, wenn wir die Lebensgeschichte der Gottfried, das ist die Geschichte ihrer Untaten, aus dem umfangreichen Werke in eine kürzere Erzählung zusammenfassen und später daran reihen, was aus der Untersuchungsgeschichte zur Ergänzung ihrer Charakteristik von Wichtigkeit erscheint.
In der Pelzerstraße in Bremen lebte die Familie eines ehrbaren Frauenschneiders namens Johann Timm, die sich den Ruf der Arbeitsamkeit und treuen Rechtschaffenheit in der ganzen Nachbarschaft erworben hatte. Vater Timm war so fleißig in seinem Berufe, daß sie von ihm sagten, er halte beim Nähen den Atem an, um mehr Nadelstiche in einer Minute zu machen. Zu eigentlichem Wohlstände brachte er es seiner großen Tätigkeit und Sparsamkeit ungeachtet nie; aber er konnte es doch auf seinen guten Ruf hin wagen, das Haus, in welchem er später starb, anzukaufen, und so viel blieb und mußte bei seinem Verdienst übrig bleiben, daß die Armen jede Woche ihr Teil erhielten. Das war in der Bibel geboten, und Timm und sein Eheweib wollten hinter keinem biblischen Gesetze zurückbleiben. Er sang jeden Tag sein Morgenlied, besuchte regelmäßig die Kirche und galt als fromm und gottesfürchtig, was indes nicht hinderte, daß der Defensor seiner Tochter meint, seine Religiosität habe mehr in einer äußeren Werkgerechtigkeit bestanden als in wahrhafter Gottesfurcht und Liebe. Aus dieser Schule entsprang die Religiosität, ja die ganze Geistesrichtung seiner Tochter, deren Tun und Streben in wohlgefälligen Handlungen von früh auf nur dahin ging, daß es den Leuten gefalle und sie es lobten.
Am 6. März 1785 gebar Timms junge Frau Zwillinge, einen Sohn und eine Tochter. Bei diesen Kindern verblieb es. Der Sohn Johann Christoph machte später den Eltern wenig Freude. Auf der Wanderschaft geriet er in liederliche Gesellschaft, wurde verführt, krank, kostete den Eltern viel Geld, ließ sich endlich als Husar unter Napoleon anwerben, bis er nach langen Jahren als ein Krüppel wieder in seiner Vaterstadt erscheint.
Das Mädchen, Gescha Margaretha, indessen war bald die Freude und der Augapfel beider Eltern. Schwächlich, war sie doch nicht kränklich. Von der zartesten Gestalt und der feinsten Bildung, fast nur Knochen und Haut, schwebte von früh an etwas Ätherisches über ihrem ganzen Wesen, das sie für besser erscheinen ließ, als sie war. Anmutig und leicht in ihrer Bewegung, lieblich in ihrem Benehmen, mit einem freundlichen, hübschen, offenen Gesicht, war das Kind überall gern gesehen und wurde von den Erwachsenen geliebkost und anderen als Muster gezeigt.
Schon im frühen Alter von drei Jahren mußte die kleine Gescha die Schule besuchen, damit sie an ein äußeres gesetzmäßiges Wesen gewöhnt werde. Ihre Schulgespielinnen hatten Taschengeld von den Eltern und benutzten es zu Näschereien. Gescha hatte stets leere Taschen. Ohne die größte Not gaben ihre kargen Eltern keinen Groten (etwas mehr als ein Kreuzer Rhein.) aus. Da half sie sich selbst. Wenn sie von der Mutter ausgeschickt ward, um Weißbrot zu holen, brachte sie unter den größeren einige kleinere und erübrigte dadurch manchen Groten zu jenem Zwecke. Das war der erste Schritt zur Sünde, Gescha war damals sieben Jahre alt.
Der Betrug wurde nicht entdeckt. Das war eine Aufmunterung zur Wiederholung. Glücklich darüber, daß es nie herauskam, ging sie zu eigentlichen Diebereien über. Sie nahm aus der unbewahrten Tasche der Mutter einen, zwei, bis zwölf Groten. Der Verlust blieb zwar nicht unbemerkt; welche Mutter sollte aber einen Verdacht auf ihr liebliches, offenes Kind werfen, auf den »Engel von Tochter«, wie beide Eltern ihre Gescha nannten. Das verschlossene, menschenscheue Wesen ihres Bruders lenkte ihn weit eher auf sich, und Gescha – schwieg zur Verdächtigung ihres Bruders.
Fünf Jahre setzte Gescha diese Diebereien fort, ohne daß ein Verdacht auf sie fiel; fünf Jahre heuchelte sie bei diesen kleinen Sünden ein unschuldiges Wesen und ward nach wie vor belobt, gestreichelt und belohnt. Welche Schule, in der Sünde fortzufahren! Sie vergriff sich, elf Jahre alt, an fremdem Eigentum und entwendete einer alten Mamsell, die bei Timms zur Miete wohnte, eine bedeutendere Summe als jemals vorher, etwa im Betrag von einem Taler. Der Diebstahl wurde entdeckt, die Täterin nicht. Das Haus geriet in Aufruhr. Alles ward vergebens durchsucht; der Vater schloß nun auf seinen Sohn. Da rief die Mutter: »Warte nur, Vater, ich weiß schon ein Mittel und will gleich hinter die Wahrheit kommen.« Nach einer halben Stunde kam sie zurück und sprach mit zuversichtlicher Miene: »Ich hab' den Dieb gesehen. Einer klugen Frau in der Neustadt habe ich's gesagt. Die holte einen Spiegel, und wie ich hineinsehe, steht der Dieb da und guckt über meine Schulter.« Die Mutter hatte ihre Tochter dabei scharf ins Auge gefaßt, und wie ein Schwert drangen ihr die Worte ins Herz. Das ist dein Gesicht gewesen, dachte sie, und von nun an wagte sie im elterlichen Hause nie mehr etwas zu entwenden. Mit einer kleinen Erschütterung ging so die Krisis vorüber; aber es war nicht herausgekommen, sie stand, in der Verstellungskunst früh geübt, vor der Welt so rein da als vorher und war nach wie vor der Engel ihrer Eltern.
In ihrem zwölften Jahre hatte Gescha nach Ansicht ihrer Eltern genug gelernt. Sie ward aus der Schule genommen und mußte im Hause an Stelle der abgeschafften Dienstmagd alle nötigen Arbeiten verrichten, zugleich aber auch für den Vater nähen und an Wochentagen außer Hause arbeiten; das Erworbene ward ihr in der Sparbüchse aufgehoben. Der nächste Antrieb nach fremden Gute war also fortgefallen. Dagegen erhob sie ihr Fleiß bei der Arbeit in den Augen des Vaters zu einem Ideal von Vortrefflichkeit, und ihre Fortschritte im Rechnen machten sie dem Vater bei seinen Kassenabschlüssen fast unentbehrlich.
Die Tochter schien vollkommen in die Begriffe ihrer Eltern von Ordnungsliebe und Ehrbarkeit einzugehen. Sie zeigte sich genügsam und erfreut über das Kleinste, war über das Kuchenbrot, das ihr als Geburtstagsgeschenk gereicht wurde, entzückt und betete alle Gebete, welche die Mutter sie für alle Verrichtungen des Lebens gelehrt hatte, mit buchstäblicher Treue. Sie trug die Almosen für Vater und Mutter aus, und schon früh war es ihr eingeprägt, daß solche Taten der Wohltätigkeit hohen Wert hätten und die Danksagung der Armen zu Verheißung göttlicher Vergeltung würden; ein Wahn, der später von furchtbarem Einfluß auf ihr Leben wurde. Aber sie gehörte auch zu den weichen, reizbaren Seelen, die, jedem Gefühl und aufregenden Einfluß offen, leicht zu Tränen gerührt werden. Des Vaters frommes Morgenlied, die stille Ordnung des Hauswesens erfüllten oft das Herz des Mädchens mit lebhafter Rührung; auch religiösen Eindrucken blieb sie nicht verschlossen, obschon der amtliche Religionsunterricht ohne Wirkung auf sie geblieben zu sein scheint. Aber es war eine leichte Erregbarkeit, die mehr den Nerven angehörte und die Seele nicht berührte. So weinte sie auch später und konnte aufs tiefste gerührt scheinen, war es auch vielleicht für den Augenblick, wenn ihr Opfer unter den entsetzlichsten Qualen verschied. Aber die Summa dessen, was sie im elterlichen Hause erlernte, war der Schein eines Wertes, den sie nicht besaß. Denn die Zuneigung der Eltern wurde bald eine blinde, grenzenlose, die dem Mädchen von hellem Kopfe nicht unbekannt blieb und ihr ein Bewußtsein einimpfte, welches sie aus der Sphäre ihres wirklichen Seins in einen leeren Zustand besseren Scheins erhob.
Geiz und eigentliche Habsucht blieben ihr, auch als sie auf der Laufbahn des Verbrechens raschen Schrittes forteilte, immer fremd; selbst die Genußsucht war kein Motiv, das sie bei ihren Handlungen beherrschte; sie hatte kein heißes Blut, keine starken Leidenschaften. Nur als die Sünde auf anderen Wegen ihrer Meisterin geworden war, ließ sie das Weib, das nun ihre Sklavin war, alle Laster auskosten, indem mit der einen alle Schranken der Tugend gebrochen und gefallen waren. Aber es war der Ehrgeiz, in jener vornehmeren, ausgezeichneteren Sphäre, in die sie der Zufall und die Gunst der Menschen versetzt hatten, sich zu erhalten, es war die Eitelkeit, welche ihr besseres Selbst mehr und mehr aufzehrte und damit einer furchtbaren Selbstsucht Nahrung gab, welche sie endlich kaltblütig zu den gräßlichsten Mordtaten schreiten ließen, sobald ein oft nur scheinbarer Vorteil in Aussicht stand.
Sie lernte in einem Nachbarhause – die Eltern konnten ihrem Engel schon nichts mehr abschlagen – tanzen. Sie spielten Sonntags Komödie. Bald war das ganze Leben des dreizehnjährigen Mädchens eine Komödie, in der sie die große Rolle durchführte, allen Leuten zu gefallen, eine Rolle, mit solcher Kunst durchgeführt, daß man ihr erst im dreiundvierzigsten Jahre ihres Lebens die Larve vom Gesicht riß! – Gescha spielte unter ihren Gespielinnen am besten, sie bekam die besten Rollen; sie war die Schönste, man schmückte sie am schönsten mit Bändern und Schleifen heraus. Sie war die Königin des Spiels, und die armselige Alltagswoche konnte nur in Erwartung des berauschenden Sonntagsvergnügens ruhig verlebt werden. Aber doch spielte sie auch die übrigen sechs Tage zu Hause Komödie: sie ließ nichts von ihrer Lust dazu merken! Am Montag freilich fiel sie aus der Rolle; sie wischte die Schminke von gestern noch nicht ab, die ihr so wohl stand, und die Mutter begnügte sich damit, darüber zu lächeln.
Sie war zur Jungfrau aufgeblüht. Ihr äußerlicher Liebreiz war gewachsen. Die charakteristische Weichheit ihres Herzens schien nur noch mehr ausgesprochen. Von den Müttern wurde sie ihren Töchtern als Muster vorgestellt, von diesen selbst aber nicht etwa beneidet, sondern innig geliebt.
Gern hätte Gescha, in ihrem Studium dessen, was vor den Menschen gilt, weit vorgeschritten, musikalischen Unterricht gehabt und Klavierspielen gelernt, das war aber von den Eltern zu viel gefordert, die nur für Notwendiges und Nützliches Geld ausgaben. Auch schien es doch unpassend für ein Bürgermädchen, das als Magd im Hause arbeitete. Ein- oder zweimal in der Woche kehrte sie auch wohl, den Besen in der Hand, vor dem Hause. Und dennoch entschlossen sich die Eltern, ihr – französischen Unterricht geben zu lassen, weil sie meinten, ein so außerordentliches Kind müsse bei seinen seltenen Geistesgaben doch wenigstens eine besondere Kenntnis vor allen Töchtern gleichen Standes voraushaben. Aber schon hier betrog sie. Der wissenschaftliche Unterricht war viel zu ernsthaft für ihr leichtfertiges Gemüt. Die aufgegebenen Arbeiten langweilten sie, und sie ließ sie sich von einem befreundeten Tischlergesellen, der vollkommen französisch sprach, aufschreiben, arbeitete aber sorgsam einige Fehler hinein, um den Betrug nicht zu auffällig zu machen. Sie erntete für ihre vortrefflichen französischen Aufsätze das größte Lob ein, das sie in Bescheidenheit hinnahm. Aber mit dem wenigen, was sie aufgefaßt hatte, putzte sie später ihre oberflächliche Bildung aus, und es diente ihr zu dem Lug und Trug, den sie in höheren Kreisen so geschickt wie in den niedrigeren fortspielte.
Bei einer sogenannten Korporalsmahlzeit – einem jährlichen Schmause der nach altertümlicher Weise in eine Miliz eingeteilten Bürger – trat Gescha, damals sechzehn Jahre alt, zum ersten Male in die Welt. Jubel, Tanz und Spiel begleiteten mehrere Tage lang diese Feier. Sie zog aller Augen auf sich. Aber die Sinnlichkeit war in der Jungfrau noch nicht erwacht. Sie war mannigfachen Nachstellungen ausgesetzt, hat aber in dieser Beziehung den unbescholtensten Ruf mit in die Ehe genommen. Heiratsanträge kamen schon in diesem sechzehnten Jahre. Drei wurden ohne weiteres von Vater und Tochter zugleich abgelehnt; ein vierter und, da der Freiwerber ein junger wohlhabender Meister des Gewerbes war, ziemlich verlockender nur auf Überredung des Vaters. Gegen Person und Vermögen des Werbers hatte der alte Timm nichts einzuwenden, wohl aber gegen den Handwerkszweig, weil es sein eigener war. Da Geschas Bruder dereinst in Bremen Meister werden sollte, fürchtete der fern in die Zukunft rechnende Alte einen Brotneid zwischen den Geschwistern. Gescha hatte den Werber zwar nicht gerade geliebt, aber es durchzuckte sie doch mit Eiskälte, als sie den abgewiesenen Werber an der Hand einer anderen jungen Braut dahinschreiten sah.
Gescha – vielmehr Gesina, wie sie sich jetzt nennen ließ, da ihr jener Name zu gemein klang – wuchs, wie an Schönheit und Jahren, so an Liebe im Herzen ihrer Eltern; sie, die ausgezeichnete Tochter, die über ihrer Art stand und doch Vater und Mutter auch nicht den geringsten Kummer verursachte, während der Bruder, ein ausschweifendes Leben in Hamburg und Paris führend, Schulden machte, sein Erbteil verzehrte und schon anfing, als verlorener Sohn betrachtet zu werden. Auch der Ruf ihrer Sittsamkeit und Tugend wuchs unter ihren Gespielinnen, denn ihre wunderbare Erscheinung lockte Vornehmere heran, aber Gesina unterdrückte alle Wünsche des Herzens, sobald sie wahrnahm, daß der Bewerber keine ehrbaren Absichten haben könnte.
Eines Abends war sie im Theater in Begleitung ihrer vertrauten Freundin Marie Heckendorf, die in ihrem Leben eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Es war das erstemal, daß sie das Theater besuchte, und dieser Besuch sollte für ihr Leben von großem Einfluß werden; aber die Gottfried erinnerte sich später trotz ihres vortrefflichen Gedächtnisses weder des Namens noch des Inhaltes des Stückes und wußte nichts davon, als daß eine sehr schöne Person, Elise Bürger, darin mitgespielt habe. In der Loge des zweiten Ranges, wo sie saß, drängte sich ein dicker vornehmer Herr an Gesina heran, der sie mit Artigkeiten überschüttete und nachher, wiewohl umsonst, dem schönen Mädchen nachstellte. In der Person eines Nachbars, des jungen Miltenberg, erschien aber zugleich ein Beschützer, welcher sich während der Aufführung zwischen den galanten Herrn und das hübsche Mädchen drängte und dann aus nachbarlicher Pflicht Gesina aus dem Theater bis in ihr Haus begleitete.
Vom Augenblick dieses ritterlichen Dienstes an entspann sich zwischen beiden kein Liebesverhältnis, aber eine stumme Beobachtung und Aufmerksamkeit; Miltenberg ging immer vor des alten Timm Hause vorüber, wenn Gesina mit dem Besen davor kehrte, und unterließ nie zu sagen: »So fleißig?« Gesina dagegen fand, daß das Wasser im Miltenbergschen Brunnen das beste in der Straße sei, und holte es daher für die Wirtschaft von dort, was nicht auffällig war, da Miltenbergs Haus dem ihrer Eltern schräg gegenüber lag. Auch kaufte sie im Gürtlerladen, wenn der junge Miltenberg verkaufte, gern ein paar Kleinigkeiten, und Miltenberg begleitete sie dann hinaus. Liebe war auf ihrer Seite nicht im Spiel, aber Eitelkeit und für ihre Lage eine glänzende Aussicht.
Der junge Miltenberg war eigentlich nichts weniger als berufen, ein Beschirmer der Unschuld und Sittsamkeit zu sein. Als verzärtelter einziger Sohn eines wohlhabenden Vaters hatte er schon vor seiner ersten Verheiratung ein wüstes Leben geführt. Eine ältere Buhlerin hatte ihn dann in ihre Netze zu locken gewußt; aber nachdem sie Madame Miltenberg geworden war, hattte sie keinen Grund abgesehen, noch länger die Larve des Anstandes vor dem Gesicht zu behalten. Wollüstig, dem Trunk ergeben, jähzornig, widerwärtig in jeder Beziehung, hatte sie dem jüngeren und schwächlicheren Gatten das Leben unerträglich gemacht und seine Kräfte ausgesogen. Von einem gewaltigen Körperbau, hatte sie ihn nicht selten im trunkenen Zustande untergekriegt und mißhandelt, ja diese Familienszenen nicht in der Verschwiegenheit der vier Wände abgetan, sondern manchen Skandal vor Zeugen, ja auf der Straße wiederholt.
Der Tod des frechen Weibes hatte nun zwar den armen Menschen aus den lästigen Eheketten erlöst, aber mit seiner Gesundheit schien auch seine Ehre und sein ganzes moralisches Wesen bis auf den Grund zerstört. Er schleppte sich hin in Faulheit und Liederlichkeit und suchte in Weinstuben und bei gemeinen Dirnen Trost oder Vergessenheit für sein zerfallenes Leben. Sein Vater, ein wohlhabender Mann, galt, obwohl er nur Sattlermeistei war, für einen vornehmen Herrn. Er besaß das größte Haus in der Straße, welches mit sieben kleinen Nebengebäuden, die ihm zugehörten, einen eigenen Hof, »Miltenbergs Hof«, bildete. Die Zimmer waren schön möbliert, und eine Sammlung Ölgemälde, die man für wertvoll hielt, brachte ihn mit angesehenen Leuten und sogar mit Senatoren in nahe, freundschaftliche Verbindung. Der Vater konnte das Lasterleben des Sohnes nicht länger mit ansehen. Mit dem Menschen gingen auch die Wirtschaft und das Geschäft zugrunde. Vater und Sohn gerieten oft in heftigen Streit, und endlich soll der Alte dem Jungen erklärt haben, das einzige, was ihn wieder mit ihm aussöhnen könne, sei eine anständige Heirat, und die einzige anständige Heirat, die ihm gefalle, mit Timms wohlgeratener Tochter.
Der Sohn hatte seinerseits nichts dagegen einzuwenden, nur fürchtete er sich bei seinem bekannten ausschweifenden Leben vor dem Antrage. Dazu ward als Mittelsperson ein Magister ausersehen, welcher mit seiner lateinischen Gelehrsamkeit und seiner stilistischen Kunst schon oft zu Rat und Hilfe in beiden Familien zugezogen worden war und auch noch später als Vermittler in manchen schwierigen Fällen auftrat. »Fein schwarz gekleidet, damals jung und von sehr ehrbarem Aussehen«, wie sich die Gottfried bei ihrem lebhaften Gedächtnis für alles Äußerliche noch im Gefängnis entsann, erschien der Brautwerber beim alten Timm und brachte in zierlichsteifen Worten seinen Antrag vor. Der künftige Reichtum des einzigen Erben, das große Miltenbergsche Haus, für das schon einmal zwanzigtausend Taler geboten worden wären und auf dem nur tausend Taler hypothekarisch lasteten, das köstliche Mobiliar, die Gemäldesammlung, in der sich Stücke von dreihundert Taler Wert befänden, das alles glänzte dergestalt in der Rede, daß Vater und Mutter Timm vor Freude zitterten und auch nicht an die Möglichkeit einer abschlägigen Antwort dachten. Die Tochter ward hereingerufen, um ihr Glück zu erfahren, und die Tränen, die sie vergoß, galten als eine Einwilligung, an der überdies bei dem Verhältnis zwischen Eltern und Tochter die ersteren nicht im entferntesten zweifeln konnten.
Das glücklichste Ereignis ihres Lebens, wofür die drei es hielten, ward nicht von jedermann so angesehen. Timms Freunde schüttelten bedenklich den Kopf und hielten es für eine große Torheit, daß er das tugendhafte, schöne Mädchen um Geldes willen mit dem wüsten, entnervten und leichtsinnigen Menschen zusammenkuppelte. Die Mutter erwiderte, wenn die jungen Leute nur Brot hätten, würde alles übrige schon von selbst kommen.
Der verwüstete Haushalt bei Miltenbergs verlangte eine schnelle Änderung. Die Heirat wurde am 6. März 1806 feierlich begangen, und obgleich die Gottfried sich der kleinsten äußeren Umstände entsann, z. B. der ersten seidenen Strümpfe, die ihr der Bruder aus Hamburg schickte, und der Ermahnungen der Freunde, daß ihr Mann nicht weinen solle, so erinnerte sie sich weder der Trauungsrede noch des Predigers, der sie verband. Die Trauung fand in Miltenbergs Hause, und zwar in der großen Hinterstube mit den Ölgemälden, statt. Über dem Kopfe der Braut hing die Mutter Jesu mit dem Kinde, rechts ein Abendmahl, links ein Petruskopf. Es war dieselbe Stelle, wo sie später ihre Mutter vergiftete.
Diese Ehe konnte nur das Selbstgefühl der jungen Frau nähren. Durch Sitte, Bildung, Achtung vor der Welt, Verstand und Lieblichkeit weit über ihrem Gatten stehend, war sie wie von selbst die Herrin im Hause, Sie war die Wiederherstellerin der Ordnung und des Friedens zwischen Vater und Sohn. Beide erkannten es, und sich in Dank erschöpfend, opferten sie täglich am Altare ihrer Eitelkeit. Miltenberg, so oft durch die Schande seiner ersten Frau von den Leuten aufs tiefste beschämt, setzte seinen Stolz darein, die junge schöne zweite Frau zu einer vornehmen Dame zu machen. Er fühlte sich um so mehr verpflichtet, sie äußerlich, so hoch zu stellen, da er ihrer Jugendfrische nur einen entnervten Körper und einen abgestumpften Geist entgegensetzen konnte, ja nicht einmal so viel Macht über sich selbst besaß, mit dem Besitz des schönen Weibes zufrieden zu sein und seiner früheren Lebensart, dem Umhertreiben in den Schenken und Klubs, und seinen gewohnten Ausschweifungen zu entsagen.
Die liebebedürftige Jungfrau konnte nichts für diesen Mann empfinden, sie mußte im Stolz auf ihre äußerliche glückliche Lage, in ihrer befriedigten Eitelkeit den Ersatz suchen. Er verreiste und kam schlaff und gleichgültig wieder.
Statt der Liebe brachte er ihr eine Verehrung entgegen, die ihr Herz nicht wärmte. Prächtige Kleider, Damenhüte, alle möglichen rauschenden Vergnügungen mußten die Leere ihres Herzens füllen, und sie verdrängten die stillen und frommen Gefühle, welche im elterlichen Hause gepflegt worden waren.
Auch ihre Eltern erkannten zu spät, was ihrer Tochter zum Glück fehlte. Auch sie bemühten sich, es sie vergessen zu machen, indem sie ihre Miltenbergin (wie sie von der Mutter genannt wurde, die den gemein klingenden Namen Gescha umgehen wollte) selbst zu lärmenden Lustbarkeiten geleiteten. So besuchten sie namentlich zu diesem Zwecke wieder die schon erwähnten Korporalsmahlzeiten.
Der junge Miltenberg hatte von ungefähr beim Glase Wein mit einem lebensfrohen jungen Weinreisenden namens Gottfried Freundschaft geschlossen. Gottfried war bei einer Korporalsmahlzeit der gefällige, liebenswürdige Nachbar der Madame Miltenberg; nachher beim Tanze wurde er ihr Tänzer, und zwar ihr alleiniger Tänzer während des ganzen Balles. Die Mutter flüsterte ihr warnend zu: »Ich glaube, dein Mann ist unzufrieden über dich«. Der Vater kam am anderen Morgen zur Tochter und machte ihr die heftigsten Vorwürfe über ihr Betragen auf dem Tanzboden: »Du hast deinen Mann ganz vernachlässigt. Solange ich lebe, gehst du nicht wieder in eine solche Gesellschaft. Eine Frau muß nicht ihren Mann zurücksetzen, wie du es gestern getan hast.« Aber der Mann selbst war gestern abend ganz zufrieden gewesen; in brüderlicher Herzlichkeit, Arm in Arm mit dem Freunde und der Frau, war er nach Hause gegangen. Was konnte nun der Vater dagegen einwenden? Deshalb gingen sie schon an diesem Tage wieder auf denselben Tanzboden, dieselbe Gesellschaft fand sich zusammen; Miltenberg, der selbst nicht tanzte, führte seiner Frau den Freund als Partner zu, und das Spiel von gestern ward fortgesetzt, nur daß Madame Miltenberg nach ihrem Bekenntnis »sich vor den Leuten genierte« und ihrem Tänzer zu verstehen gab, daß auch er sich vorsehen möge.
Von diesem Tage an richtete sich ihr Sehnen und Wünschen auf Gottfried. Ihre Sucht, vornehmer, gebildeter, besser zu erscheinen, ihr Hang zu Putz und prächtigen Kleidern bekam neue mächtige Triebfedern. Stundenlang stand sie vor dem Spiegel, um zu wissen, wie Gottfried sie am schönsten finden möchte. Sie erschrak über ihre Blässe, erinnerte sich der Schauspielerkünste ihrer Jugend, und von jetzt ab waren ihre Wangen nicht mehr blaß. Das war ein wesentliches Moment für die Folge ihrer Verbrecherlaufbahn: die Schminke wurde »die rettende Maske vor dem verräterischen Erröten und Erblassen des Gewissens«.
Miltenberg sah die nähere Bekanntschaft Gottfrieds mit seiner Frau offenbar gern und beförderte sie. Eifersucht war ihm von Natur fremd, er fühlte vielleicht, daß er ihr einen Ersatz schuldig war; noch mehr freute er sich, ungestört seinen Vergnügungen nachgehen zu können, während Gottfried seiner Frau die Zeit vertrieb. Endlich war Miltenberg ein Freund des Weines und liebte frei zu trinken; Gottfried aber setzte so manche Flasche auf den Tisch oder brachte sie sogar unter dem Mantel mit ins Haus.
Dies geschah jedoch erst später. Anfangs schien Gottfried selbst sein Glück nicht verfolgen zu wollen; sei es, daß er zu gewissenhaft war oder, was wahrscheinlicher ist, es überhaupt nicht in seiner Art lag, nach der letzten Gunst bei Frauen zu ringen. Gerade diese Zurückhaltung entzündete aber immer mehr die Glut im Herzen der jungen Frau. Das heftige Verlangen ging in stillen Schmerz über, in einen Unmut, der ihr ganzes Wesen durchdrang. Ihren Angehörigen, die es merkten, log sie vor, es sei die Furcht, kinderlos zu bleiben. Auch diese Lüge, wie alle ihre bisherigen, fand nicht allein Glauben, sondern wurde auch belobt. Sie war und blieb das Schoßkind der Eltern, mit denen das frühere kindliche Verhältnis merkwürdigerweise fortdauerte, und auch der Schwiegervater sah ihr ihre Wünsche ab. Um ihren angeblichen Kummer nicht zu mehren, ließ er ein Bild über ihrem Bette fortnehmen, welches er früher schalkhafterweise dahin gehängt hatte. Es war das Bild eines jungen englischen Mädchens, das recht oft anzusehen er ihr empfohlen hatte.
Im Winter 1807 zeigte sich die junge Frau zur unsäglichen Freude der Familie guter Hoffnung. Man trug sie auf den Händen. Mutter Timm, abergläubischer Natur durch und durch, ließ eine Kartenlegerin holen, um das künftige Schicksal der Tochter zu erfahren. Das dunkelgelbe Weib machte auf die Schwangere einen grauenhaften Eindruck. Sie wußte aber später nur, daß die Mutter von der Kartenlegerin viel Betrübendes erfahren habe. Vor ihrer Niederkunft nahm sie, seit sieben Jahren zum ersten Male, auch wohl nur aus abergläubischer Furcht, mit ihrer Familie das Abendmahl. Aller ihrer religiösen Floskeln ungeachtet war es zugleich das letztemal in ihrem Leben.
Die Mutter hatte in den Rock der Schwangeren eine wundertätige Wurzel genäht, auch ins Kopfkissen ihres Bettes Knoten geschlungen, eine Vorsicht, die sie später bei jedem Wochenbette in Anwendung brachte. So genas die Miltenberg denn im September 1807 leicht und in Gesundheit einer ersten Tochter, die den Namen Adelheid erhielt. Das arme Kind trug an seinem Leibe als Erbteil der ausschweifenden Lebensweise des Vaters die Spuren einer Krankheit, deren Ursache man zu verbergen suchte, indem man die Amme entfernte.
Die reine, natürliche Mutterliebe hat die Verbrecherin nie empfunden; es freute sie, Mutter zu sein, um der Zeichen von Teilnahme willen, welche sie in ihrem Wochenbett empfing. Jene Entdeckung vermehrte nicht ihr eheliches Glück, und die Aussicht, vor Ablauf von Jahresfrist aufs neue Mutter zu werden, stimmte sie sogar zum heftigsten Mißmut.
Doch hatte sich inzwischen statt des noch zaudernden Gottfried ein anderer Tröster eingefunden, abermals ein Weinhändler, abermals ein Freund von Miltenberg und jemand, den das böse Geschick in der Nähe des Miltenbergschen Hauses verkehren ließ. In der Biographie der Gottfried wird er in Berücksichtigung seiner noch lebenden Familie mit dem Pseudonamen Kassow aufgeführt. Kassow war verheiratet, Vater, nicht schön und mit einem starken Bauche ausgestattet. Aber er besaß Verführungskünste. Kaum daß es deren bedurft hätte, wenn ihm ein Blick in die Seele des erstrebten Gegenstandes gestattet gewesen wäre. Das Begehren war bei ihr da, eine heftige Neigung zu Gottfried: und Gottfried zauderte. Aufgeregt, erzürnt, ohne allen moralischen und religiösen Halt, hätte sich die getäuschte und verlangende Frau vielleicht einem jeden in die Arme geworfen, der sie ihr in stiller Heimlichkeit entgegengebreitet hätte, wohlverstanden aber einem jeden, dessen Neigung ihrer Eitelkeit schmeichelte, dessen Stand und Wohlstand sie über ihre Sphäre erhob. Die Miltenbergs, wenn auch wohlhabend, gehörten dem Handwerksstande an, Kassow war wie Gottfried ein Kaufmann; er liebte Lust und Aufwand und war ein jovialer Lebemann. Aber noch schützte das geistig schutzlose Weib wider ihren Willen die selbstgefertigte Maske von Tugend und Anstand. Alles kam Kassow zu Hilfe, und doch hielt er in seinen Angriffen zurück. Miltenberg war auch sein Busenfreund geworden, denn auch Kassow spendete aus dem Weinlager gegenüber, dessen Aufseher er war, an den durstenden Ehemann Flasche um Flasche. Miltenberg lud ihn täglich ins Haus; er mußte Beefsteaks und Hasenbraten bei ihm verzehren und brachte dafür Wein in der Tasche mit. Er konnte es wagen, der feinen Madame Miltenberg Geschenke mit Weinflaschen zu machen, die in der Regel ihr Mann leerte, welcher die Frau dann bat, sie möge Kassow nicht anders wissen lassen, als daß sie selbst den Wein ausgetrunken hätte. Kassow arrangierte Partien über Land, wobei die ländlichen Freiheiten benutzt wurden. Sie kam solcher Aufmerksamkeit mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegen. Geschenke und Briefe wurden später ein täglich angewandtes Mittel ihrerseits, sich die Freundschaft und Liebe ihrer alten und neuen Bekannten zu sichern. Sie schenkte Kassow eine Tuchnadel mit einer Haarlocke, wollte aber gern das Geschenk mit einigen bedeutungsvollen Worten begleiten. Nun war sie in der Kunst des Briefschreibens nicht geübt – auch später bediente sie sich der Hilfe von dem und jenem, denn sie hatte immer unsichtbare Vertraute hinter jeder Kulisse stehen –, Miltenberg aber war sehr geschickt darin, und sie übte den ersten ehebrecherischen Betrug, indem sie ihn ersuchte, für eine Freundin einen sinnvollen Brief aufzusetzen, die ihrem Freunde eine Tuchnadel schenken wolle. Der »sinnvolle« Brief lautet: »Nicht die Locke sei Ursache, daß Sie sich meiner erinnern; nein, das Gefühl für Freundschaft und Tugend mehre sich täglich in Ihnen, wie ich nie aufhören werde, mich zu nennen usw.«
Und doch, wunderbarerweise, gelangte Kassow noch immer nicht zu dem erstrebten Genuß. Eine zweite, zwar glückliche Niederkunft, aber mit einem toten Kinde, kam störend dazwischen. Die Miltenberg blickte mit Schaudern ihre Magerkeit an und fürchtete, daß ihr Ansehen bei den Leuten dadurch Einbuße erleiden möchte. Die Auspolsterung eines einfachen Kleidungsstückes könne, fürchtete sie, sich leicht verschieben und sie auf diese Weise entdeckt werden. Deswegen verfiel sie auf den Gedanken, sich Korsetts über Korsetts anzuziehen, was sicherer war und zugleich den Vorteil bot, daß, indem sie eins über das andere tat, der Schein einer natürlich anwachsenden Fülle ihres Körpers gewonnen wurde. Sie kam bis zur Zahl dreizehn! So glücklich fiel diese wie alle ihre betrügerischen Handlungen aus, daß es erst zwanzig Jahre später bei ihrer Gefangensetzung entdeckt wurde. Das Volk in Bremen schrieb damals diesen Korsetts eine magische Kraft bei. Die Gottfried habe sich mit ihrer Hilfe unsichtbar machen, ja fliegen können. Dennoch wurden bei der öffentlichen Versteigerung ihrer Effekten die siebzehn wohlerhaltenen Korsetts für ein paar Groschen verkauft; gewiß eine Merkwürdigkeit, da Englands reiche Kuriositätensammlungen der Stadt Bremen so nahe sind. Durch die naturwidrige ununterbrochene Einschnürung des oberen Körpers schadete sie nicht wenig ihrer Gesundheit.
Im Herbste desselben Jahres, nach ihrer zweiten Niederkunft, blühte das zarte Verhältnis zwischen ihr und dem Kassow wie vorher. Kassow hatte eine vorteilhafte Geschäftsreise nach Berlin vor; in der Stunde der Trennung, bei Punsch und Küssen, reifte die von beiden Seiten genährte Sünde zur Tat. Madame Miltenberg mußte sich um des Auslandes willen untröstlich stellen; aber Kassow beschwichtigte ihre Tränen durch das Versprechen eines schönen und großen Geschenkes, das er ihr aus Berlin mitbringen wolle, und niemand wußte um das Vorgefallene; also war alles gut.
Um diese Zeit erschien Gottfried wieder. Eine jährliche Geschäftsreise hatte ihn aus Bremen entfernt. Dieser Michael Christian Gottfried wird uns so geschildert: eine kerngesunde, kräftige Natur, leichten Blutes bei vollen Säften; zwar nicht schön, aber von keiner unangenehmen Gesichtsbildung, gewandt in seinem Benehmen, ein guter Tänzer, Reiter, Guitarrenspieler und Sänger, mit männlich kräftiger, klangreicher Stimme. Dagegen bezeichnen ihn seine nächsten Bekannten als einen gutmütigen, aber charakterlosen Menschen von verliebter Natur und ohne religiöse oder tiefere sittliche Haltung, obwohl als Eigenheit an ihm bemerkt wird, daß er seine Eroberungen beim weiblichen Geschlecht selten bis zum letzten Angriff ausdehnte, sich vielmehr vor dem Siege abwandte. Ihm war es mehr um ein eitles Spiel, um eine sentimentale Unterhaltung zu tun, was, wie man meinte, in einer phlegmatischen Organisation seines Körpers den Grund hatte. Den Mangel wahrer geistiger Vorzüge verdeckte seine Jovialität, ein gewisser Grad äußerer, doch nur im geselligen Verkehr glänzender Bildung, welche er seinen Reisen und seiner Belesenheit verdankte. Er besaß eine elegante Bibliothek der damaligen Klassiker von Kotzebue und Lafontaine bis zu Klopstock hinauf, auch geistliche Morgen- und Abendopfer darunter; nur vermissen wir in dem uns mitgeteilten Verzeichnisse, merkwürdig genug, Goethes Werke, wogegen eine Menge Gedichte und Liedersammlungen vorkommen, durch seine große Liebhaberei für Gesang und gesellige Freuden erklärt. Gottfried war in dieser Beziehung selbst Schriftsteller und hat zwei Sammlungen Lieder mit Gesängen herausgegeben. Seine »Blumenkränze geselliger Freude« (Bremen 1808) haben sogar vier Auflagen erlebt. Seine »Blumenlese« (Bremen 1816) ist vergriffen.
Der alte Miltenberg hatte sein Haus dem Sohne übertragen. Es wurden die Zimmer darin an einzelne Herren vermietet; ein Umstand, der nicht wenig zum verbrecherischen Entwicklungsgange der gefallenen Frau beitrug. Der Zufall wollte, daß Gottfried bald ausziehen mußte, und Miltenberg nahm ihn in sein Haus auf, ja er gab ihm die Vorderstube, welche bis da seine Frau bewohnt hatte, natürlich mit deren voller Einwilligung. Gottfried ging ein, aber – in keiner verbrecherischen Absicht. Er hatte von Kassows Verkehr mit der Miltenberg gehört und strebte jetzt noch weniger nach dem verbotenen Gute. Ihm war nur die Aufmerksamkeit der schönen jungen Frau schmeichelhaft; zudem liebte auch er auf fremde Kosten zu zehren und zugleich ein gemütliches häusliches Leben, ohne dafür viel auszugeben. Beides fand er bei Miltenberg; er war in den Schoß der Familie aufgenommen, verbrachte dort die Abende, aß an ihrem Tische und gab die Klubs und Wirtshäuser auf. Durch seine Aufmerksamkeiten gegen die schöne Frau, indem er ihr Serenaden brachte, ihr Blumenbrett schmückte, den kleinen Garten bestellte, suchte er es zu vergelten. Er verführte nicht, er ward verführt.
Die junge Frau hielt es für dienlich, in Schwermut zu verfallen, sie klagte über ihren rohen Mann, der sie stets verlasse, und daß er, wie ihr Gemüt, auch ihre Kasse leer lasse. Gottfried war leicht zu rühren; er schenkte ihr nicht allein Mitleid, sondern gab ihr auch dann und wann ein Darlehn zur Bestreitung ihrer angeblich nötigsten Bedürfnisse für die Haushaltung. Es bestand also schon ein Geheimnis zwischen Frau und Freund. Die Musik wurde zur Zwischenträgerin ihrer Gedanken. Er sang abends vor ihrem Fenster »Beglückt, beglückt, wer die Geliebte findet«, »Wen ich liebe, weiß nur ich«, »Süßer Traum, wie bald bist du entschwunden«, »Weine nicht, es ist vergebens« und »Das Grab ist tief und stille«, und Madame Miltenberg netzte, wenn sie sich niederlegte, ihr Lager mit Tränen. Einsame Spaziergänge folgten, ein erster Kuß an einem alten steinernen Kreuze, und das gemeinschaftliche Besitztum schien vollkommen angedeutet, wenn Miltenberg beim Nachhausekommen mit seinem Busenfreunde Gottlieb diesen fragte: »Was mag wohl nun unsere kleine Frau machen?«
Da kam Kassow aus Berlin zurück, brachte der Geliebten ein Geschenk von zehn Louisdor und forderte seine alten Rechte, welche sie ihm aus fortgeschrittener Lasterhaftigkeit oder aus Furcht nicht versagte. Diese letztere wuchs in ihr mit der Zahl und Größe ihrer Verbrechen. Ihr kam es also vor allem darauf an, daß weder Gottfried von ihrer Vertraulichkeit mit Kassow, noch Kassow etwas von der mit Gottfried erfahre. Beides gelang ihrer Verschmitztheit und Verstellungskunst bis zum Tode beider Männer. Nur einmal, als Kassows Eifersucht rege geworden war, kam es bei einem Tanzfest zu einem ärgerlichen Auftritt, indem jener, betrunken, der Miltenberg den Halsschmuck, den er ihr geschenkt hatte, entreißen wollte. Gesina übte seitdem die Vorsicht, nie einen öffentlichen Tanz zu besuchen.
Kassow hatte sich bei den alten Timms einzunisten gewußt, er ward ein Hausfreund, brachte dann und wann auch dorthin eine Flasche Wein und lieh ihnen Geld, mit dem sie die Schulden ihres ausschweifenden Sohnes bezahlten. Wohl hob die alte Timm drohend den Finger: »Hör' mal, Miltenbergin, das geht nicht mit der Freundschaft von Kassow!« Aber es geschah nur in freundlicher Art, gewissermaßen in der Erwartung, daß die Tochter sie beruhige, und ohne den geringsten Argwohn, daß es bereits zum ärgsten gekommen sei. Die Eltern hielten nach wie vor ihre Tochter für ein Musterbild von Tugend und fingen nun auch an, sie zu beklagen und ihr ihr volles Mitleid zu schenken, als jene es jetzt für dienlich zu ihren Plänen hielt, ihren Mann aufs schlimmste zu verleumden.