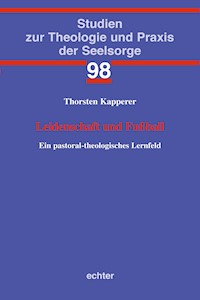
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Fußball ist in Deutschland und in vielen weiteren Ländern weltweit eine omnipräsente Lebensrealität und begeistert zahlreiche Menschen jeden Alters und Geschlechts leidenschaftlich. Insofern ist er ein höchstbedeutsamer theologischer Analysegegenstand. Denn das, was Menschen bewegt, muss Gegenstand der Pastoral sein (vgl. Gaudium et spes 1). Deshalb werden Fußball und Pastoral in diesem Band in ein produktives Spannungsverhältnis gebracht - nicht im Sinne einer unzulässigen Vermischung der beiden Felder (Fußball ist keine Religion!), sondern im Sinne der Qualifikation des Fußballs als einem pastoral-theologischen Lernfeld, das jede Menge kreatives Potential für die Pastoral bereit hält. Der Band bleibt nicht bei den weit verbreiteten Vergleichen von Liturgie und Fußball hängen (so richtig diese phänomenologisch sein mögen), sondern stellt diesen tatsächlich in einer ganz eigenen Perspektive als pastoralen Lernort dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thorsten Kapperer
Leidenschaft und Fußball
Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge
98
Herausgegeben von Erich Garhammer und Hans Hobelsberger in Verbindung mit Martina Blasberg-Kuhnke und Johann Pock
Thorsten Kapperer
Leidenschaft und Fußball
Ein pastoral-theologisches Lernfeld
echter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2017 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: ew-print-medien, Würzburg
ISBN 978-3-429-04314-8 (Print)
978-3-429-04891-4 (PDF)
978-3-429-06311-5 (ePub)
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Danksagung
Die vorliegende Veröffentlichung wurde im Sommersemester 2016 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg als Dissertation angenommen. Ich bedanke mich bei Herrn Prof. Dr. Konrad Baumgartner und bei Herrn Prof. Dr. Erich Garhammer für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge“, die im Echter Verlag erscheint.
Ich danke Herrn Prof. Dr. Erich Garhammer für die fachliche Begleitung. Er hat mich stets ermutigt, die Leidenschaft des Fußballs mit dem Evangelium in ein produktives Spannungsverhältnis zu bringen.
Ich danke Herrn JProf. Dr. Bernhard Spielberg für sein Zweitgutachten und für die zahlreichen wertvollen Hinweise bei der Erstellung dieser Arbeit.
Besonders dankbar bin ich meiner Frau Nadja und unseren beiden Kindern Lara und Fabian, ohne deren wohlwollende Begleitung diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.
Dem Bistum Würzburg danke ich für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung dieses Buches.
Langenleiten im November 2016
Thorsten Kapperer
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Fußball - Phänomen der Massen und Leidenschaft des Einzelnen
2. Die Zielsetzung dieser Arbeit
3. Hermeneutische Paradigmen
3.1 Persönliche Motivation
3.2 Den Eigenwert von Religion bzw. Pastoral und Fußball respektieren
3.3 An bisherigem Engagement anknüpfen
3.4 Frauenfußball
4. Der Aufbau der Arbeit
I. Sehen - Fußball als Realitätsmodell
1. Grundlagen der Leidenschaft des Fußballs
1.1 Die Geschichte des Fußballs – eine Geschichte der Leidenschaft
1.1.1 Erste Vorläufer im alten Rom
1.1.2 Zur Etymologie des Begriffs „Fußball“
1.1.3 Gebrochene Schienbeine und Schädelbrüche
1.1.4 Das Fußballspiel in besten Kreisen
1.1.5 Das italienische Calcio-Spiel
1.1.6 Puritanische Fußball-Kritik
1.1.7 Die Zeit des wilden Straßenfußballs
1.1.8 Fußball in den Public Schools
1.1.9 Die Gründung der englischen Football Association (FA)
1.1.10 Endgültige gesellschaftliche Etablierung des Fußballs in England
1.1.11 Einführung der Schiedsrichter
1.1.12 Alle gesellschaftlichen Kreise werden von der Fußball-Leidenschaft ergriffen
1.1.13 Weitere Entwicklungen
1.1.14 Wie der Fußball nach Deutschland kam
1.1.15 Immer weiter
1.1.16 Erkenntnisse aus der Geschichte des Fußballs für den Fortgang dieser Arbeit
1.2 Die Grundlagen der Leidenschaft sind bereits im Wesen des Fußballspiels angelegt
1.2.1 Das Leidenschaftspotential der immanenten Wesensmerkmale des Fußballsports
1.2.1.1 Die Unkompliziertheit der Regeln ermöglicht einen leichten Zugang zum Fußballspiel
1.2.1.2 Der Ball ist rund
1.2.1.3 Von der Schwierigkeit, den Ball richtig mit dem Fuß zu treffen
1.2.1.4 Der ganze Körper ist gefordert
1.2.1.5 Elf Freunde müsst ihr sein
1.2.1.6 105 auf 70 Meter wollen ideal genutzt werden
1.2.1.7 Tempo, Tempo
1.2.1.8 „Mach’ ihn! Mach’ ihn! Er macht ihn!“
1.2.1.9 Fußball als ästhetischer Genuss
1.2.1.10 „Weil se nich wissen, wer gewinnt“ - über die Spannung beim Fußball
1.2.1.11 Ambivalenz von Unberechenbarkeit und Zweckrationalität
1.2.2 Fußball als Ventil archaisch-emotionaler Kräfte
1.2.2.1 Perspektive aus philosophischer Sicht (Norbert Bolz)
1.2.2.2 Die soziologische Perspektive (Ansgar Kreutzer)
1.2.2.3 Zusammenfassung der philosophischen und der soziologischen Perspektive
1.3 Zusammenfassender Ausblick
2. Signaturen der Leidenschaft des Fußballs
2.1 Die emanzipatorische Kraft des Fußballs…
2.1.1 … am Beispiel dreier literarischer Werke
2.1.1.1 Friedrich Christian Delius: Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde
2.1.1.2 Nick Hornby: Fever Pitch
2.1.1.3 Klaus Theweleit: Tor zur Welt
2.1.2 … anhand beispielhafter Explorationen deutscher Fankultur
2.2 Die anti-emanzipatorische Kraft des Fußballs
2.2.1 Kommerzialisierung
2.2.2 Gewalt
2.2.3 Leistungsdruck
II. Urteilen: Die Leidenschaft des Fußballs – ein höchst bedeutsamer theologischer Analysegegenstand
1. Post-Säkularität
1.1 Paradigmenwechsel: von der Säkularität zur Post-Säkularität
1.2 Drei Kennzeichen der Post-Säkularitäts-These
1.2.1 Religion ist nicht verschwunden
1.2.2 Moderne Gesellschaften sollen sensibel bleiben für religiöse Gehalte
1.2.3 Religion muss ihre Gehalte in die säkulare Sprache übersetzen
1.3 Was bleibt für die Theologie zu tun?
2. Dispersion von Religion
2.1 Die Grenzen der Moderne, die Chancen der Religion und das Verhältnis von säkularem und religiösem Denken
2.2 Post-religiös und post-säkular
2.3 Die Theorie religiöser Dispersion
2.3.1 Erscheinungsformen des Religiösen im Säkularen (Was heißt Dispersion?)
2.3.1.1 Dispersion als Dekonstruktion
2.3.1.2 Dispersion als Deformatierung religiöser Symbole und Motive
2.3.1.3 Dispersion als Inversion transzendenzorientierter Weltdeutungen
2.3.1.4 Dispersion als Diffusion
2.3.1.5 Dispersion als mediale Adaption religiöser Motive und Stoffe
2.3.1.6 Weitere Spuren von Religion in der Populärkultur
2.3.2 Formate disperser Religiosität (Wie äußert sich Dispersion?)
2.3.3 Impuls aus der Dispersionstheorie für die Weiterarbeit
2.4 Der Fußballplatz als ein Ort der Populärtheologie
3. Kennzeichen des Heiligen beim Fußball
3.1 „VfB Stuttgart ist meine Religion“ - worum es hier nicht gehen soll
3.1.1 Fußball ist keine Religion
3.1.2 Die Rede vom Fußballgott
3.1.3 „Jesus liebt dich“ - wenn Fußballer sich öffentlich zu Gott bekennen
3.1.4 Der Fußballplatz als Ort spiritueller Erfahrungen?
3.1.5 Worum es hier gehen soll: Kennzeichen des Heiligen beim Fußball
3.2 Exemplarische Kennzeichen des Heiligen beim Fußball
3.2.1 Zwischen purem Entsetzen und grenzenlosem Jubel
3.2.2 Fußball als Spiel der Überschreitungen
3.2.3 „Wer nicht hüpft, der isch koi Schwabe“
3.2.4 Die Dichotomie der Fußballwelt
3.2.4.1 Heilige Räume und heilige Handlungen
3.2.4.2 Heilige Zeiten
3.2.4.3 Heilige Zeichen
3.2.5 Fazit
III. Handeln: Die Leidenschaft des Fußballs als Lern-Ort pastoral-theologischer Sprachfähigkeit und die sich daraus ergebenden Haltungs- bzw. Handlungs-Impulse
1. Gaudium et spes 44: ein programmatischer Text
1.1 Haltung: „Die Hilfe, welche die Kirche von der heutigen Welt erfährt“
1.2 Handlung: Der Pfarrgemeinderat im Fußballstadion
2. Eine Kirche, die sich im Außen neu entdeckt
2.1 Haltung: Wider den theologischen Narzissmus - Draußen zuhause
2.2 Handlung: Das Konzept des Udo Bassemir (FC Bayern München)
2.2.1 Die Biografie von Udo Bassemir
2.2.2 Fußball-Workshop für Jugendliche in Langenleiten (Dekanat Bad Neustadt)
2.2.3 Das Jugendhaus des FC Bayern München
3. Gaudium et spes 4 unter fußballerischem Blickwinkel
3.1 Haltung: Die Suche nach den Zeichen der Zeit als bleibende Herausforderung und Pflicht
3.2 Handlung: Den Fußball als Zeichen der Zeit erkennen 348
4. „Wir verzichten nicht darauf, eine Kirche für alle zu sein“
4.1 Haltung: Das Fußballfeld als pastoralen Lern-Ort qualifizieren
4.2 Handlung: Drei Beispiele pastoraler Mitarbeiter, die das Fußballfeld für sich als pastoralen Lern-Ort qualifiziert haben
4.2.1 Susanne Haensel (Evangelische Pfarrerin und Vorsitzende des Fan-Projektes von Borussia Dortmund)
4.2.2 „Clubpfarrer“ Thomas Eschenbacher
4.2.3 Die diözesane Fußball-Mannschaft des Bistums Würzburg
5. Der Fußball als Teil der Populärkultur
5.1 Haltung: Das Fußballfeld als pastoralen Lern-Ort der Populärkultur anerkennen
5.2 Handlung: Zwei Beispiele populärkulturellen Lernens vom Fußball
5.2.1 Fußball-Wallfahrt mit Jugendlichen im Ruhrgebiet
5.2.2 Sportler-Gottesdienste
6. Auf gemeinsamen Grundlagen aufbauen
6.1 Haltung: Fußball und Kirche verbindet Wesentliches
6.2 Handlung: Den ersten Schritt tun
7. Die Wichtigkeit der ästhetischen Dimension
7.1 Haltung: „Tatsächlich - Hagebuttentee!“
7.2 Handlung: Die Kapelle in der Arena Auf Schalke
7.2.1 Die Arenakapelle als vierfacher Ort
7.2.1.1 Ein anderer Ort
7.2.1.2 Ein Ort der Kunst
7.2.1.3 Ein heiliger Ort
7.2.1.4 Ein pastoraler Ort
7.2.2 Fazit
8. Plädoyer für eine leidenschaftliche Seelsorge
8.1 Haltung: Eine Theologie der Adjektive
8.2 Handlung: Neues wagen!
9. Abschlussbemerkung
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
1. Fußball – Phänomen der Massen und Leidenschaft des Einzelnen
Laut einer statistischen Erhebung des Weltfußballverbandes FIFA spielten im Jahre 2006 über 265 Millionen Menschen in über 200 Ländern Fußball. Davon sind über 38 Millionen in weltweit mehr als 325.000 Vereinen organisiert.1 Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eigenen Angaben zufolge so viele Mitglieder wie nie zuvor. In den 21 Landesverbänden des DFB sind aktuell 6.889.115 Menschen gemeldet. Die Zahl der erfassten Vereine ist trotz des demografischen Wandels stabil. Aktuell sind 25.324 Klubs gemeldet, die insgesamt 161.727 Mannschaften stellen. Allein bei den Junioren zwischen 15 und 18 sind derzeit 515.364 Fußballer gemeldet und bei den Mädchen bis 16 Jahren 336.464.2 Hinzu kommen noch ungefähr vier Millionen Menschen, die als so genannte Hobbykicker in ihrer Freizeit in Hobby-, Betriebs- oder Thekenmannschaften regelmäßig Fußball spielen.3
Darüber hinaus sind noch diejenigen zu erwähnen, die nicht aktiv Fußball spielen, sondern sich als Zuschauer bzw. Fans mit Fußball beschäftigen, auch wenn es dabei sicherlich Überschneidungen mit den aktiven Fußballern gibt. So besuchten 13.323.031 Personen die Spiele der Ersten Fußball-Bundesliga in der Saison 2014/20154 und 34,65 Millionen Menschen sahen das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 zwischen Argentinien und Deutschland live in der ARD.5 Diese Liste der Superlative ließe sich noch in vielen weiteren Bereichen fortführen. „Hinter all diesen eben genannten Zahlen stecken Menschen jeden Alters, jedes Bildungsgrades, jeder Herkunft, jeder Religion, jeder sozialen Gruppe. Es sind Menschen, die sich Woche für Woche, teils Tag für Tag mit dem Fußball beschäftigen – lokal, regional, national und international. Das sind diejenigen, die am Wochenende zuerst die Bundesligaspiele verfolgen und ihren Verein anfeuern um dann am Sonntag in der B-Klasse oder in höheren Klassen am Samstag selbst gegen den Ball zu treten. Das sind diejenigen, die Woche für Woche die Stadien der Fußball-Bundesliga in ganz Deutschland besuchen, um ihren Verein hundertprozentig zu unterstützen und unter der Woche sämtliche Neuigkeiten der Bundesligavereine und des internationalen Fußballs diskutieren. Das sind auch diejenigen, die Wochenende für Wochenende in den unteren Ligen viel Zeit auf den regionalen Sportplätzen verbringen, indem sie ‘ihre Erste Mannschaft’ zu den Spielen begleiten und darüber hinaus viel Herzblut und Zeit investieren, ihren örtlichen Heimatverein am Leben zu erhalten.“6
Fußball bedeutet für diese Menschen Leidenschaft pur, Emotion pur, Leben pur – mit all dem, was Leben ansonsten auch ausmacht: von der enttäuschenden und bitteren Niederlage bis zum euphorisch gefeierten Sieg ist hier alles an Emotionen vertreten, was das menschliche Zusammenleben zu bieten hat.7 Dazu formulierte der Autor Ror Wolf: „Die Welt ist zwar kein Fußball, aber im Fußball, das ist kein Geheimnis, findet sich eine ganze Menge Welt. Es ist eine zuweilen bizarre Welt, in der unablässig Gefühlsschübe aufeinanderprallen; Emotionen, die jederzeit in ihr Gegenteil umschlagen können: Entzücken in Entsetzen, Begeisterung in Wut, Verzweiflung wieder in Entzücken.“8 Auch der ehemalige schottische Fußballspieler und -trainer Bill Shankly brachte es bereits 1981, sicher mit einer Portion Ironie, auf den Punkt: „Some people think football is a matter of life and death. I don’t like that attitude. I can assure them it is much more serious than that.“9
Das heißt, es gibt „unzählige Menschen, die Fußball nicht nur spielen, sondern ihn leben. Menschen, die mit ihrem Verein – ob aktiv als Spieler oder passiv als Zuschauer – wirklich leiden, wenn ein Spiel verloren wurde. Es geht hier nicht um ein ‚Schade, dass das Spiel verloren ging‘; es geht hier darum, dass der Fußball vielen Menschen tatsächlich an die Substanz geht und eine Niederlage oder ein schlechtes Spiel einige unruhige Nächte nach sich ziehen kann. An Sieg oder Niederlage machen nicht wenige Fußballer einen nicht geringen Teil ihres Lebensglücks fest. Konnte ein Spiel gewonnen werden, ist das Leben derzeit in vielen beruflichen wie privaten Zusammenhängen in Ordnung. Ging ein Spiel verloren, drückt das die gesamte Stimmung in einigen Lebensbereichen. Nicht zu vergessen ist auch die allwöchentliche Anspannung in Bezug auf den Verlauf und den Ausgang des nächsten Spiels, die teilweise sogar zur Angst werden kann.“10 Aber natürlich auch die unbändige Freude, wenn ein Spiel gewonnen wurde.
Aufgrund all dieser Emotionen ist Fußball in Deutschland auch ein umfassendes Gesprächsthema in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen: „Über das beim Spiel Erlebte wird an den Arbeitsplätzen und Schulen, in den Wirtshäusern und Familien berichtet und gestritten. So liefert es unendlich viel Erzählstoff, wirkt bedeutungsvoll in den Alltag der Menschen hinein, bleibt sinnstiftend haften im Bewußtsein der Fans, wird zum Inhalt einer die Generationen übergreifenden Erinnerung, ist dann nicht mehr nur ein Bestandteil individuellen Angedenkens, sondern setzt sich bedeutungsvoll im ‚kollektiven Gedächtnis‘ (z.B. der Vereine) fest (…) oder sogar im ‚kulturellen Gedächtnis‘ ganzer Nationen.“11
Kurzum: Gewiss soll der Fußball nicht verklärend überhöht werden. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass der Fußball in Deutschland eine omnipräsente Realität ist, die zahlreiche Menschen emotional und zeitlich stark beansprucht. Das Fußballfeld ist ein Ort, an dem sich Leben pur abspielt.12
2. Die Zielsetzung dieser Arbeit
Ein zentraler und viel zitierter Absatz des Zweiten Vatikanischen Konzils sind die Eröffnungsverse der Pastoralkonstitution Gaudium et spes: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ (GS 1). Wie oben angedeutet ist das Fußballfeld ein Ort bzw. ein Realitätsmodell13, an dem sehr viel Freude, sehr viel Hoffnung, aber auch Trauer bis hin zu Angst spürbar werden. Daher ist es laut dem Zweiten Vatikanum schlicht geboten, sich als kirchliche Pastoral mit dem Fußball auseinanderzusetzen. Denn was so viele Menschen in Deutschland heute bewegt bzw. emotionalisiert, was die Realität so vieler Menschen nachhaltig beeinflusst, darf die Pastoral nicht außer Acht lassen. Sich kirchlicher- und theologischerseits dem Fußball zu nähern wird dadurch zu einer wesentlichen Aufgabe der Pastoraltheologie.
Die vorliegende Dissertation soll einen Beitrag zur ansatzweisen Erfüllung dieser Aufgabe leisten. Die entscheidende Perspektive, unter der dies geschieht, ist eine lernende. Das heißt: Das Fußballfeld soll als pastoraler Lernort qualifiziert und beschrieben werden. Es geht konkreter darum, das Lernpotential des Fußballs für die Pastoral herauszuarbeiten.
An dieser Stelle bedarf es bereits einer ersten Differenzierung. Denn der Fußball ist heute ein unglaublich vielschichtiges Phänomen geworden. Man kann dabei beispielsweise denken an …….
… den Straßenfußball oder an die FIFA-Weltmeisterschaft
… den Amateur- oder den Profifußball
… die Regeln des Fußballspiels an sich
… die Diskussion um die Torlinientechnik
… den Fußball als riesigen, ökonomischen Wirtschaftszweig und Arbeitgeber
… den ehrenamtlichen Präsidenten eines Vereins in den unteren Amateurligen
… hochbezahlte Spieler und Manager in den internationalen Topligen
… den Fußball als Quotengarant für TV- bzw. Radioanstalten und Auflagengarant für Printmedien
… den Fußball als Stoffgeber für Musicals, Lieder, Bücher, Zeitschriften etc.
… den Fußball als Betätigungsfeld von Wettbetrügern und als Ort der Korruption
… die Fankultur in all ihren Facetten
Wenn hier also von dem Fußball gelernt werden soll, muss die Perspektive definiert werden, mit der der Fußball konkret in den Blick genommen wird. Und diese Perspektive ist die Leidenschaft der Menschen beim Fußball. Sie wurde einleitend andeutungsweise beschrieben und stellt ein Querschnittsthema dar, das sich durch sämtliche Bereiche des Fußballs zieht. Das heißt, dass die Menschen mit ihrer Leidenschaft zum Fußball das Subjekt der Arbeit sind und nicht der Fußball an sich als Phänomen.
Daraus ergibt sich ein spezieller Arbeitsauftrag für diese Arbeit: Es soll die Leidenschaft beim Fußball als pastoraler Lernort qualifiziert und beschrieben werden. Und es geht näherhin darum, das Lernpotential der Leidenschaft des Fußballs für die Pastoral herauszuarbeiten.
Was genau kann die Pastoral von der Leidenschaft des Fußballs lernen?
Der Inhalt des von der Pastoral zu Lernenden ist im Wesentlichen als Impuls zur Verbesserung der Sprachfähigkeit der Pastoraltheologie zu verstehen. Eine zentrale Aufgabe kirchlicher Pastoral ist es, die Botschaft Jesu unter den Bedingungen heutigen Lebens mit den Menschen gemeinsam zu entdecken. Dazu ist eine Sprache nötig, die die Menschen von heute verstehen. Die Pastoral hat dabei bereits viele Wege und Möglichkeiten gefunden sich verständlich auszudrücken. Diese Arbeit versteht sich als Anknüpfung daran und will im Hinblick auf die Leidenschaft des Fußballs einen weiteren Beitrag zur Bereicherung pastoral-theologischer Sprachfähigkeit leisten.
Denn auch der Fußball hat seine eigene Sprache, um sich zu artikulieren. Es ist eine Sprache, die offensichtlich weltweit von unzähligen Menschen verstanden wird. Ein Blick darauf aus pastoraler Lern-Perspektive ist also sinnvoll.
Aus dieser Zielsetzung heraus erklärt sich auch der Titel dieser Dissertation: „Leidenschaft und Fußball. Ein pastoral-theologisches Lernfeld.“
3. Hermeneutische Paradigmen
Beim Prozess des Erreichens dieses Ziels sind einige hermeneutische Paradigmen zu beachten, die für die gesamte Arbeit Geltung besitzen und stets mitgedacht werden müssen.
3.1 Persönliche Motivation
Die Verbindung der beiden Bereiche Fußball und Kirche ist dem Autor dieser Arbeit ein wichtiges Anliegen. Denn in dessen Biografie liegen das hauptberufliche Engagement als Pastoralreferent im Bistum Würzburg und das ehrenamtliche Engagement im Fußball (als Spieler, Trainer, Fan, Vorstandsmitglied) eng beieinander. So erklärt sich etwa das Zurückgreifen auf den VfB Stuttgart oder die SV-DJK Langenleiten an der ein oder anderen Stelle dieser Dissertation. Bei aller Begeisterung soll dabei die nötige Distanz zum Phänomen „Fußball“ nicht zu kurz kommen.
3.2 Den Eigenwert von Religion bzw. Pastoral und Fußball respektieren
Fußball und Religion (im zweiten Hauptteil) bzw. später (im dritten Hauptteil) Fußball und Pastoral werden in dieser Dissertationsschrift in eine Verbindung gebracht. Dabei besteht die Gefahr, diese Bereiche oberflächlich, vorschnell und sachlich unzulässig zu vermischen, wenn man etwa liturgische Gesänge in der Kirche mit Fangesängen im Stadion vergleicht. Deshalb muss differenziert werden: Fußball ist und bleibt Fußball, Religion ist und bleibt Religion, Pastoral ist und bleibt Pastoral. All diese drei Bereiche sind in ihrem Eigenwert zu schätzen und zu respektieren.
Im dritten Hauptteil soll aufgezeigt werden, inwiefern die Pastoral von der Leidenschaft beim Fußball lernen kann. Eine unsachgemäße Vermischung der beiden Felder ist nicht angebracht. Auch nicht zielführend ist die Anbiederung der Pastoral an den Fußball bzw. des Fußballs an die Pastoral. Nur wenn der Eigenwert beider Bereiche anerkannt wird, können Pastoral und Fußball in ihrer je eigenen Souveränität und in Offenheit aufeinanderzugehen, und nur so kann sich die Pastoral lernend vom Fußball bereichern lassen.
Völlig unangebracht und unredlich ist es weiterhin, den Fußballern pastoralreligiöse Einstellungen oder Verhaltensweisen zu unterstellen, gemäß dem Motto: „Ihr seid ja eigentlich alle religiös und wisst es gar nicht!“ Es darf also weder der Fußball im Sinne der Pastoral noch umgekehrt die Pastoral im Sinne des Fußballs zweckentfremdet werden. Gleichermaßen kann und will Fußball keine Religion sein, wie später darzulegen sein wird.
3.3 An bisherigem Engagement anknüpfen
Diese Arbeit stellt nicht die erste Veröffentlichung und Ausführung dar, die zum Thema Fußball und Pastoral gemacht wurde. Ein Blick ins Literaturverzeichnis dieser Dissertation macht dies schnell deutlich.
Sie stellt auch nicht die einzige pastorale Initiative und Bemühung der gesamten Kirche bzw. von einzelnen pastoralen MitarbeiterInnen vor Ort dar, die Themen Pastoral und Fußball in eine sinnvolle Verbindung zu bringen. Im Folgenden seien daher einige beispielhafte Initiativen und Projekte genannt, ohne näher darauf eingehen zu können und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
So fand am 21. September 2005 ein Fußball-Kleinfeldturnier für Kinder auf dem Petersplatz statt, das vom Vatikan und dem italienischen Fußballverband organisiert wurde, um auf ein gemeinsames Sozialprojekt zugunsten von Kindern in sechzehn osteuropäischen Staaten aufmerksam zu machen.14 Der damalige Papst Benedikt äußerte sich zudem sehr positiv über den Fußball: „Fußball ist das Heraustreten aus dem versklavten Ernst des Alltags in den freien Ernst dessen, was nicht sein muss und deshalb so schön ist.“15
In diesem Zusammenhang können auch die Auswahlmannschaft des Vatikan, die Vatikanliga und die vatikanischen Pokalwettbewerbe erwähnt werden. Die Auswahlmannschaft besteht hauptsächlich aus Einwohnern Roms und bestreitet nur selten Länderspiele gegen Auswahlteams anderer Länder, wenn dann meist gegen andere Kleinstaaten wie San Marino oder Monaco. Die Mannschaft ist allerdings weder Mitglied bei der UEFA noch bei der FIFA, da sie unter anderem keinen Fußballplatz vorweisen kann, der den FIFA-Normen entspricht.
1972 gründete Sergio Valcio die vatikanische Fußballiga „Attività Calcistica dei Dipendenti Vaticani“ um etwas für das Gemeinschaftsgefühl der VatikanMitarbeiter und etwas für deren körperliche Fitness zu tun. Die 16 Teams der Liga rekrutieren sich aus den Verwaltungsabteilungen des Vatikans (z.B. Museum, Post, Radio) und die Spiele finden im römischen Außenbezirk Primavalle statt, da im Vatikan kein Platz für einen Sportplatz ist. Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit nur vier Feldspielern und einem Torwart, da die einzelnen Mannschaften sonst nicht genügend Spieler zusammen bekommen würden. Die Liga findet nicht jedes Jahr statt und der Meister ist nicht für internationale Wettbewerbe qualifiziert.
Der als Fußballfan bekannte ehemalige Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone initiierte den Clericus Cup, der 2007 das erste Mal ausgetragen wurde. Dabei spielen internationale katholische Teams von allen Kontinenten gegeneinander. Die offiziellen Fußballregeln wurden dazu leicht abgeändert. So gibt es beispielsweise keine roten Karten, sondern blaue, bei denen der betroffene Spieler fünf Minuten aussetzen muss.16
Auch der mittlerweile heiliggesprochene Papst Johannes Paul II. war für seine Affinität zum Sport bekannt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er um die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen herum die Abteilung „Kirche und Sport“ im Vatikan errichtete. Damit war der Grundstein gelegt, den christlichen Auftrag im Bereich des Sports auch auf weltkirchlicher Ebene anzugehen und wahrzunehmen. Die Abteilung wurde dem Päpstlichen Rat für die Laien zugeordnet und hielt 2005 einen weltweit beachteten Kongress in Rom zum Thema „Der christliche Auftrag auf dem Feld des Sports heute“ ab17, aus dem folgende Schlussempfehlungen hervorgingen:
„Die Kirche will die Welt des Sports mehr beachten und Kontakte besonders über die nationalen Bischofskonferenzen im Hinblick auf ihren pastoralen Auftrag wahrnehmen.
Kirchliche Aussagen zum Sport sollen stärker verbreitet und Studien besonders zu ethischen Fragen des Sports gefördert werden.
Der Sport wird als Beitrag zur Evangelisierung anerkannt; wichtig ist hierfür auch das Zeugnis für Christus von Spitzensportlern.
Eine Kultur des Sports, die im Einklang mit der Würde des Menschen steht, soll vorrangiges Ziel in der kirchlichen Jugend- und Erziehungsarbeit sein.
Die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Sportorganisationen als Plattform des Dialogs wird begrüßt.“18
Im Laufe der Jahre folgten weitere Kongresse und ähnliche Veranstaltungen. Grundsätzlich bestimmen folgende Hauptaufgaben das Handeln dieser Abteilung:
„Gesprächspartner für die Sportorganisationen der Welt sein und mithelfen, den Sport zu einem Mittel des Friedens und der Brüderlichkeit zwischen den Völkern zu machen
nationale Kirchen anhalten, für mehr seelsorgerischen Beistand in der Welt des Sports zu sorgen
Studien über die ethische Dimension des Sports anregen und Initiativen unterstützen, die das Bekenntnis zum Christentum in der Welt des Sports fördern“19
Zudem ist hier der Heilige Aloisius „Luigi“ Scrosoppi zu nennen. Der von 1804 bis 1884 lebende italienische Heilige, dessen Gedenktag der 3. April ist, wurde am 22. August 2010 von Bischof Alois Schwarz im Rahmen eines Gottesdienstes in der Pfarre Pörtschach am Wörther See in Abstimmung mit den römischen Stellen zum Schutzheiligen für alle FußballerInnen ernannt. Einen solchen hatte es zuvor nicht gegeben. Die Idee dazu stammte im Rahmen der Wörthersee-Zukunftsinitiative vom Fußballfan Manfred Pesek. Aloisius Scrosoppi hatte sich in besonderer Weise um die Jugend verdient gemacht und stand für Werte, die auch im Sport eine wichtige Rolle spielen, wie Fairness, Ausdauer und Zielstrebigkeit ein.20
Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass einige Fußballclubs in Europa von Geistlichen gegründet wurden. Zum Beispiel Celtic Glasgow in Schottland. Hier wollten die Gründungsväter mit den Eintrittsgeldern die Armenspeisung der Kirchengemeinde finanzieren. Oder Borussia Dortmund, dessen Gründung ebenso auf eine Kirchengemeinde zurückgeht, deren Kaplan die männlichen Jugendlichen mittels des Fußballs an die Kirche binden wollte.21
Das Miteinander von Fußball und Kirche war allerdings nicht immer so. Markwart Herzog wies etwa daraufhin, dass die Geschichte des Fußballspiels in den meisten Ländern von Generationenkonflikten durchzogen war. So gab es bereits in der Zeit des deutschen Kaiserreichs viele Geschichten von jungen Kickern, deren Fußballbegeisterung mit der „Sonntagspflicht“ kollidierte. Schon in den ersten Jahrbüchern des Deutschen Fußball-Bundes wurden solche Kulturkonflikte thematisiert.22 Unvergessen seien laut Herzog weiterhin Geschichten von Fußballern, die heute zu den sogenannten „Alten Herren“ gehören und die fünfzehn Minuten vor dem Abpfiff das Feld verlassen mussten, um rechtzeitig in der Kirche den Ministrantendienst versehen zu können. Oder die umgekehrt das Fußballtrikot unter dem bürgerlichen Habit trugen um unmittelbar nach dem Ende des Gottesdienstes, oder heimlich schon einige Minuten früher, die Kirche verließen, um beim Jugendspiel ihrer Mannschaft mitmachen zu können. Diese Geschichten zogen sich durch mehrere Jahrzehnte. In den 1950er Jahren kam es manchmal fast zu Krisen, die sich deswegen in bundesdeutschen Familien abspielten.23
Anekdotenhaft und deshalb nicht mehr genau zu terminieren, berichtet Hermann Queckenstedt in seinem Referat „Sonntagskick statt Sonntagspflicht – Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Fußballvereinen und christlichen Kirchen“, das er im März 2014 auf der 7. Sporthistorischen Konferenz im Kloster Irsee hielt, von einem gewissen Ulrich „Uli“ Hoeneß, der im Alter von acht Jahren von einem Ministrantenzeltlager ausbüchste, woran er seitens seiner Eltern teilnehmen musste, 50 Kilometer mit seinem Fahrrad zu einem Fußallspiel seiner Mannschaft fuhr, beim Stand von 0:4 eingewechselt wurde und mit fünf Toren den 5:4-Endstand herstellte. Oder Josef „Sepp“ Maier, dessen Eltern seinen Messbesuch oft damit kontrollierten, indem sie ihn danach fragten, welchen Kragen der Pfarrer im Gottesdienst getragen hatte. Maier wusste sich zu helfen. Er ging kurz in die Kirche, merkte sich den Kragen des Pfarrers um dann rasch zum Fußballspielen zu gehen.
Doch seit den 1980er Jahren24 lernte die Kirche zu akzeptieren, dass „sie als gelebte Religion nicht in Konkurrenz- oder Führungskämpfen mit anderen Kulturphänomenen steht, sondern daß sie gerade im Dialog mit solchen Kulturphänomenen wie Fußball an gleichnishafter Sprache gewinnen kann“25. Auch Andreas Merkt konstatiert, dass die antike Arena und das Christentum noch Gegensätze bildeten und der wilde Urfußball ebenso mit der christlichen Lehre unvereinbar gewesen sei. Im heutigen, modernen Fußball sei aber eine grundsätzlich mit dem Christentum versöhnte Form von Arenakultur und Ballspiel entstanden, sowie eine Spielkultur, die in besonderer Weise dem christlichen Menschenbild entspricht.26
Deshalb könnten hier ergänzend zu den genannten Initiativen zahlreiche weitere Projekte und Ausführungen erwähnt werden, die pastorale MitarbeiterInnen vor Ort oder Wissenschaftler initiiert haben. Diese Dissertationsschrift versteht sich deshalb dezidiert als Anknüpfung an das bisherige Engagement in diesem Bereich bzw. an das bisherige Zugehen der Kirche auf den Fußball. Einige weitere Bemühungen werden daher im Laufe dieser Arbeit aufgegriffen, wie zum Beispiel die Herausarbeitung des Heiligen beim Fußball (Matthias Sellmann), die Skizzierung der Gemeinsamkeiten von Sport und Kirche (Sport und christliches Ethos: Schreiben der beiden christlichen Kirche aus dem Jahr 1990) oder die Vorstellung der Stadionkapelle in der Arena Auf Schalke.
Trotz der bereits bestehenden, positiven und vielfältigen Initiativen in diesem Bereich wird hier von der Überzeugung ausgegangen, dass eine stärkere Verbindung von Fußball und Pastoral, wie sie in dieser Arbeit gefordert wird, das bisherige Engagement noch ergänzen und bereichern kann.
3.4 Frauenfußball
Die Begeisterung, die dieser Sport auslöst, ist prinzipiell und wesentlich nicht an ein Geschlecht gebunden. Der Lauf der Geschichte des Sports und die heutige Erscheinungsform zeigen jedoch, dass der Fußball hauptsächlich mit Männern in Verbindung gebracht wird, was diese Arbeit ebenfalls berücksichtigt. Trotzdem wird die Verbindung von Frauen und Fußball immer wieder thematisiert, zum Beispiel bei der Darstellung der emanzipatorischen Kraft des Fußballs. Auch die Haltungs-Impulse des dritten Hauptteils und einige Handlungs-Impulse wenden sich gleichermaßen an Frauen wie an Männer. Denn gerade die Erfolge der Frauen-Nationalmannschaft sowie einiger Teams der Damen-Bundesliga, aber auch die Leidenschaft so vieler Mädchen und junger Frauen, die in den Jugend- und Amateurmannschaften spielen, haben den Frauen-Fußball in Deutschland im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem gesellschaftlich akzeptierten und erfolgreichen Sport gemacht.27
4. Der Aufbau der Arbeit
Unter Bezugnahme auf die bisherigen Ausführungen dieser Einleitung soll mit der Gliederung das Ziel dieser Arbeit, wie es unter 2. beschrieben wurde, erreicht werden. Die ganze Arbeit folgt dem bewährten inhaltlichen Gliederungsschema „Sehen – Urteilen – Handeln“.
Der erste Hauptteil des „Sehens“ nimmt die Fußballwelt unter der Perspektive der Leidenschaft exemplarisch in den Blick. Dabei werden zunächst die Grundlagen der Leidenschaft dargestellt (1.). Zuerst wird die Geschichte des Fußballs als Geschichte der Leidenschaft beschrieben (1.1) und dann wird erläutert, warum die Grundlagen dieser Leidenschaft bereits im Wesen des Spiels selbst angelegt sind (1.2).
Nach der Vergewisserung über die Grundlagen werden Signaturen dieser Leidenschaft exemplarisch erörtert (2.), indem die emanzipatorische (2.1) und die anti-emanzipatorische Kraft des Fußballs (2.2) skizziert werden. Die emanzipatorische, positive Kraft des Fußballs wird einerseits anhand einer literarischen Erzählung (2.1.1.1 Christian Friedrich Delius: Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde) sowie anhand zweier autobiografischer Werke (2.1.1.2 Nick Hornby: Fever Pitch / 2.1.1.3 Klaus Theweleit: Tor zur Welt) verdeutlicht und andererseits anhand beispielhafter Berichte, wie Fans ihre Fußballleidenschaft auf unterschiedlichste Weise leben (2.1.2). Die antiemanzipatorische, negative Kraft des Fußballs soll nicht verschwiegen werden (2.2).
Der zweite Hauptteil des „Urteilens“ verortet die im ersten Hauptteil exemplarisch beschriebene Leidenschaft des Fußballs im Verhältnis von Gesellschaft und Religion bzw. Theologie. Ausgangspunkt dabei ist die These von Jürgen Habermas, Religion müsse ihre Inhalte so übersetzen, dass sie von der heutigen post-säkularen Gesellschaft verstanden werden. Die Suche nach einer pastoral-theologischen Sprachfähigkeit ist damit eröffnet. Das handlungsleitende Interesse bei der Suche nach Antwortmöglichkeiten auf diese Frage wird durch folgende Kernthese bestimmt: Der Theologie und der Kirche ist zu raten, sich umzusehen, wo und wie Spuren von Religiösität in der säkularen Welt außerhalb verfasster Kirchlichkeit bzw. außerhalb unserer pastoralen Bemühungen zu finden sind und hier in säkularer Sprache zum Ausdruck gebracht werden können, sodass es post-säkular geprägte Menschen, auch solche, die nicht religiös-sozialisiert sind, gut verstehen und daraus bereichernde Sinnkonstrukte für ihr Leben ableiten können (1.).
Als Hilfe bei dieser Suche wird zunächst die Theorie religiöser Dispersion herangezogen, die besagt, dass Religion heute in vielfachen Erscheinungsformen auftritt, oft auch außerhalb verfasster Kirchlichkeit. Nach der Diskussion einiger dieser Erscheinungsformen des Religiösen wird auf den Fußballplatz verwiesen, bei dem Spuren des Religiösen zu finden sind (2.).
Da der Fußball den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, werden die Spuren des Religiösen bei ihm unter 3. ausführlich erarbeitet, indem vier Kennzeichen des Heiligen beim Fußball exemplarisch nachgewiesen werden. Die Leidenschaft spielt bei jedem dieser Kennzeichen eine zentrale Rolle. Anhand der Leidenschaft des Fußballs kann man sehr gut nachvollziehen, wie religiöse Spuren ausgedrückt werden, dass sie von Millionen von Menschen heute verstanden werden. Deshalb eignet sich der Fußball hervorragend dazu, die unter 1. geforderte pastoral-theologische Sprachfähigkeit einzuüben.
Der dritte Hauptteil des „Handelns“ zieht die pastoral-theologischen Konsequenzen aus den ersten beiden Hauptteilen. Dies geschieht anhand von acht Beispielen, die deutlich machen sollen, wie die pastoraltheologische Sprachfähigkeit mittels der Leidenschaft des Fußballs konkret gelernt werden kann. Diese acht Beispiele verstehen sich als Antwortversuche auf die unter 1. skizzierte Habermas’sche Forderung. Sie bestehen jeweils aus einem Impuls, der eine Haltung der Lernbereitschaft seitens der Pastoraltheologie in Bezug auf die beim Fußball zu erlernende pastoraltheologische Sprachfähigkeit beschreibt und einem Handlungs-Impuls, der konkrete pastoral-theologische Sprachversuche vorstellt, die aus dem jeweiligen Haltungs-Impuls erfolgen.
Ein Schlusswort mit perspektivischen Überlegungen unter dem Motto von Josef Herberger „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ rundet die Arbeit ab.
1 Vgl. Seite „Fußball“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. Juli 2016, 13:13 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fu%C3%9Fball&oldid=156164876 (Abgerufen:17. August 2016, 07:50 UTC).
2 Vgl. Deutscher Fußball Bund, Mitgliederstatistik, in: http://www.dfb.de/verbandsstruktur/mitglieder/ [24.10.2015].
3 Vgl. Seite „Fußball“ in Wikipedia.
4 Vgl. Seite „Fußball-Bundesliga 2014/15“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. August 2016, 16:33 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fu%C3%9FballBundesliga_2014/15&oldid=154961043 (Abgerufen: 17. August 2016, 08:01 UTC).
5 Vgl. Seite „Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. Juni 2016, 09:01 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Finale_der_Fu%C3%9Fball-Weltmeisterschaft_2014&oldid=155434012 (Abgerufen: 17. August 2016, 08:07 UTC).
6 Kapperer, Thorsten, Das Fußballfeld. Ein pastoraler Ort. Zulassungsarbeit im Rahmen der Zweiten Dienstprüfung im Bistum Würzburg (Eingereicht am 6. Januar 2011 am Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Universität Würzburg. Betreuer der Arbeit war Dr. Bernhard Spielberg), Würzburg 2011, 5.
7 Vgl. ebd., 4.
8 Wolf, Ror, Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Frankfurt am Main 2008, 295.
9 Seite „Bill Shankly“, in: Wikiquote, Die freie Zitatsammlung. Bearbeitungsstand: 9. April 2014, 09:44 UTC. URL: https://de.wikiquote.org/w/index.php?title=Bill_Shankly&oldid=476408 (Abgerufen: 17. August 2016, 08:11 UTC - zitiert nach: Sunday Times vom 4. Oktober 1981).
10 Kapperer, Das Fußballfeld 5-6.
11 Herzog, Markwart, Von der ‚Fußlümmelei‘ zur ‚Kunst am Ball‘. Über die kulturgeschichtliche Karriere des Fußballsports, in: Herzog, Markwart (Hrsg.), Fußball als Kulturphänomen. Kunst - Kult - Kommerz, Stuttgart 2002, 11-43, hier 17-18.
12 All dies könnte man auch für viele weitere Länder dieser Erde behaupten. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf Deutschland.
13 Vgl. den Untertitel von Klaus Theweleits Buch „Tor zur Welt : Fußball als Realitätsmodell“. Vgl. Theweleit, Klaus, Tor zur Welt. Fußball als Realitätsmodell, Köln 2004.
14 Vgl. Merkt, Andreas, Die Arena. Warum Fußball eigentlich ein recht zivilisiertes Spiel ist, in: Merkt, Andreas (Hrsg.), Fußballgott. Elf Einwürfe, Köln 2006, 17-50, hier 50.
15 Ebd., 50.
16 Vgl. Seite „Fußball im Vatikan“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2016, 16:49UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fu%C3%9Fball_in_der_Vatikanstadt&oldid=156563991 (Abgerufen: 17. August 2016, 08:52 UTC).
17 Vgl. Schaub, Fritz / Grün, Karl, Gott erfahren - Christus bekennen. Kirche begegnet Sport, Würzburg 2009, 10.
18 Sport-Uni Mainz, Erstes Vatikanisches Sportseminar mit deutscher Beteiligung, in: http://www.sport.unimainz.de/mueller/Texte/VatikanSportseminarPresseXI05.pdf [22.12.2015].
19 Schaub, Fritz / Grün, Karl, Gott erfahren 10.
20 Vgl. Seite „Aloisius Scrosoppi“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Februar 2016, 20:56 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aloisius_Scrosoppi&oldid=151979461 (Abgerufen: 17. August 2016, 08:59 UTC).
21 Vgl. Chatzoudis, Georgios, Sonntagspflicht: Kirchgang, Altardienst oder Fußball?. Interview mit Dr. Markwart Herzog über Fußball und Religion, in: http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=4844 [20.03.2014], 3.
22 Vgl. ebd., 2.
23 Vgl. ebd., 3.
24 Vgl. Scheuchenpflug, Peter, Die Fangemeinde. Was die Kirche vom Fußball lernen kann, in: Merkt, Andreas (Hrsg.), Fußballgott. Elf Einwürfe, Köln 2006, 51-65, hier 59-60.
25 Ulrichs, Hans-Georg, Wie der Fußball zur Kirche und die Kirche zum Fußball kam, in: Möller, Christian / Ulrichs, Hans Georg (Hrsg.), Fußball und Kirche - wunderliche Wechselwirkungen [Band 45] (Transparent), Göttingen 1997, 14-18, hier 18.
26 Vgl. Merkt, Die Arena 50 bzw. der gesamte Artikel „Die Arena. Warum Fußball eigentlich ein recht zivilisiertes Spiel ist“, Seite 17-50. Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Geschichte des Fußballs in dieser Dissertation.
27 Eine kurzer geschichtlicher Abriss über den Frauenfußball findet sich bei: Bausenwein, Christoph, Geheimnis Fußball. Auf den Spuren eines Phänomens, Göttingen 2006, 323-328. Gleichermaßen ist in den männlichen Formulierungen dieser Arbeit zwecks besserer Lesbarkeit die weibliche Form stets mitgedacht.
I. SEHEN: FUSSBALL ALS REALITÄTSMODELL
Der erste Hauptteil bildet zum einen die Grundlage, auf der die weiteren Überlegungen dieser Arbeit aufbauen. Zum anderen hat er den Anspruch, den Menschen, die mit dem Fußball leidenschaftlich verbunden sind und für die der Fußball ein Realitätsmodell ist, wertschätzend zu begegnen.
Ziel ist dabei nicht, diese Leidenschaft beim Fußball in all ihren Facetten vollumfänglich zu erfassen. Dies würde den Rahmen der folgenden Ausführungen sprengen. Vielmehr soll die Leidenschaft exemplarisch, aber dennoch anhand wesentlicher Merkmale beschrieben werden – ohne sie dabei unzulänglich zu überhöhen.
1. Grundlagen der Leidenschaft des Fußballs
1.1 Die Geschichte des Fußballs – eine Geschichte der Leidenschaft
Zu Beginn soll die Geschichte dieses Sports in groben Zügen beschrieben werden. Es ist letztlich eine Geschichte der Leidenschaft, denn ohne diese hätte es der Fußball aus historischer Sicht nicht zu der Popularität gebracht, die er heute besitzt.
1.1.1 Erste Vorläufer im alten Rom
Schon im alten Rom gab es, vorsichtig formuliert, Vorläufer dessen, was wir heute mit Fußball bezeichnen. Diese Vorsicht rührt daher, da es keine Belege dafür gibt, dass sich der Fußball heutiger Disposition aus der Zeit der alten Römer bis heute entwickelt hat28, auch wenn William Andrews 1891 kurz und bündig meinte: „Fußball wurde von den Römern nach England eingeführt und ist unser ältester Sport.“29
Vielmehr ist Andreas Merkt beizupflichten, der lakonisch bemerkt: „So vieles haben wir den alten Griechen und Römern zu verdanken, die Philosophie, die Schrift, das Rechtssystem, aber eben eines nicht: den Fußball.“30
Ballspiele jeglicher Art gab es in der Antike allerdings. So erfreuten sich die Griechen etwa besonders am sogenannten himmlischen Ballspiel Urania, wo es auf hohes Werfen und sicheres Fangen ankam und der Ball im besten Fall nicht den Boden berühren sollte. Urania wurde meistens, begleitet durch Tanz und Gesang, von jungen Frauen gespielt.31
Zudem gab es auch Mannschaftsspiele, die teilweise schon erstaunlich klar geregelt waren, wie zum Beispiel das unter jungen Männern weit verbreitete Episkyros, das wie folgt beschrieben werden kann: „Gespielt wurde mit zwei gleichstarken Mannschaften auf einem Feld, das man mit Gips (‚Skyros‘) markierte: Man zog eine Mittellinie und jeweils weit davon entfernt je eine Grundlinie. Darüber, wie das Spiel genau ablief, kann man nur Vermutungen anstellen. Logisch wäre etwa folgende Variante: Ein Spieler der einen Partei warf einen kleinen Ball weit in das gegnerische Feld; dort mussten die Spieler nun versuchen, den Ball zu fangen; gelang dies, wurde der Fänger zum Zurückwerfer. Ziel des Spiels war möglicherweise eine laufende Reduktion der Spieler, das heißt, dass immer dann, wenn ein Ball nicht gefangen werden konnte oder außerhalb landete, ein Spieler das Feld verlassen und hinter der eigenen Grundlinie das Ende des Spiels abwarten musste. Sieger war also, wer das Feld des Gegners geleert hatte.“32
Ansonsten sind die üblichen Regeln römischer Ballspiele bis heute kaum geklärt. Immerhin weiß man mit Sicherheit, dass es drei unterschiedliche Spieltypen gab:
Wurf- und Fangspiele (datatim ludere)
Schlagspiele (expulsim ludere)
Kampfspiele (raptim ludere)33
Bis hierhin bleibt zu konstatieren, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach keine Vorläufer des Fußballs gab, „sondern nur brutale, wenig geregelte Ballwettkämpfe (…). Rom (…) war also nicht der Ursprungsort des Fußballspiels.“34
Schaut man sich außerhalb Roms nach uralten Belegen für mögliche Fußstoß-Spiele um, kann man durchaus fündig werden.35 So waren zum Beispiel in Asien Kreisfußballspiele verbreitet, bei denen sich die Spieler Bälle mit dem Fuß zuspielten: „Ein Blick auf diese Spiele lehrt, dass Menschen vermutlich schon seit Tausenden von Jahren komplexe Bewegungsvorgänge mit Fuß und Ball beherrschen.“36 Hier finden sich also erste Ansätze einer Technik im Umgang mit dem Fußball, so dass sich nicht behaupten lässt, dass dies ausschließlich für die europäische Moderne typisch ist.37
In diesem Sinne ließen sich hier noch weitere Phänomene benennen, die Elemente beinhalten, von denen aus Brücken zu unserem heutigen Fußball geschlagen werden könnten. Doch unseren Fußball auf außereuropäische Wurzeln zurückzuführen, wäre laut Christoph Bausenwein „verwegen“38. Weiterführend ist deshalb der Blick nach England, dem Mutterland des Fußballs.
1.1.2 Zur Etymologie des Begriffs „Fußball“
Zunächst einmal soll sich dem, was wir Deutschen Fußball und die Engländer football nennen, etymologisch genähert werden. Woher kommt diese Bezeichnung?
Eine von William Fitzstephens stammende Notiz aus seiner Beschreibung Londons aus dem Jahre 1174 wird als erster Hinweis auf ein Fußballspiel in England gedeutet. Fitzstephens beschreibt hier, dass die ganze Jugend der Stadt nach dem Mittagessen hinaus auf die Wiese zieht, um das berühmte Ballspiel auszuüben. Leider wird aber nicht erwähnt, um welches Ballspiel es sich genau handelt.39 Erst über 100 Jahre später findet sich eine zweite Erwähnung in einer Gerichtsakte aus dem Jahr 1280, in der von einem tödlichen Unfall berichtet wird: „Henry (…) rannte, während er in Ulkham am Sonntag Trinitatis mit David Le Ken und vielen anderen mit einem Ball spielte, gegen David und wurde durch dessen Messer unabsichtlich so verletzt, dass er am folgenden Freitag verstarb.“40 Aber auch in diesem Text wird das Ballspiel nicht weiter spezifiziert.
Der Name Fußball ist historisch erstmals im Jahre 1314 erwähnt. Da der König auf einem Feldzug war, bat er seine Vertreter für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Als in London die Stimmung hochkochte, griff Bürgermeister Nicholas Farndorne ein und stellte fest, dass die Unruhen mit „gewissen Wutausbrüchen, die von großen Fußbällen auf öffentlichen Plätzen herrühren“41 zu erklären seien. Deshalb wurde das Spiel in der Stadt verboten. Wer sich nicht daran hielt, musste mit der Strafe der Einkerkerung rechnen. Diese Worte gelten bis heute als erster Hinweis auf ein Fußballspiel in England42, obwohl hier immer noch nichts auf ein geregeltes Spiel hindeutet, bei dem ein Ball mit dem Fuß geschossen wird. Sichere Quellen, in denen von geregelten Spielen mit begrenzter Teilnehmerzahl die Rede ist, stehen erst für das 16. Jahrhundert fest.43
Im Laufe der Jahrhunderte lassen sich noch weitere Ball-Spielformen ausmachen44, von denen hier lediglich der Königliche Fastnachts-Fußball, der sogenannte Royal Shrovetide Football aus Ashbourne erwähnt werden soll. Dieses Volksfußballspiel findet etwa seit dem 12. Jahrhundert am Faschingsdienstag und am Aschermittwoch statt.45 Von dem ursprünglichen Spiel in Ashbourne und den Verhältnissen rund um dieses Spektakel ist uns Folgendes überliefert: „Wer am Fastnachtsdienstag dort hinkommt, wird Szenen erleben, die an einen Bürgerkrieg erinnern. Alle Geschäfte sind geschlossen, ihre Schaufenster sind mit dicken Holzbalken verriegelt, die Innenstadt ist für den Autoverkehr gesperrt. Nur die Pubs haben geöffnet und sind gut besucht (…). Die Regeln sind einfach. Ashbourne ist durch den Henmore River in zwei Hälften geteilt, und im Spiel treten diejenigen Einwohner, die nördlich des Flusses geboren sind (…) gegen die Südstädter (…) an. Die Anzahl der Spieler pro Partei ist nicht festgelegt, auch Frauen dürfen teilnehmen. Spielfeld ist der Raum zwischen den beiden mehr als fünf Kilometer auseinander liegenden Zielpunkten, die für je eine Gruppe vorgesehen sind. Bei diesen ‘Toren’ handelt es sich um zwei mit Markierungsscheiben versehene Steinsäulen am Fluss (…). Ein Tor gilt dann als erzielt, wenn der Ball dreimal hintereinander die Markierungsscheibe berührt hat. Weitere Regeln (…) gibt es nicht. Bis auf Totschlag ist alles erlaubt.“46
1.1.3 Gebrochene Schienbeine und Schädelbrüche
Interessanterweise ist aus historischer Sicht festzustellen, dass der Fußball ursprünglich ein Wettkampf war, bei dem das Drängeln mehr im Vordergrund stand als die filigrane Kickerei: „Bei fast allen traditionellen Volksspielen spielte und spielt das Kicken eines Balles weder symbolisch noch praktisch eine besondere Rolle.“47 Dazu kommt: Weder namentlich noch inhaltlich gibt es größere Übereinstimmungen zwischen den traditionellen Spielen und dem heutigen Fußball. Einzig die Gewalttätigkeit ist als gemeinsames Merkmal all der Spiele zu nennen, die von den verschiedensten Gruppen gespielt wurden. Als Beispiel seien hier die Spiele der in den East Midlands von England gelegenen Stadt Derby genannt, an der seinerzeit Tausende teilgenommen haben. Der Augenzeuge Stephen Glover wusste dazu im Jahre 1829 zu berichten, dass die Stadt nach dem Match den Eindruck machte, als wäre ein plötzlicher Sturm über sie gekommen.48
Auch die Ärzte bekamen die Nebenwirkungen der Spiele zu spüren: „Gebrochene Schienbeine, Schädelbrüche, zerrissene Jacken und verlorene Hüte gehören noch zu den geringeren Unfällen dieses fürchterlichen Wettkampfs, und häufig passiert es, dass Personen in Folge des enormen Drucks hinfallen und kraftlos und blutend zwischen den Füßen des sie umringenden Mobs liegen bleiben.“49
So wie in Derby ging es auch noch an zahlreichen anderen Orten zu und dies nicht nur zu besonders festlichen Anlässen, sondern immer dann, wenn gegnerische Gruppen „etwas zu klären“ hatten.50 Die Folge war, dass das rohe Fußballspiel nicht selten „in Mord und Totschlag ausartete“51. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Fußballspiel bald verboten wurde52, was aber an der Beliebtheit des Spiels nichts änderte. Hinzu kam, dass man sich vielerorts ohnehin über das Fußballverbot hinwegsetzte. Kurzum: Der Fußball lebte und hatte vielmehr schon längst Einzug in die Dichtung gehalten.53 In einer Rittergeschichte des berühmten Geoffrey Chaucer aus dem 13. Jahrhundert beispielsweise symbolisiert der Ball den im Kampf gestrauchelten Kämpfer: „Ein Ritter, der während eines Turniers zu Boden ging, so heißt es da, sei den anderen wie ein Ball vor die Füße gerollt.“54
Es existierten jedoch nicht nur Massenraufereien, sondern auch tatsächliche Fußballspiele, in denen sich kleinere Mannschaften gegenüberstanden. Hier ging es zwar ähnlich brutal zu, aber immerhin bestand eine eindeutige Spielidee.55 Man darf demnach aus den Überlieferungen schließen, dass Fußball viel bedeuten konnte: „Es gab viele Spielvarianten, angefangen vom Spiel zweier Jungen in einer Dorfstraße über tumultartige Raufereien in den Gassen Londons bis hin zum großen Match mit zahlreichen Teilnehmern auf freiem Gelände. Örtliche Gewohnheiten (…) bestimmten das Spiel (…). Angriffslust und Gewalttätigkeit bestimmen den Ablauf (…). Kicken war die Ausnahme, und wenn es zum Treten kam, dann galt der Tritt meist dem Gegner. Das war die Regel, aber ab und an ging es wohl auch mal weniger brutal zu.“56
An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass sich die Suche nach dem Ursprung des Fußballs auf zahlreiche Wurzeln bezieht und nicht nur auf eine beschränkt. Deshalb werden in diesem geschichtlichen Abriss auch mehrere Quellen aus verschiedenen Epochen herangezogen.57
1.1.4 Das Fußballspiel in besten Kreisen
Im 16. Jahrhundert zeigt sich eine Wende in der öffentlichen Wahrnehmung des Fußballspiels. War es bis dahin nur als raues Volksvergnügen bekannt und mit vielerlei Verboten belegt, scheint es nun gesellschaftsfähig geworden zu sein und taucht an sämtlichen Höfen Europas auf: „Am 22. April 1497 lässt der schottische König Jakob IV. Fußbälle kaufen; am 7. Januar 1521 sorgt Papst Leo X. in Rom für eine Fußball-Aufführung; im Jahr 1526 bestellt der englische König Heinrich VIII. bei seinem Schuhmacher Cornelius Johnson ein paar Fußballschuhe aus Leder.“58 Erstaunlich ist dies auch deshalb, weil Fußball zu Zeiten des eben erwähnten Königs Heinrich in England gerade nicht als Beschäftigung für vornehme Personen galt. So ist zum Beispiel in Thomas Elyots „Buch über den Herrscher“ (König Heinrich gewidmet) aus dem Jahre 1531 zu lesen, dass er das Fußballspiel für unziemlich hält und es auf das schärfste verurteilt: „Es sei von allen Edelleuten gänzlich zu verachten, denn in ihm stecke nichts als tierische Wut und äußerste Gewalt. Es sei mit vielen Verletzungen verbunden, und diese wiederum erzeugten Bitterkeit und Bosheit. Letzte Konsequenz daher: Man soll über den Fußball bis in alle Ewigkeit schweigen.“59
Von großer Durchschlagskraft scheinen diese Argumente nicht gewesen zu sein, denn Elyot selbst äußert sich nicht nur drei Jahre später wieder über den Fußball, sondern ordnet ihn sogar als nützlich ein. Eventuell spielte dabei sein Herrscher, König Heinrich, eine entscheidende Rolle, der selbst von der Leidenschaft zu dem Spiel erfasst war60, weshalb der Fußball zu seinen Zeiten in vornehmen Kreisen durchaus präsent war.61
Woher die Fußballbegeisterung in den besten Kreisen Europas kam, darüber können nur Vermutungen angestellt werden. Eine dieser Vermutungen ist, dass die Welle der Begeisterung aus Italien, genauer gesagt aus Florenz und dem dort angesiedelten Calcio nach England schwappte. Deshalb soll dieser Calcio einmal etwas näher betrachtet werden.62
1.1.5 Das italienische Calcio-Spiel
Das Calcio-Spiel war im 16. Jahrhundert nicht nur in Florenz, sondern auch in den anderen Gegenden Italiens bekannt, wobei es unterschiedliche Varianten gab, die teilweise schriftlich festgehalten wurden.63 Keine dieser Calcio-Varianten war wohl ein reines Fußballspiel, denn der Ball durfte sowohl getragen als auch mit den Händen geworfen werden. Obwohl es daher eher dem Rugby ähnelte, war es durchaus mit dem modernen Fußball vergleichbar, denn es gab zum Beispiel auch Spielvarianten, bei denen auf richtige Tore gespielt wurde.64
Wie wurde nun Calcio gespielt? Die gängige Definition dazu liefert de Bardi: „Der Calcio ist ein öffentliches Spiel zweier zu Fuß agierender und unbewaffneter Mannschaften von Jugendlichen, die auf angenehme Weise um der Ehre willen wetteifern, einen aufgepumpten Ball über den gegenüberliegenden Endpunkt hinaus zu bringen.“65 Die Teams bestanden aus 20 bis 40 Spielern, die bei Beginn des Spiels auf vorgeschriebenen Positionen aufgestellt wurden, beispielsweise als Stürmer, Zerstörer oder Läufer. Diese Aufstellung zeigt, dass man es hier bereits mit einem dem modernen Mannschaftsspiel vergleichbaren Sport zu tun hat, wobei die Parallelen nicht überbewertet werden dürfen. Denn obgleich wir von dribbelähnlichen Bewegungen wissen, gab es auch seltsam anmutende Techniken, wie etwa die, bei der sich der Spieler mit dem ganzen Körper auf den Ball legen sollte, um ihn dann kriechend voranzubringen.66
Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang der höfische Calcio67, der dem Adel vorbehalten war, vom Volks-Calcio68, der vor allem bei traditionellen Festen zur Aufführung kam. Inwieweit nun der höfische Calcio Einfluss auf das englische Spiel hatte bzw. ob er das überhaupt hatte, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Anzeichen jedenfalls, die für das Vorhandensein eines feineren Fußballspiels sprechen (der höfische Calcio hatte sich im Laufe der Jahre verfeinert69), sind im damaligen England höchstens in Ansätzen zu erkennen.70 Trotzdem ist davon auszugehen, dass der Calcio den Engländern durch einige Bücher zumindest in der Theorie bekannt war. Ein unmittelbarer Einfluss dieser Bücher auf den Fußball in England kann nur vermutet werden.71 Als sich im 18. Jahrhundert keine Fans mehr für den Calcio fanden, starb dieser langsam aus.72
1.1.6 Puritanische Fußball-Kritik
Bezüglich der weiteren Entwicklung des Fußballs in England ab dem 16. Jahrhundert stand dieser mittlerweile auf breiten Füßen und war keine Angelegenheit eines bestimmten Teils der Bevölkerung mehr. Bauern, Handwerksleute, Adelige, Priester (!) und sogar Könige – alle vergnügten sich bei dem Spiel, so dass es in weiten Kreisen bekannt war.73 Weiterhin hatte der Fußball auch Einzug in die höheren Lehranstalten des englischen Königreichs erhalten, wie etwa in die Universitäten Oxford und Cambridge sowie in die Public Schools, wobei Oxford die fußballerischen Anfänge machte (1555), denen Cambridge gut zwanzig Jahre später (1579) nachkam.74
Aufschlussreich über die damaligen Entwicklungen ist eine Art „Spiel“-Bericht, der einer Quelle aus Cambridge entstammt: „Einige Studenten [aus Cambridge] brachen nach Chesterton auf, um gegen die dortige Jugend ein Match auszutragen. Friedlich und unbewaffnet, so heißt es in den Annalen ausdrücklich, seien sie zum Fußballspiel gekommen, doch die Leute aus Chesterton hatten im Vorraum der Kirche heimlich einige Prügel versteckt (…), die sie dann nach Spielbeginn hervorholten, um sie den Cambridgern über den Kopf zu schlagen. Nach einer fürchterlichen Prügelei mussten die Studenten schließlich über den Fluss fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Einige der Geflohenen forderten den königlichen Festungskommandanten von Chesterton auf, den vom König verbrieften Frieden wiederherzustellen. Doch der Kommandant entpuppte sich als Parteigänger ihrer Gegner und beschuldigte nun seinerseits die Studenten, als erste den Landfrieden gebrochen zu haben.“75 Die Konsequenz daraus war ein von der Universitätsleitung per Dekret im Jahre 1580 erlassenes prinzipielles Fußball-Verbot außerhalb der Universität.76
Starke Kritik am Fußball kam auch von den Puritanern aufgrund ihrer Ideale der Gefühlsbeherrschung, Arbeitsdisziplin und der Zügelung des Genusses, kurz: der strengen Selbstzucht.77 Der triebgesteuerte Fußball hatte hier keinen Platz. Prominentester Verfechter der puritanischen Fußballkritik war der Prediger Philipp Stubbes, der in seinem Werk „Die Anatomie der Missbräuche“ aus dem Jahre 1583 den Fußball scharf verurteilte, indem er ihn als „teuflischen Zeitvertreib“ oder als „blutige und mörderische Beschäftigung“78 beschimpfte: „Lauert dabei nicht jeder seinem Gegner auf und versucht, ihn zu Fall zu bringen und ihm auf seine Nase zu schlagen, selbst wenn das Spiel auf steinigem Boden stattfindet?“79 Durch diese Spielweise, so Stubbes weiter, werde „manchem das Genick gebrochen, manchen der Rücken, anderen Arme und Beine, einigen schieße das Blut aus den Nasen, hervorquellende Augen seien keine Seltenheit. Selbst die Besten kämen nicht ohne Schaden davon, auch sie würden so verletzt und gequetscht, dass sie sterben würden oder jedenfalls nur knapp dem Tod entgingen“80.
Auch über die Folgen des Fußballspiels hat Stubbes eine eindeutige Meinung: „Daraus erwachsen Neid, Bosheit, Hass, Zorn, Abscheu, Missvergnügen, Feindschaft und was sonst noch alles. Und manchmal, wie die tägliche Erfahrung uns lehrt, führt das Kämpfen, Raufen, Zanken und Streitsuchen zu Mord, Totschlag und großen Blutströmen.“81
Aufgrund des großen Einflusses der Puritaner in der damaligen englischen Gesellschaft nahm die Zahl der Fußballfans in sämtlichen Gesellschaftsbereichen ab82, wobei die Fußballleidenschaft nicht auszurotten war. Denn während es zum Beispiel durch den Sieg der puritanischen Parlamentspartei über die Königlichen im Bürgerkrieg im Jahre 1642 und der daraus resultierenden harten Verfolgung der Fußballer es mit dem Fußball endgültig vorbei zu sein schien83, zeigte der 1660 inthronisierte König Karl II. wieder ein Herz für den Fußball. 1681 erfreute er sich sehr an diesem Sport als Zuschauer, und auch an den Schulen und Universitäten wurde in den folgenden Jahren wieder Fußball gespielt.84
Die Leidenschaft, die dieser Sport schon damals auslöste, war die tragende Säule, die den Fußball gegen alle äußeren Widerstände am Leben hielt.
1.1.7 Die Zeit des wilden Straßenfußballs
Im 18. Jahrhundert gab es sonntägliche Fußballspiele unter geistlicher Aufsicht, die allerdings nicht als ästhetischer Genuss zu bezeichnen waren. Dies galt insbesondere für die großen Spiele, die an Festtagen veranstaltet wurden.85 Hierzu ein Auszug aus einem Spielbericht eines Derbys, das zwischen den Gemeinden Llandyssul und Llanwenog im Jahre 1719 ausgetragen wurde: „Als das Spiel begann, herrschte eine ausgelassene Stimmung, die sich auch auf die von großem Lärm und Gejohle begleiteten Aktionen des Spiels übertrug. Erst nach einer Unterbrechung zur Mittagszeit wurde dann das, was so fröhlich begonnen hatte, plötzlich immer ernster.“86 Wie ernst, das kann man bei der Chronistin Anne Beynon nachlesen, deren Bruder an den Spielen teilgenommen hatte: „Schon kurz nachdem das Spiel am Nachmittag wieder begonnen hatte, fingen alle damit an, zu streiten, zu fluchen und sich gegenseitig zu treten. Einige waren nur betrunken, aber der große Rest hatte viel zu viel abbekommen; es war fürchterlich mit anzusehen, sie kämpfen zu sehen, wie die Mädchen hin und her rannten und schrien, um ihre Brüder und Freunde zu retten; aber das gelang natürlich nicht, und so fuhren sie fort, wie Bulldoggen miteinander zu kämpfen.“87 Am Ende war eine allgemeine Erschöpfung festzustellen und viele lagen gezeichnet vom Kampf und vielen Alkohol am Boden. Derartige Begebenheiten warfen kein gutes Licht auf den Fußball.
Erst nach und nach setzten sich einige Regeln durch, die dem ganzen Durcheinander Einhalt gebieten sollten. 1696 etwa ist ein Spiel mit begrenzter Spielerzahl (zehn gegen zehn) überliefert, wobei zusätzlich das Kicken mit dem Fuß wichtiger wird als das Raufen.88 Das erste schriftliche Zeugnis eines geregelten britischen Fußballspiels stammt aus Irland und ist ein 1720 in Dublin veröffentlichtes Epos von Matthew Concanens mit dem Titel „A Match at Football“. Dieses enthält viele Informationen rund um das Spiel, so zum Beispiel die, dass ein mit Heu gefüllter Lederball zum Spielen benutzt wurde und das Spielfeld sowie die Anzahl der Spieler pro Team begrenzt waren.89
Trotz dieser ersten Regeln blieb der Fußball mit Unruhen verbunden und war den Behörden ein Dorn im Auge. Dies galt vor allem für den wilden Straßenfußball, wie er in den wachsenden Städten gespielt wurde. Dieser wurde deshalb 1608 beispielsweise in Manchester verboten und 1618 wurden verschärfend - offensichtlich hatte das Verbot nicht die gewünschte Wirkung erzielt - spezielle „Football Officers“ eingesetzt. Das Verhältnis des Fußballs zur Obrigkeit war im 17. und 18. Jahrhundert angespannt und der Fußball blieb weiterhin verboten.
Lediglich auf dem Land sah man den Fußball als nicht so problematisch an90; vielmehr blieb der wilde Straßenfußball in den Städten Englands, der nicht selten blutige Raufereien und Sachschäden zur Folge hatte, das eigentliche Problem.91
Diese Entwicklung gipfelte laut Joseph Strutt am Ende des 18. Jahrhunderts darin, dass der Fußball in England fast vollständig von der Bildfläche verschwand: „Früher war das Fußballspiel beim einfachen englischen Volk sehr beliebt, scheint jedoch in letzter Zeit in Verruf geraten zu sein und wird nur noch selten betrieben.“92 Als Ursache dafür ist anzunehmen, dass sich die Konflikte zwischen den wilden Fußballern, sowohl denen aus der Stadt als auch denjenigen vom Land und den Behörden zugespitzt hatten, was auch politische Gründe hatte, die hier aber nicht näher beleuchtet werden sollen.93
Die Quellen über geregelte Fußballspiele geben leider nicht allzu viel Auskunft, aber dennoch, dass behauptet werden kann, dass der Fußball als Spiel im 18. Jahrhundert sehr beliebt blieb und es ein allgemeines Verständnis über seinen Ablauf gab.94 Auch während der Zeit der industriellen Revolution, die in England 1718 mit dem Bau der ersten großen Seidenspinnerei in Derby einsetzte, wurde Fußball gespielt, obwohl die Leute aufgrund der vielen Arbeit nicht so viel Zeit zum Spielen hatten. Denn es galt die 6-Tage-Woche und der 12-Stunden-Tag.95 So waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geregelte Formen des Fußballspiels mehr verbreitet als in vergangenen Zeiten, was zu einem lebendigen Spielbetrieb führte.96 Gespielt wurde unter anderem auf Cricket-Plätzen, auf brachliegenden Feldern, kleinen Gemeindewiesen oder Pferdekoppeln der Wirtshäuser. Dabei ging es durchaus diszipliniert und weniger chaotisch zu. Während sich diese regulierten Spiele im Laufe der Zeit großer Beliebtheit erfreuten97, wurden die wilden Massenspiele überall verboten und verschwanden so in relativ kurzer Zeit. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts verschwand die Tradition des Volksfußballs.98 Diese Entwicklung war allem Anschein nach die Folge damals vorherrschender, viktorianischer Moralvorstellungen einer disziplinierten Lebensweise, die offensichtlich in den vielen regulierten Spielen ihren sportlichen Ausdruck gefunden hatte.99
Bevor die Zeit beschrieben wird, in der der Fußball zu einem Spiel mit allgemein anerkannten Regeln wurde, zunächst noch eine Einschätzung von Christoph Bausenwein der besseren historischen Einordnung wegen: „Das Spiel, wie wir es heute kennen, hat eine lange Vorgeschichte; und schon Jahrzehnte vor der Zeit, als man Regeln mit einem universellen Geltungsanspruch schuf, gab es zahlreiche Varianten, die dem heutigen Spiel durchaus ähnlich waren. Vielleicht haben einige dieser Spielformen auf die Herausbildung der endgültigen Regeln einen gewissen Einfluss gehabt. Sicher scheint, dass sich der ‚richtige‘ Fußball später nur deswegen so rasch in der arbeitenden Klasse Großbritanniens verbreiten konnte, weil er auf ‘offene Türen’ traf: Die Grundidee des Spiels war schon längst bekannt.“100
1.1.8 Fußball in denPublic Schools
In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts trat der Fußball in verschiedensten Erscheinungsformen auf: Wie bereits erwähnt, wurde der traditionelle Volksfußball stark bekämpft bzw. war bereits verschwunden. Doch gleichzeitig entwickelten sich an den Public Schools weitere Sonderformen des Fußballs. In den separierten Räumen dieser Schulen, in denen die Gesetze einer eigenen Welt herrschten, hatten sich eigene Traditionen des Spiels herausgebildet.101 Im Laufe des 18. Jahrhunderts erwarben sich diese Schulen den Status als Schulen der Vornehmen, so dass hier viele adelige Schüler zu finden waren, die sich nicht mehr als bezahlte Dienstboten sahen, sondern durchaus ihre eigenen Vorstellungen hatten.102 So führten sie zum Beispiel Fußballspiele auf der Basis lokaler Regeln ein. Geht man von den strengen Vorgaben in puncto Benehmen aus, denen diese adeligen Schüler normalerweise unterworfen waren, überrascht auf den ersten Blick die brutale Art und Weise, wie sie Fußball spielten103, wie folgender Spielbericht aus Westminster veranschaulicht: „Während des Laufs mit dem Ball stellte der Gegner dir ein Bein, trat dir ans Schienbein, rammte dich mit der Schulter, riss dich zu Boden und setzte sich auf dich. In der Tat konnte er – außer Mord – alles tun, um dir den Ball zu entreißen.“104 Auf den zweiten Blick dürfte diese Brutalität aber eine Ventilfunktion gehabt haben und als Entlastung von den zivilisatorischen Zwängen empfunden worden sein, mit denen sie sich ansonsten in ihrem Alltag konfrontiert sahen.105
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelte sich dann die Machtbalance von Bürgertum und Adel tiefgreifend, weil das Bürgertum während der Industrialisierung an Macht und Reichtum gewann und die finanzielle und politische Situation des Adels immer kritischer wurde. In diesem Zusammenhang wuchs auch die Autorität der Schule und damit der Lehrer, die nun die oben geschilderten brutalen Spiele grundlegend verändern wollten und sie zu einem Instrument sozialer Kontrolle und Disziplinierung der Schüler machten. Damit einher ging die Reformierung der verschiedenen winterlichen Fußballspiele, wobei vor allem die Reformen eines Thomas Arnold in Rugby (1828-1842) zum Paradebeispiel des neuen Erziehungsideals wurden. Da diese Reform schnell zu einem Erfolg wurde, entwickelte sich der „Rugby Football“ zu einem Kult, denn in ihm zeigte sich das Ethos des Sportsmannes in besonders vorbildhafter Weise.106
So kam es, dass bereits 1845 die ersten schriftlichen Regeln des Rugby-Spiels vorlagen. Besonders die folgenden drei Aspekte waren bei diesen Regeln wesentlich:
Regulierung von Gewalt: Während beim alten Volksfußball noch alle Arten der Gewaltanwendung erlaubt waren, differenzierte man nun zwischen legitimer und illegitimer Gewalt. So war etwa das Tragen eisenbeschlagener Schuhe verboten, das Treten des anderen im Gedränge aber erlaubt.107
Brechung des Individualismus der Schüler: Der einzelne Schüler, das heißt der einzelne Spieler, sollte mit seinem Team verschmelzen und der Sieg der Mannschaft und nicht der des Einzelnen im Vordergrund stehen.
Das Problem der Pubertät entschärfen: Die Pädagogen der damaligen Zeit gingen davon aus, dass Masturbation schädlich und Sport der beste Weg zur Reinhaltung der Jungen sei.108
Das Entscheidende dieser Regeln war weniger das Spiel-Technische, sondern die ethischen Konnotationen, die für neue Identifikation und neue Verhaltensstandards sorgten. Neu war auch, dass man wegen der schriftlichen Fixierung der Regeln nun zum ersten Mal ein Spiel mit universeller Struktur hatte.109 „Kurz: Rugby war das erste Sportspiel, das man überall auf gleiche Weise spielen konnte (…). Daher (…) erhielt es sehr schnell in ganz England einen außerordentlichen Ruf.“110
Daraufhin verschriftlichten nun auch weitere Schulen ihre Regeln. Und da jede Schule stolz auf ihre Tradition war, entbrannte förmlich ein Wettkampf um die Frage, wer das beste Spiel vorzuweisen hatte.111
1.1.9 Die Gründung der englischen Football Association (FA)
Nach dem Verschwinden des Volksfußballs galten Mitte des 19. Jahrhunderts allein die an den Public Schools entwickelten und mittlerweile mit klaren Regeln versehenen Football-Varianten als gesellschaftlich akzeptabel. Die geregelten Spiele der arbeitenden Bevölkerung wurden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Allein der Rugby-Football brachte es außerhalb der eigenen Schule zu einer gewissen Verbreitung.112
Problematisch war allerdings, dass es vom Rugby-Football immer noch verschiedene Varianten gab, obgleich jeder davon überzeugt war, dass es sich beim Football um ein einziges Spiel handelte. Deshalb bemühte man sich nun erstmals einen allgemeinverbindlichen und allseits akzeptierten Regelcodex für ein Fußballspiel festzulegen. Konkret organisierten J.C. Thring und H. De Winton eine Zusammenkunft mit zwölf Vertretern anderer Schulen.113 Ergebnis dieses Treffens, bei dem hart diskutiert wurde, waren die sogenannten Cambridge Rules, die eindeutig das Kicken des Balles mit dem Fuß favorisierten. Auch außerhalb von Cambridge nahmen ungefähr zur gleichen Zeit die fußballerischen Aktivitäten zu. So wurden erste Fußballclubs gegründet (in Sheffield etwa 17, in London 25), die aber noch unterschiedliche Varianten des Fußballs spielten. In Cambridge durfte der Ball zum Beispiel mit der Hand nur gestoppt werden, in Sheffield durfte er auch mit der Hand geschlagen werden.114
Entscheidend war schließlich die Initiative von John D. Cartwright, der dafür plädierte die verschiedenen Fußballspiele in einem Regelwerk miteinander in Einklang zu bringen. Konkret lud er die Repräsentanten der einzelnen Fußballvarianten ein, gemeinsam an dieser Frage zu arbeiten. Im Oktober 1863 kamen daraufhin Vertreter von sechs Schulen am Trinity College von Cambridge zusammen.115 Zur gleichen Zeit trafen sich auf Einladung von Ebenezer C. Morley am 26. Oktober 1863 in der Freemasons’ Tavern in der Great Queen Street





























