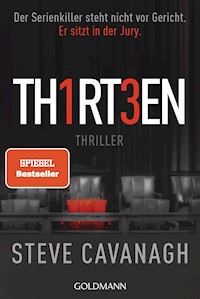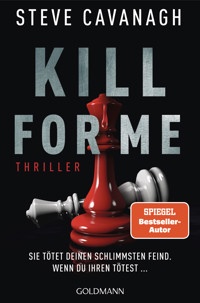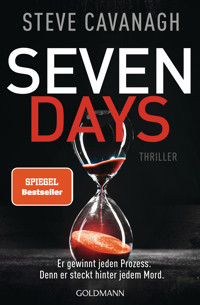10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eddie-Flynn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer ist gefährlicher – der Mann, der die Wahrheit kennt? Oder der, der die Lüge glaubt?
Leonard Howells durchlebt einen Albtraum: Seine Tochter Caroline wurde entführt und dabei lebensgefährlich verletzt. Nur einem Mann traut Howell zu, sie zu retten: Eddie Flynn. Eddie weiß, wie es ist, eine Tochter zu verlieren. Und als ehemaliger Betrüger und jetziger Spitzenanwalt kennt er alle Tricks, um seine Gegner hinters Licht zu führen. Doch als die Lösegeldübergabe scheitert und Leonard Howells selbst unter Verdacht gerät, sind plötzlich zwei Leben in Gefahr. Irgendjemand zieht im Hintergrund die Fäden in einem Spiel, das vor vielen Jahren begann. Und in dem Eddie bald nicht mehr weiß, wer die Wahrheit sagt, und wer lügt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Leonard Howells durchlebt einen Albtraum: Seine Tochter Caroline wurde entführt und dabei lebensgefährlich verletzt. Nur einem Mann traut Howell zu, sie zu retten: Eddie Flynn. Eddie weiß, wie es ist, eine Tochter zu verlieren. Und als ehemaliger Betrüger und jetziger Spitzenanwalt kennt er alle Tricks, um seine Gegner hinters Licht zu führen. Doch als die Lösegeldübergabe scheitert und Leonard Howells selbst unter Verdacht gerät, sind plötzlich zwei Leben in Gefahr. Irgendjemand zieht im Hintergrund die Fäden in einem Spiel, das vor vielen Jahren begann. Und in dem Eddie bald nicht mehr weiß, wer die Wahrheit sagt, und wer lügt …
Weitere Informationen zu Steve Cavanagh sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
STEVE CAVANAGH
LIAR
Der dritte Fall für Eddie Flynn
Thriller
Aus dem Englischen von Jörn Ingwersen
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Liar« bei Orion books, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, LondonDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2023
Copyright © der Originalausgabe
2017 by Steve Cavanagh
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München, nach einem Entwurf von Headdesign/Orionbooks
Covermotiv: © shutterstock/maciej, Filip Fuxa
Redaktion: Regina Carstensen
AB · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30416-4V002
www.goldmann-verlag.de
Für Chloe
Hiermit schwöre ich feierlich, mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft für die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Verfassung des Staates New York einzutreten und treu die Pflichten eines Rechtsanwalts zu erfüllen.
Beginn des 13. Artikels der Verfassung des Staates New York; Amtseid eines Junganwalts
Ein Lügner ist voller Schwüre.
Aus Der Lügner von Pierre Corneille
ERSTER TEIL
2. AUGUST 2002
Upstate New York
Die Kleine schrie seit zwanzig Minuten. Julie hatte sie gefüttert, sauber gemacht, gewickelt, geschaukelt, ihr was vorgesungen und sie sogar im Arm gehalten. In der späteren Phase ihrer Schwangerschaft hatte sie ein halbes Dutzend Bücher gelesen, und an diesem Tag versuchte sie es zum fünften Mal mit »kontrolliertem Schreienlassen«. In dem Buch stand, man solle das Baby sich selbst beruhigen lassen. Nach Aussage des Autors war das ein wichtiger Bestandteil des Schlaftrainings. Es fiel ihr schwer, und noch hatte Julie es nicht geschafft, die empfohlenen zwei Minuten durchzuhalten, ohne ins Kinderzimmer zu gehen und das Baby auf den Arm zu nehmen. Nicht einmal in den dunkelsten Ecken ihres Gedächtnisses fand Julie eine Erinnerung daran, dass ihre Mutter sie irgendwann einmal im Arm gehalten hatte. Als sie selbst Mutter wurde, war sie anfangs unbeholfen gewesen. Dieses kostbare Leben in Händen zu halten, schien ihr nicht richtig zu sein. Ihr war, als sollte man ihr etwas so Neues, so Reines und Zerbrechliches nicht anvertrauen.
Julie drückte die Tür zum Kinderzimmer auf und summte leise vor sich hin, während sie sich dem Bettchen näherte. Augenblicklich beruhigte sich das Kind. Die Jalousien waren geschlossen, und nur das trübe Nachtlicht beleuchtete Julies Gesicht. Es reichte, damit die Kleine ihre Mutter sehen konnte. Leise summte Julie immer weiter und lächelte, während ihr Baby sanft eindämmerte.
Lautlos zog sich Julie wieder aus dem Kinderzimmer zurück, prüfte noch mal, ob das Babyfon eingeschaltet war, bevor sie die Tür hinter sich schloss.
Die Uhr zeigte fünf nach zehn.
Julie bahnte sich einen Weg in ihr provisorisches Atelier, das früher vermutlich eine Abstellkammer gewesen war. Vorwurfsvoll stand eine halb fertige Leinwand auf einer Staffelei. Nachdem Julie den kleinen Lautsprecher des Babyfons in die Jeans gesteckt hatte, sah sie sich nach ihrer Schürze um. Sie fand sie in einer Ecke, band sie um und machte sich ans Werk. Die erste halbe Stunde lief gut, doch dann, als das Zittern kam, wurden ihre Pinselstriche eckig, schwerfällig. Waren ihr vorher sanfte, zarte Linien gelungen, so wurden sie nun wacklig und ungleichmäßig. Mit der Zeit wurde das Zittern immer schlimmer, und sie spürte diesen altbekannten Drang. Am Tag zuvor hatte sie die roten Dachziegel mit einem einzigen, ebenmäßigen Strich gemalt, doch nun wirkten sie unbeholfen, krumm und schief.
Julie musste dringend was dagegen tun.
Sie legte ihre Schürze ab, warf sie wieder in die Ecke und machte sich auf die Suche nach Linderung. Den Flur entlang, am Kinderzimmer vorbei. Sie kam zum Wohnzimmer, ging hinein und schloss die Tür hinter sich ab. Mit einem Druck auf den Wandschalter startete sie den Deckenventilator, stellte ihn auf höchste Geschwindigkeit und öffnete die Fenster. Vom Schreibtisch nahm sie ein gläsernes Pfeifchen und füllte es mit kleinen weißen Kristallkörnern, die sie in einer alten Tabakdose aufbewahrte.
Sie zündete die Pfeife an. Inhalierte.
Nahm noch einen Zug.
Ein überwältigendes Hochgefühl erfüllte sie. Ihr Herz schlug schneller, und eine Woge der Ekstase umfing sie wie eine warme Decke.
Da hörte sie die Wohnungstür. Endlich war Scott wieder da. Crack brachte sie immer gleich zum Schwitzen, und sie wischte sich die Stirn. Sie legte die Pfeife auf den Schreibtisch und öffnete die Tür zum Flur.
Doch da war niemand. Ihr Hirn fühlte sich an wie Brei. Geräusche wirkten lauter und doch gedämpft. Als lauschte sie unter Wasser. Sie hörte genauer hin. Da war es wieder. Ein leises Knarren von der losen Diele im Kinderzimmer. Julie lief den Flur entlang und öffnete vorsichtig die Tür zum Kinderzimmer.
Licht aus dem Flur fiel in den Raum.
Da stand ein Mann im Kinderzimmer.
Ein Fremder. Ganz in Schwarz gekleidet. Beugte sich über die Wiege. Der Raum schien zu kippen. Weil die Kleine ihren Mittagsschlaf hielt, waren die Vorhänge und Jalousien geschlossen, sodass Julie das Gesicht des Mannes nicht richtig sehen konnte. Je besser sich ihre Augen ans Dunkel gewöhnten, desto mehr konnte sie erkennen.
Er trug schwarze Handschuhe. Aus glänzendem Leder. Gesicht und Kopf waren irgendwie unförmig. Sie trat ins Kinderzimmer und merkte, dass er eine Maske trug.
Was sie da sah, war so überwältigend, so ungeheuerlich, so unwirklich, dass sie den Geruch anfangs gar nicht bemerkt hatte. Jetzt erst fiel er ihr auf. Streng. Beißend. Allzu vertraut.
Benzin. Das ganze Zimmer war von Benzin getränkt.
Bevor die Panik in ihr hochstieg, war sie hellwach. Und im selben lähmenden Augenblick wurde ihr bewusst, dass ihr Kind nicht mehr schrie.
Einen Moment lang dachte Julie, sie würde fallen. Das Dunkel im Zimmer schien auf sie zuzukommen. Und dann fiel sie tatsächlich. Kurz bevor sie am Boden aufschlug, setzte der Schmerz in ihrer Stirn ein. Sie spürte etwas Feuchtes in ihren Augen. Etwas Brennendes. Julie wischte sich übers Gesicht und betrachtete das Blut an ihren Händen. Sie kämpfte sich auf die Beine, und augenblicklich hatte die Finsternis sie wieder im Griff. Schwarze Handschuhe packten sie bei den Schultern, schoben sie rückwärts aus dem Kinderzimmer und durch den Flur.
Julie konnte nicht schreien. Sie wollte schreien. Sie musste schreien. Panik schnürte ihr die Kehle zu, und ihr Herz polterte wie ein Fußball in der Waschmaschine. Als eine der beiden Hände sie losließ, wand Julie sich, versuchte, auch ihren anderen Arm zu befreien.
Da traf sie etwas Hartes am Kopf. Diesmal spürte sie den Schmerz sofort. In ihrem Schädel flammte ein Feuer auf, und sie merkte, wie es sich über ihren Nacken bis in die Schultern ausbreitete. Der Mann in Schwarz ließ auch ihren anderen Arm los, und für einen kurzen Moment glaubte sie, es sei vorbei. Er würde sie laufen lassen. Sie täuschte sich.
Sie spürte, wie starke Hände sie vor die Brust stießen. Julie taumelte rückwärts und schlug mit dem Kopf seitlich gegen den Schreibtisch. Sie stürzte in die Finsternis. Alles wurde schwarz.
Schweigen. Stille. Schlaf.
Irgendwas in Julie weckte sie auf.
Es klang, als klopfte jemand an eine Tür. Das Klopfen wurde lauter. Ein dumpfer Schmerz begann in ihrem Kopf und wurde immer schlimmer. Es fühlte sich an, als drehte jemand an einem Schalter, bis der Schmerz kaum noch auszuhalten war.
Julie schlug die Augen auf und rührte sich. Sie wusste nicht, ob sie stand oder fiel. Ihr war schwindlig. Ihre Hände fanden den Boden unter ihr, und sie kam auf die Knie. Sie versuchte zu atmen, aber da war keine Luft. Nur dicker schwarzer Qualm. Hustend hielt sie sich am Schreibtisch fest, um sich auf die Beine zu stellen. Zwei Worte leuchteten in ihr auf.
Mein Baby.
Sie schaffte es, sich umzudrehen, und sah, dass die Tür nur angelehnt war. Als sie sie öffnete, schlugen ihr wütende Flammen entgegen. Mit sengender Macht traf die Hitze ihre Haut. Es war, als liefe sie gegen eine Feuerwand. Flammen fraßen sich ihren Weg aus dem Kinderzimmer hervor. Auch die Decke und den Teppich im Flur hatten sie schon ergriffen. Julie hob die Hände und trat auf den Flur hinaus, schaffte es aber nicht viel weiter. Sie konnte nicht hineinsehen. Das Kinderzimmer war eine einzige Flammenhölle. Qualm erstickte ihre Lunge, während die Hitze ihre Tränen trocknete, und doch schrie Julie so laut sie konnte.
Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie schon dort stand, während ihre Haut versengte und der Lärm des brennenden Hauses ihre Schreie übertönte. Von der Decke kam ein lautes Knacken, Putz und Staub rieselten herab, dann löste sich ein schwerer Balken vom darüber liegenden Stockwerk und traf Julie.
Sie lag da, verlor immer wieder das Bewusstsein. Blut sickerte aus der Wunde an ihrem Kopf. Sie wusste noch, dass sie irgendwohin wollte, dass sie irgendwas holen wollte, bevor der Balken auf sie herabgestürzt war, aber sie konnte sich nicht erinnern, was es gewesen sein mochte. Als die Feuerwehr vor dem Haus hielt, merkte Julie, dass sie verzweifelt war, weil sie etwas oder jemanden verloren hatte.
Und dann schlief Julie ein.
KAPITEL EINS
Um kurz nach Mitternacht stand ich einigermaßen nüchtern draußen vor dem Haus, in meinem besten schwarzen Anzug, mit weißem Hemd und grüner Krawatte, die Schuhe poliert und die Haare gebürstet, während ich auf einen Wagen wartete, der mich mitten in einen wahren Albtraum bringen sollte.
Auf der West 46th Street war alles ruhig. Die Bar an der Ecke hatte schon Feierabend gemacht. Die letzten Restaurantbesucher mieden die Außentische. Sie blieben lieber drinnen und dankten Gott für die Erfindung der Klimaanlage. Ich stand erst fünf Minuten draußen auf der Straße, aber schon war mein frisches Hemd am Rücken durchgeschwitzt. Der Juli in New York ist in jeder Hinsicht heiß und feucht.
Im Sommer nahmen die Verbrechen zu, weil die Menschen verrücktspielten. Üblicherweise Menschen, die den Rest des Jahres kein bisschen verrückt waren. Den Kriminellen war es oft zu heiß, um sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen, aber diesen Rückgang der Verbrechensrate glichen die ganz normalen Leute aus, die in der grausamen Hitze durchdrehten – die Hände feucht von Blut und Schweiß. In einem Augenblick der Raserei tun Menschen anderen Unvorstellbares an. Im Juli spielten sie alle verrückt.
Seit zwei Wochen litten wir unter einer rekordverdächtigen Hitzewelle, und auch das Dunkel der Nacht brachte keine Erleichterung.
Im Gegensatz zu den meisten Anwälten hatte ich keinen Aktenkoffer dabei. Und auch keinen Notizblock. Tatsächlich war ich nicht mal sicher, ob ich einen Stift bei mir hatte. In meiner Jackentasche befand sich ein einzelnes Dokument. Vier Seiten lang. Einzeilig beschrieben. Der Anwaltsvertrag zur Unterschrift meines neuen Mandanten. Was anderes brauchte ich nicht. Der Vorteil einer Ein-Mann-Kanzlei besteht darin, dass man nicht haufenweise Notizen machen muss, falls jemand anderes einen Fall weiterführen muss. Zeugenaussagen, Polizeiverhöre, Gerichtstermine, Geschworenenauswahl – abgesehen von der einen oder anderen irgendwo hingekritzelten Notiz hatte ich alles im Kopf. Ausnahmen waren Fälle, die wir alle am liebsten vergessen.
Während ich meinen Anzug vollschwitzte, fragte ich mich, ob der Fall, den ich übernehmen sollte, einer von denen sein würde, die ich in späteren Jahren am liebsten vergessen würde.
Der Anruf war vor gut zwanzig Minuten eingegangen, direkt übers Bürotelefon, nicht übers Handy. Entsprechend wollte ich erst gar nicht rangehen. Ein paar Auserwählte hatten meine Handynummer. Meine besten Mandanten, ein paar Freunde und die jeweiligen Innendienstler auf einem halben Dutzend Reviere, die mir Bescheid gaben, wenn irgendwelche interessanten Verhaftungen reinkamen.
Es war nach Mitternacht, also wusste ich, dass es weder meine Frau noch meine Tochter sein konnte. Was der Anrufer auch wollen mochte, es konnte warten.
Ich ließ den Anrufbeantworter anspringen.
»Das Büro der Anwaltskanzlei Eddie Flynn ist momentan geschlossen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht …«
»Eddie, ich weiß, dass du mich hörst. Bitte geh ran.« Eine männliche Stimme. Nicht mehr ganz jung, vielleicht um die vierzig oder fünfzig. Der Mann bemühte sich um deutliche Aussprache, die einen Tonfall der New Yorker Arbeiterklasse verbergen sollte. Brooklyn-Irisch.
Eine Pause entstand, während der Mann darauf wartete, dass ich den Hörer abnahm. Ich gab etwas mehr Wasser in meinen Bourbon und setzte mich aufs Bett. Ich schlief in einem kleinen Zimmer hinterm Büro. Nachdem ich in letzter Zeit ein paarmal richtig gut bezahlt worden war, würde ich mir bald eine Anzahlung auf eine Wohnung leisten können. Vorerst musste das Ausziehbett im Hinterzimmer genügen.
»Mir läuft die Zeit weg, Eddie. Wir machen es folgendermaßen: Ich nenne dir meinen Namen, und du hast zehn Sekunden Zeit, den Hörer abzunehmen. Wenn du es nicht tust, lege ich auf, und du hörst nie wieder von mir.«
Der erste Eindruck sagte mir, dass ich auf den Typ verzichten konnte. Er störte mich bei meinem abendlichen Schlummertrunk. Heutzutage genehmigte ich mir einen Drink pro Tag. Mein Magen wollte ihn schon um sechs, aber ich hatte festgestellt, dass ich ihn besser brauchen konnte, kurz bevor ich mich aufs Ohr haute. Ein großes Glas voll, langsam getrunken, half mir einzuschlafen und verhinderte manchmal sogar die Albträume. Nein, ich kam zu dem Schluss, dass der Typ heißen konnte, wie er wollte. Ich würde diesen Hörer nicht abnehmen.
»Leonard Howell«, sagte die Stimme.
Der Name war mir gleich vertraut, aber um diese Uhrzeit konnte ich nicht klar denken. Ein langer Tag im Gericht, Mandantentermine und keine Gelegenheit, irgendwo was zu essen, bedeutete, dass ich um diese Zeit nicht mehr ganz bei mir war. Manchmal wusste ich kaum noch, wie ich hieß.
Nach vier Sekunden fiel mir ein, woher ich den Namen des Anrufers kannte.
»Lenny, ich bin’s, Eddie.«
»Schön, deine Stimme zu hören. Du weißt vermutlich, warum ich anrufe.«
»Ich habe die Nachrichten gesehen und die Zeitungen gelesen. Es tut mir sehr leid um …«
»Dann wirst du dir denken können, dass ich nicht am Telefon sprechen möchte. Hättest du vielleicht später etwas Zeit? Ich brauche rechtlichen Beistand. Tut mir leid, wenn ich barsch klinge. Mir bleibt nicht viel Zeit«, sagte er.
Ich hatte Millionen Fragen, aber keine, die ich am Telefon stellen konnte. Ein alter Freund der Familie brauchte Hilfe. Mehr musste ich vorerst nicht wissen.
»Kannst du um vier?«, fragte er. Er musste es nicht aussprechen. Irgendwas war im Busch.
»Kann ich. Aber ich komm nicht erst um vier. Wenn ich was tun kann, würde ich lieber jetzt gleich rüberkommen. Wie gesagt, ich habe die Nachrichten gesehen. Ich weiß noch, wie du damals für meinen Dad Fußballwetten platziert hast. Er hat dich immer gemocht. Hör mal, das mit deiner Tochter tut mir wirklich leid. Und wenn es dir hilft … Ich habe es selbst erlebt. Ich weiß, was du durchmachst.«
Er sagte nichts. Das hatte er nicht erwartet.
»Ich erinnere mich gut an deinen Dad. Und an dich. Deshalb rufe ich an. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Jemanden, der meine Lage nachvollziehen kann«, sagte er.
»Verstehe. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich verstehe. Meine Tochter war zehn, als sie entführt wurde.«
»Und du hast sie zurückbekommen«, sagte Howell.
»Das stimmt. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Wenn du meine Hilfe willst, muss ich jetzt gleich da sein. Wo bist du?«
Er seufzte und sagte: »Ich bin zu Hause. Ich schick dir einen Wagen. Wo möchtest du abgeholt werden?«
»In meinem Büro. Ich warte draußen.«
»Der Fahrer ist in einer halben Stunde da«, sagte Howell, und ich hörte es klicken, als er auflegte. Ich dachte an Lenny Howell. Es mochte es nicht, wenn ihn heutzutage jemand Lenny nannte. Er war um einiges älter als ich und in meinem alten Viertel bekannt wie ein bunter Hund. Anfangs war er ein kleiner Gauner gewesen. Krumme Touren und Einbrüche. Seine Familie war arm, und er hatte eine schwere Kindheit gehabt. Sein Alter hatte ihn immer auf der Treppe vor der Haustür verprügelt. Bis mein Vater es eines Tages mitbekam und Lennys Vater für ein Gespräch von Mann zu Mann beiseitenahm. Lenny wurde nie wieder verprügelt. Und er ist nie wieder irgendwo eingebrochen. Stattdessen arbeitete er als Bote für das illegale Wettbüro meines Vaters. Lenny hat von meinem Vater gelernt, wie das Wettgeschäft läuft. Ich kannte ihn ein bisschen. Lenny war der Erste gewesen, der mir einen brauchbaren Trick beigebracht hatte. Eines Tages wurde Lenny etwas zu ruppig mit einem Marine, der seinen Dienstags-Blues nicht bezahlen konnte – die Schulden nach einer verlorenen Wette beim Montags-Football. Der Marine hat Lenny ordentlich den Hintern versohlt und gemeint, er sollte bei der Navy anheuern. Der Marine mochte den kleinen Lenny und nahm ihn unter seine Fittiche. Die Navy hat Lenny das Leben gerettet. Er hatte alles hinter sich zurückgelassen. Ich kannte dieses Gefühl. In meinen Zwanzigern war ich selbst als Trickbetrüger unterwegs gewesen, bevor ich die Seiten wechselte. Allerdings war mir in den letzten Jahren klar geworden, dass man seine Vergangenheit nie wirklich hinter sich zurücklassen kann.
Vor drei Tagen hatte ich Lenny Howell bei einer Pressekonferenz gesehen. Alle großen Nachrichtensender brachten die Story. Der Polizeichef saß links von ihm, Susan – seine neue Frau – rechts. Ihr Ehering war kaum vier Jahre alt. Der Klunker, den sie am selben Finger trug, glitzerte im Blitzlichtgewitter der Kameras, und angesichts seiner Größe fragte ich mich, wie sie es schaffte, ihn zu tragen, ohne sich dabei ihre zarten Finger zu brechen. Wäre ich Howells Berater gewesen, ich hätte ihm nahegelegt, allein vor die Fernsehkameras zu treten.
Er hatte kaum etwas gesagt. Das war auch nicht nötig. Als er seine Brille abnahm und offen in die Kamera blickte, sagten seine müden roten Augen alles. Als er dann sprach, schien es ihm schwerzufallen. Seine Worte waren mir erhalten geblieben, weil ich in derselben Lage gewesen war und seinen Schmerz kannte.
»Wer auch immer meine Tochter Caroline in seiner Gewalt hat … Bitte, tun Sie ihr nichts an! Geben Sie mir Caroline zurück, und Ihnen wird nichts geschehen. Versprochen. Wir wollen nur Caroline zurück.«
Caroline Howell war siebzehn Jahre alt. Seit neunzehn Tagen wurde sie vermisst. Es hatte offizielle Pressekonferenzen der Behörden gegeben, aber das nun war der erste Auftritt ihres Vaters. Howell verstand mehr von vermissten Personen als jeder andere. Er hatte bei den Marines gedient und an Einsätzen in so ziemlich jedem großen Konflikt der letzten zwanzig Jahre teilgenommen. Er kehrte als Kriegsheld zurück und wandte sich dem Personenschutz zu. In den letzten zehn Jahren hatte er mit Howell’s Risk Management ein Vermögen verdient. Eine Security-Firma, die auch Geiselverhandlungen, Risikobewertungen und Bedrohungsanalysen anbot.
Es gab im ganzen Land kaum jemanden, der mehr von Entführungen, Geiselbefreiungen und Verhandlungstaktik verstand. Jetzt war seine Tochter zum Opfer geworden.
Ich erinnerte mich, gesehen zu haben, wie er Carolines Entführer angefleht hatte – er hatte die richtigen Sachen gesagt und sich Wort für Wort an sein Skript gehalten. Immer wieder hatte er ihren Namen wiederholt, aber ich konnte es in seinen Augen sehen. Ich hörte das Echo der Verzweiflung in seiner Stimme. Ich hatte mal genauso geklungen. Vor ein paar Jahren war meine Tochter entführt worden. Die Tortur hatte nur zwei Tage gedauert, aber diese Tage verfolgten mich noch heute. Ohne Hilfe hätte ich sie niemals vom russischen Mob zurückbekommen.
Immer wenn ich Howells Gesicht im Fernsehen sah oder Fotos in der Zeitung, spürte ich einen Druck auf der Brust. Es war, als sähe ich ein altes Foto von mir selbst. Ich war dieser Mann gewesen.
Ich musste den Schweiß vom Zifferblatt meiner Armbanduhr wischen, um nach der Zeit zu sehen. Vierundzwanzig Minuten, seit ich den Anruf bekommen hatte. Ein roter VW hielt vor einer Bar namens Brews. Der Fahrer beugte sich über den Beifahrersitz und sah zu mir herüber. Das war nicht, was ich erwartet hatte. Ich war davon ausgegangen, dass mich ein Mercedes oder ein großer BMW abholen würden. So was hätte Howell nicht geschickt.
Der Typ stieg aus dem VW und setzte eine weiße Baseballkappe auf. Er trug ein verwaschenes T-Shirt, auf dem »Arnac Deliveries« stand. Vom Rücksitz nahm er ein Paket, das in braunes Papier gewickelt war, und legte einen weißen Umschlag darauf. Er schloss die Fahrertür und kam auf mich zu, Paket und Brief unter dem einen Arm und ein Klemmbrett unterm anderen.
»Eddie Flynn?«, fragte er.
Ich stutzte. Es war etwas zu spät für die Post, und dieser Typ hatte ganz sicher nichts mit Lenny Howell zu tun. Bei einem kurzen Blick nach links und rechts sah ich, dass sonst niemand auf der Straße war. Also hatte er keine Kumpane dabei, die ihm Rückendeckung boten. Er war kein Paketbote, so viel war sicher. Ich wandte mich nach rechts, um ihm weniger Angriffsfläche zu bieten, falls er ein Messer hinten in seiner Jeans stecken hatte.
Er lächelte, aber kein echtes Lächeln. Es war nur Show. Meine Fäuste waren bereit, dem Mann ins Gesicht zu fliegen, falls er eine abrupte Bewegung machen sollte.
»Ich bin Eddie Flynn. Ich erwarte keine Lieferung.«
Als er Paket und Klemmbrett auf dem Gehweg abstellte, nahm er den Umschlag in die Hand. Und da wusste ich, wer der Typ war.
Er hielt mir den Umschlag hin. Ich nahm ihn nicht. Langsam trat er vor, blieb direkt vor mir stehen und drückte mir den Umschlag an die Brust. »Post vom Gericht.«
Ich nahm den Umschlag entgegen.
Der Typ war Gerichtszusteller. Diese Leute verbrachten ihre Tage damit, Menschen aufzuspüren, und wenn sie sie fanden, überreichten sie ihnen Briefe, die diese Leute gar nicht haben wollten. Deshalb gaben sie sich als Lieferanten aus, als Touristen, die nach dem Weg fragten, oder als neue Kunden oder Mandanten. Ich erwartete kein Schreiben vom Gericht. Außerdem hätte er zu einer zivileren Uhrzeit kommen können – wie die meisten Gerichtszusteller. Nein, der Zeitpunkt war mit einiger Wahrscheinlichkeit von seinen Auftraggebern gewünscht. Sie wollten, dass ich das Dokument so spät erhielt, damit es mich die ganze Nacht über wachhielt. Als ich mit der Hand über den unbeschrifteten Umschlag strich, dachte ich, dass es nur eins sein konnte – Scheidungsunterlagen.
Ich riss den Brief auf. Er kam nicht von Christine, meiner Frau. Es war eine gerichtliche Anordnung, die kompletten Akten und Unterlagen über jemanden namens Julie Rosen herauszugeben. Dem Schreiben nach mussten die Akten innerhalb der nächsten vierzehn Tage dem Büro des Gerichtszustellers ausgehändigt werden. Wie ich dem Dokument entnehmen konnte, schien es mit einer Berufung in der Sache Das Volk vs. Julie Rosen zu tun zu haben.
Das sagte mir nichts. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich nie jemanden mit diesem Namen vertreten hatte. In der Vorladung stand, dass sie von dem Rechtsbeistand des Beschwerdeführers ausgestellt worden war, aber wie üblich wurden die federführenden Anwälte in der Vorladung nicht namentlich genannt.
»Hey, wer ist Rosens Anwalt?«
Der Mann sagte nichts, wandte sich nur von mir ab. Was unter den gegebenen Umständen unklug war. Ich steckte die Anordnung ein und wartete, während der Gerichtszusteller sich bückte und Paket und Klemmbrett aufhob.
Er hielt mir den Rücken zugewandt, als er sagte: »Da habe ich ja mal richtig Glück gehabt. Ich dachte schon, ich müsste erst noch das Büro suchen, um das Schreiben loszuwerden. Hat mir ein paar Treppen gespart. Schlaf gut, Kumpel.«
»Wer ist ihr Anwalt?«, fragte ich.
Der Gerichtszusteller wandte sich nicht mal um, war schon auf dem Weg zu seinem Wagen, als er noch sagte: »Das ist vertraulich. Du weißt genau, dass ich es dir nicht sagen darf.«
»Willst du denn deine Brieftasche gar nicht wiederhaben, Brad?«
Er blieb stehen, tastete nach seiner hinteren Hosentasche und fuhr herum.
»Wie hast du …?«
Ich hielt seine offene Brieftasche in der einen Hand und seinen Führerschein in der anderen.
»Du solltest Fremden nicht den Rücken zuwenden. Jetzt weiß ich, wo du wohnst, Brad«, sagte ich und schob den Führerschein wieder in die Brieftasche. »Wenn du das hier wiederhaben möchtest, solltest du mir sagen, wer dir die Anordnung gegeben hat. Wer Julie Rosen vertritt.«
Er verzog das Gesicht zu einer Fratze, stellte sein Alibi-Paket und das Klemmbrett weg. Dann ballte er die Fäuste.
»Ich polier dir gleich mal die Fresse«, sagte er, als er auf mich zukam.
Er nahm die Fäuste direkt unters Kinn, mit starrem Handgelenk, wie ein Schläger aus einem alten Kinofilm. Da wusste ich, dass Brad kein geübter Kämpfer war. Die erste Lektion, die ich in Mickey Hooleys Gym gelernt hatte – vor zwanzig Jahren im finstersten Loch von Hell’s Kitchen –, war gewesen, jemanden zu schlagen, ohne sich dabei das Handgelenk zu brechen. Mickey hat uns beigebracht, das Handgelenk um fünfundvierzig Grad abzuwinkeln, bis der Knöchel vom Zeigefinger eine gerade Linie zum Ellenbogen beschreibt. Dieser Winkel spannt all die kleinen Muskeln ums Handgelenk an, was eine solide Basis zum Zuschlagen bietet.
Ich hätte Brad zeigen können, wie es richtig ging. Hätte ihm die Faust in seine wütende Fratze schlagen können. In gewisser Weise hätte ich es auch gern getan. Wahrscheinlich hielt Brad sich für einen harten Hund. Ich konnte ihm das Gegenteil beweisen. Aber ich ließ es sein. Ich dachte mir, ich könnte mich besser mit ihm unterhalten, wenn er noch alle Zähne hatte. Also bremste ich ihn mit etwas weit Mächtigerem als einer rechten Geraden.
Ich steckte seinen Führerschein wieder in die Brieftasche, zupfte einen Hunderter aus meinem Bündel und hielt ihm den Schein unter die Nase.
Er wurde langsamer und ließ die Hände sinken. Ich nutzte den Moment, um ihm ein paar Fragen zu stellen.
»Wie steht der Kurs für zeitgenaue Zustellungen heutzutage? Zweihundert Dollar? Zwei-fuffzig? Wenn du abrechnest, was deine Firma bekommt, was an Steuern, Benzin, Versicherung abgeht, was bleibt dir am Ende? Ich schätze mal, achtzig Dollar. Hab ich recht?«
Er blieb ein paar Schritte vor mir stehen. Musterte mich von oben bis unten, dann starrte er den Hunderter in meiner Hand an.
»Neunundachtzig fünfzig«, sagte Brad.
Als Anwalt hatte ich schon mit diversen Gerichtszustellern zu tun gehabt. Ich kannte die Besten von Manhattan, und ich wusste genau, was sie berechneten und wie sich der Preis zusammensetzte.
»Mir bleiben genau zwei Möglichkeiten, Brad. Du hast die Wahl. Entweder rufe ich gleich morgen früh eine freundliche Gerichtssekretärin an, die mir verrät, wer die Vorladung ausgestellt hat, was mich nicht mehr kostet als ein paar Donuts, wenn ich das nächste Mal wieder im Gericht bin, oder du kannst mir den Aufwand sparen und ich stecke diesen Hundertdollarschein in deine Brieftasche, bevor ich sie dir wiedergebe. Du hast die Wahl«, sagte ich.
Brad wischte sich über den Mund, starrte den Hunderter an.
»Was ist, wenn es auf mich zurückfällt? Ich könnte gefeuert werden«, sagte er.
»Von mir wird es nicht kommen. Ich sage niemandem, dass ich es von dir weiß. Man wird annehmen, ich hätte eine Sekretärin bezirzt.«
Ich öffnete das Fach der Brieftasche, in dem Brad sein Bargeld aufbewahrte. Er hielt Ordnung. Die Brieftasche steckte nicht voller alter Quittungen oder Visitenkarten. Sein Führerschein und ein paar Kreditkarten ragten aus Fächern, die ordentlich übereinander angeordnet waren. Hundertsiebenundvierzig Dollar in bar waren fein säuberlich sortiert. Ganz hinten ein Hundertdollarschein, gefolgt von einem Zwanziger, einem Zehner, drei Fünfern und zwei Einern. Ich zeigte Brad die Brieftasche, schob meinen Hunderter zwischen seinen Hunderter und den Zwanziger.
»Letzte Chance«, sagte ich.
»Copeland. Der Anwalt ist Max Copeland«, sagte er.
Mir stellten sich die Nackenhaare auf.
Ich klappte die Brieftasche zu und warf sie ihm hin. Brad fing sie auf und steckte sie in die vordere Hosentasche. Er würde sie nie wieder hinten tragen. Erst, wenn er dafür eine Kette gekauft hatte. Ich sah ihm dabei zu, wie er das leere Paket und sein Klemmbrett aufsammelte, wieder in seinen Wagen stieg und davonfuhr.
Brad hatte keinen Blick mehr in seine Brieftasche geworfen, weil er sicher war, dass ich einen Hunderter aus meiner Tasche genommen und zwischen sein Bargeld gesteckt hatte. Ich öffnete die rechte Hand und faltete Brads Hundertdollarschein auseinander, den ich ihm vor wenigen Augenblicken fachmännisch entwendet hatte. Brad hatte es nicht mitbekommen, weil ich nicht wollte, dass er es mitbekam. Meine Hand war in seiner Brieftasche, um mein Geld reinzutun, aber er hatte nicht gesehen, dass ich sein Geld rausnahm. Ich betrachtete den Hunderter und musste an Max Copeland denken.
Bis vor drei Jahren etwa wussten nur sehr wenige Leute außerhalb der Branche irgendwas über Max Copeland. Er machte keine Werbung, stand nicht im Telefonbuch, er hatte keine Website, nicht mal ein Schild draußen an seinem Büro. Man wusste nur um seinen Ruf. Max Copeland vertrat die denkbar übelsten Mandanten und das mit blutrünstigem Vergnügen. Erst nach einem Artikel im Washington Street Journal erfuhr ein Teil der Öffentlichkeit seinen Namen.
Der Artikel hatte die Überschrift »Des Teufels Advokat«. Eine ziemlich zutreffende Beschreibung, auch wenn es ein Klischee sein mochte. Max vertrat Pädophile, Kindermörder, Serienkiller und Vergewaltiger. Und er verfolgte dabei nur ein einziges Ziel – sie freizubekommen. Ich war ihm nie begegnet, aber ich war auch nicht scharf darauf. Solche Typen waren nicht mein Fall.
Am Ende war es egal – ich hatte Julie Rosen nie vertreten, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich keine Akten von ihr hatte.
Zwei Scheinwerfer kamen um die Ecke. Sie gehörten zu einem schwarzen Lincoln. Stretchlimousine – elegant, 19-Zoll-Chromfelgen. Mit der Lackierung glitzerte das verdammte Ding wie der Klunker an Susan Howells Finger.
Der Wagen blieb direkt vor mir stehen. Ich steckte die Vorladung in mein Jackett und wurde mir mit einiger Verspätung darüber klar, dass es besser gewesen wäre, den Anruf von Leonard Howell nicht zu beantworten. Vielleicht lag es an der Vorladung, vielleicht daran, dass Max Copelands Name gefallen war – ich konnte nicht genau sagen, womit ich es zu tun hatte, aber am liebsten hätte ich den Fahrer des Lincoln gebeten, Howell auszurichten, es täte mir leid, aber ich hätte es mir anders überlegt.
Der Abend hatte keinen guten Anfang genommen, und irgendwie ahnte ich, dass es noch schlimmer kommen würde.
KAPITEL ZWEI
Die Fahrertür ging auf, und ein Mann stieg mühsam aus dem Wagen. Er trug einen schwarzen Anzug, der ihm etwas zu groß war. Die grauen Haare und das faltige Gesicht standen im krassen Gegensatz zu seinen stechend blauen Augen. Schwer zu sagen, wie alt er sein mochte. Entweder war er weit über fünfzig, oder er hatte viel Zeit auf der Straße verbracht. Die Straße macht was mit den Menschen. Sie lässt dich altern wie nichts anderes auf der Welt.
Ich hörte, wie seine Schuhe auf der Straße scharrten. Er zog das rechte Bein nach, hinkte unbeholfen wie unter Schmerzen. Als er um die Kühlerhaube des Wagens herumkam, merkte ich, dass sein rechter Fuß verdreht und nach innen gebogen war, sodass er ihn hinter sich herschleifte. Dann schoss das linke Bein vor und machte sich lang, damit er sich aufrichten und voranschlurfen konnte. Er hielt den Kopf gesenkt und stützte sich an der Kühlerhaube ab. Ich sah Lederriemen an seinem Knöchel – vermutlich hielten sie eine Stahlplatte, die in den Schuh eingearbeitet war.
»Mr Flynn?«, fragte er mit einem Singsang in der Stimme.
»Danke, dass Sie mich abholen«, sagte ich und reichte ihm die Hand.
Er hüpfte ein Stück voran und nahm sie. Sein Griff war kräftiger als erwartet.
»I…I…Ich bin George«, sagte er. »Mr How…How…Howell schickt mich, Sie aufzup…« Seine Lippen pressten sich zusammen und bebten, während er versuchte, das P hervorzupressen.
Mein Großvater mütterlicherseits war Stotterer. Als ich sechs oder sieben Jahre alt war, habe ich oft bei ihm gespielt. Immer hatte er irgendwo in der Küche was Süßes versteckt, und wir haben gespielt, dass ich es finden musste. Er durfte nur nicken oder den Kopf schütteln, um mir anzuzeigen, ob ich dem Versteck näherkam oder nicht. Es war sein Lieblingsspiel, weil er dabei nichts sagen musste. Wenn wir miteinander redeten, hat meine Mutter oft mit mir geschimpft, weil ich es nicht lassen konnte, seine Sätze zu beenden. Irgendwann habe ich damit aufgehört und gelernt, geduldig zu sein.
Ich wartete darauf, dass George seinen Satz beendete, und hielt dabei seine Hand. Von Sekunde zu Sekunde griff er immer fester zu, und langsam tat es weh. Sein Kopf wurde puterrot, und feiner Speichel sprühte von seinen Lippen, während er dem schwierigen Wort näherkam. Schließlich spulte er seinen Satz ein Stück zurück und versuchte es noch mal.
»… schickt mich, um Sie aufzuPICKEN«, sagte er.
»Danke, George«, sagte ich.
Er ließ meine Hand los und schlurfte scharrend um den Wagen herum.
»Ich m…m…mach Ihnen die Tür auf«, sagte er.
»Nicht nötig, George. Ich habe schon mit siebenundzwanzig angefangen, eigenständig Autotüren zu öffnen«, sagte ich.
George lachte und wackelte mit dem Zeigefinger. Unbeholfen machte er kehrt und schleppte sich um den Wagen herum und wieder zurück auf den Fahrersitz.
Ich saß auf dem Rücksitz, bevor George auch nur in der Nähe der Fahrertür war. Die Klimaanlage hatte er voll aufgedreht. Eine Wohltat. Als würde man nach der Sauna in kühle Seide gewickelt. Ich beugte mich zwischen die Vordersitze, weil ich nicht anders konnte, als mir die Pedale näher anzusehen. Das Gaspedal wirkte normal, aber die Bremse war umgebaut und mit einem dicken Gummiblock versehen, damit George es leichter hatte.
Lenny Howell schien immer noch ein netter Kerl zu sein.
George richtete sich auf dem Fahrersitz ein, ließ den Motor an und holte ein Taschentuch hervor. Er wischte sich den Schweiß vom Gesicht und sagte: »Das ist mal wieder so ’ne N…N…Nacht.«
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Wir fuhren in den Norden von Manhattan, auf dem Henry Hudson Parkway, die Klimaanlage auf voll und links von mir der Mond auf dem Fluss. Vorbei an Washington Heights, Harlem, dann führte der Freeway in Inwood weiter landeinwärts, während die Stadt vor sich hinbrütete. George nahm die Ausfahrt zum Cross County Parkway in Richtung New Rochelle. Er redete nicht, fragte mich nur, ob ich es bequem hätte. Ich war froh, die hohe Luftfeuchtigkeit hinter mir zu lassen. Meine Haare waren fast trocken.
Ich dachte über den Namen Julie Rosen nach, aber mir wollte nichts einfallen. Mein früherer Partner Jack Halloran und ich hatten eng zusammengearbeitet. Hätte Jack den Fall bearbeitet, wäre mir der Namen bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Es konnte sich eigentlich nur um eine tote Akte aus dem Lager der Kanzlei Ford & Keating handeln. Mein Interesse am Rechtswesen war geweckt worden, als ich Harry Ford kennenlernte, der damals Teilzeit-Richter war. Wir hatten uns angefreundet, und als ich die Kanzlei Halloran & Flynn aufmachte, bekam Harry eine Vollzeitstelle als Richter und gab seine eigene Kanzlei auf. Sein alter Partner – Arthur Keating – setzte sich damals zur Ruhe, und Jack und ich kauften den beiden ihre letzten laufenden Fälle ab. Neben zwanzig oder dreißig aktuellen Fällen bekamen wir auch die alten Akten zum Einlagern. Weil wir ihnen die Aktenberge abnahmen, erhielten wir einen Preisnachlass auf die Fälle, an denen noch was zu verdienen war.
Konnte Julie Rosen eine alte Mandantin der Kanzlei Ford & Keating gewesen sein? Ich sah auf meine Uhr. 00:40 Uhr. Viel zu spät, um Harry anzurufen. Selbst wenn es einer seiner alten Fälle sein mochte, wollte ich ihn um diese Uhrzeit nicht mehr anrufen. Das konnte bis morgen warten. Was es auch sein mochte – der Umstand, dass Copeland damit zu tun hatte, bereitete mir Bauchschmerzen.
»I…Ich hoffe, Sie können Mr Howell helfen«, sagte George.
»Das hoffe ich auch. Wie hält er sich?«
George schüttelte nur den Kopf. Das sagte alles.
»Und der Rest der Familie?«, fragte ich.
»Nicht so schlimm«, sagte George nach kurzer Überlegung. »Da ist nur M…Mrs Howell. Und die beiden sind nicht blutsverwandt, wissen Sie?«
»Habe ich in der Zeitung gelesen. Mr Howell hat noch mal geheiratet.«
Als George antwortete, hatten seine Worte Gewicht, trotz des Stotterns.
»V…Vielleicht ist es ein Segen. Dass die richtige Mutter des Mädchens in der Erde liegt. N…N…Niemand sollte sein Kind verlieren.«
In der Post hatte gestanden, dass Caroline Howells Mutter schon vor langer Zeit gestorben war.
Wir verließen den Freeway und erreichten bald die Main Street. Um diese Uhrzeit herrschte nicht viel Verkehr. Wir steuerten Premier Point in New Rochelle an. Eine Partnergemeinde von Premium Point. Während Premium Point in einer hochgesicherten Anlage fünfzig Milliardäre aus aller Welt beherbergte, war Premier Point im Vergleich der arme Vetter. Zwar handelte es sich dabei ebenfalls um eine abgeschlossene Wohnanlage mit Privatstraßen und bewaffneten Wachleuten, aber in Premier Point konnte man sich schon mit sieben oder acht Millionen Dollar in der untersten Kategorie einkaufen. Zwar musste man auf einen Hubschrauberlandeplatz und eine eigene Golfanlage verzichten, aber Premier Point war auch ganz okay.
Dass wir uns dem Tor der Anlage näherten, schloss ich aus den diversen Übertragungswagen von Nachrichtensendern und den Satellitenschüsseln, die auf einer freien Fläche vor der Einfahrt standen. In bester unternehmerischer Tradition hatten sich eine Kaffeebude und ein Taco-Van vorgenommen, die Reporter und Nachrichtensprecher satt und wach zu halten. Dunkle Gestalten warfen die Kaffeebecher weg und griffen nach ihren Kameras. Sie bekamen nur ein paar Bilder von dem Wagen, als wir in die Privatstraße einbogen und vor dem Tor hielten. Aus dem Pförtnerhäuschen drang ein warmes Leuchten, und wir saßen da und warteten darauf, dass der Wachmann heraustrat. George brachte den Automatikhebel in Parkstellung und verschränkte die Arme. Ich nahm an, dass er sich schon daran gewöhnt hatte, sich zu gedulden, bis der Nachtwächter seinen Hinterm vom Fernseher im Pförtnerhäuschen wegbewegte. Nachtwächter machen nie irgendwas schnell. Deshalb sind sie ja Nachtwächter geworden.
Mein Handy vibrierte und zeigte mir einen Anruf. Es war Harry Ford. Der späte Anruf konnte nichts Gutes bedeuten.
»Hi, Harry. Gut, dass du anrufst …«
Er fiel mir ins Wort: »Eddie, ich habe gerade eine gerichtliche Anordnung wegen der Akten von einem alten Fall bekommen. Ich wollte dich nur vorwarnen. Könnte sein, dass du auch so was kriegst.« Harry war weit über sechzig, einer der ersten schwarzen Richter am Supreme Court in der Geschichte New Yorks und ein Mann, der sich am Ende des Tages ein halbes Dutzend Gläser Bourbon genehmigte, bevor er sich aufs Ohr haute. Ich hörte den Whiskey in seiner Stimme.
»Zu spät. Ich hab meine schon bekommen. Ich war drauf und dran, dich anzurufen, wollte dich aber nicht wecken. Muss man sich Sorgen machen?«
»Es ist ein alter Fall, den ich vor fünfzehn Jahren hatte. Böse Geschichte. Julie Rosen wurde wegen Mordes verurteilt. Sie hat ihr Haus angezündet, mit ihrem schlafenden Baby drin.«
Da war etwas in seiner Stimme. Aber es war nicht der Alkohol. Reue, vielleicht Schuldgefühle.
Wenn man einem Anwalt einen Drink spendiert, erzählen einem die meisten alles von ihren größten Erfolgen. Heldentaten. Anwälte lieben Heldentaten: wie mal alles gegen sie stand, wie sie ihren Gegner ausgetrickst und doch gewonnen haben. Wenn man weiß, was ich weiß, würde man so einen Anwalt nicht mal seinem schlimmsten Feind wünschen. Wenn man einen wirklich guten Anwalt dazu bewegen kann, von seinem Beruf zu erzählen, wird er auf die Fälle eingehen, die er verloren hat.
Jeder verliert mal, früher oder später. Und die Fälle, die man verloren hat, vergisst man nicht so schnell. Warum wiegen Niederlagen schwerer als Erfolge? Warum werden selbst die besten Anwälte sie nicht los? Das ist leicht zu beantworten. Weil sie an ihnen nagen. Sie fühlen sich verantwortlich. Ich bevorzuge einen Anwalt, der ein Urteil wegen Ladendiebstahls nicht vergessen kann, weil es seinem Mandanten damals einen Monat in Sing Sing eingebracht hat – vor fünfundzwanzig Jahren. Das sind die Anwälte, die man auf seiner Seite haben möchte. Harry war so ein Anwalt gewesen. Und ich hatte das Glück gehabt, von ihm lernen zu können. Ohne Harry wäre ich nicht in dieser Branche. Er hat mich damals eingestellt und mir dann geholfen, mich selbstständig zu machen. Ohne ihn würde ich immer noch draußen auf der Straße rumtricksen und nicht im Gerichtssaal.
Ein paar von Harrys Fällen waren schiefgegangen. Das meiste hatte er mir erzählt. Ich konnte mich nicht erinnern, dass von so einem Fall irgendwann mal die Rede war.
»Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Mandanten. Hör zu, Harry. Ich will dich nicht beunruhigen, aber der Gerichtszusteller kam von Max Copeland.«
Er sagte nichts.
»Hast du den Fall bis zum Prozess begleitet?«, fragte ich.
»Allerdings. Julie hat mir gesagt, ein schwarz gekleideter Mann hätte ihr Haus angezündet. Sie meinte, sie hätte sein Gesicht nicht gesehen, oder vielleicht hatte er gar keins. Da war sie nicht ganz klar. Hatte eine schwere Kopfverletzung. Die Geschworenen haben ihr nicht geglaubt.«
»Irgendeine Spur von dem Kerl?«
»Nichts. Niemand hatte ihn gesehen. Meinst du, Max Copeland hat ihn gefunden?«
»Ich weiß nicht. Aber irgendwas hat er. Hör zu, ich muss los, aber ich ruf dich morgen früh an.«
»Ruf nachher noch mal durch. Ich bin wach und lese mich für morgen in einen Fall ein«, sagte er und legte auf. Anwälte und Richter haben einen sonderbaren Tagesrhythmus, aber dass Harry die ganze Nacht wach blieb, um sich in einen Fall einzulesen, hatte ich lange nicht erlebt. Wahrscheinlich hatte er längst alles gelesen oder brauchte es gar nicht am Morgen. Mir schien, Harry brauchte nur etwas, um sich von der gerichtlichen Anordnung abzulenken.
Ich wusste, dass er sich deswegen Sorgen machte. Copeland hatte die Angewohnheit, die früheren Anwälte seiner Mandanten anzugreifen. Etwaige neue Beweise oder neue Zeugen spielten für Copeland dabei keine große Rolle. Ziel seiner Attacken würde Harry sein. Er würde nachweisen wollen, dass das Urteil auf unsicheren Beweisen fußte, weil Julie Rosen einen unfähigen Anwalt gehabt hatte. Er plädierte immer auf fachliche Inkompetenz. Schon früher hatte er Karrieren zerstört, um Berufungen durchzubringen. Er würde sich Harry vorknöpfen.
Also würde ich mir Copeland vorknöpfen. Ich konnte nicht zulassen, dass Harry von einem Scheißkerl wie Max Copeland in einen Shitstorm getrieben wurde.
George hob freundlich eine Hand zum Gruß, als schließlich ein Wachmann aus dem Pförtnerhäuschen kam, im dunklen, kurzärmligen Hemd mit geknöpftem Kragen. Er trug eine Glock und eine Baseballkappe mit einem Firmenlogo – »Howell’s Security«.
Mir leuchtete eine Taschenlampe ins Gesicht, sodass ich nicht erkennen konnte, wie der Wachmann aussah.
Er wandte sich ab, stellte die Taschenlampe aus und winkte uns durch.
Eine zweispurige Straße zwischen hohen weißen Palisadenzäunen brachte uns nach Premier Point. Ich ließ das Fenster herunter, um das Salz vom East River zu riechen. Zehn Minuten später bogen wir nach rechts in eine einspurige Privatstraße ein. Steinerne Mauern ragten zu beiden Seiten der Einfahrt auf, und da war noch was. Erst dachte ich, es sei ein Schild, das auf den Namen des Anwesens hinwies. Ich hatte entlang der Privatstraße noch mehr solche Schilder gesehen – »The Manse«, »The Lodgehouse« und »September Rest«. Auf dem Schild draußen vor Howells Anwesen stand kein Name. Als wir näher herankamen, konnte ich die blaue Schrift auf dem Schild lesen – »Zu verkaufen«.
Während wir die Zufahrt entlangfuhren, fragte ich mich, was wohl zuerst brechen würde, die Aufhängung vom Lincoln oder mein Rückgrat. Die Straße war voller Schlaglöcher. Manche klein, manche riesengroß, und obwohl George sich alle Mühe gab, traf er doch jedes einzelne davon. Da das Anwesen ohnehin zum Verkauf stand, wollte sich Leonard Howell offenbar die Kosten sparen, die Straße vorher noch neu zu asphaltieren. Nach etwa einer Minute sah ich in der Ferne ein gewaltig großes Gebäude. In fast allen Fenstern brannte Licht. Es war zu groß, um noch als Haus durchzugehen, und nicht ganz groß genug, um in diesem Teil der Stadt als Palast zu gelten.
Etwa ein halbes Dutzend Vans und Pkws parkte in der Auffahrt. Die Pkws waren allesamt Fords. Alle von derselben Marke. Und dazu zwei Vans. Der eine war dem Emblem nach vom NYPD. Der andere – FBI.
George hielt direkt vor dem Haus. Ich sah jemanden in der offenen Tür stehen, kaum mehr als eine Silhouette. Den Beinen und Haaren nach zu urteilen, handelte es sich um eine Frau. Vor dem Haus war alles dunkel, nur der warme Lichtschein aus den Fenstern beleuchtete die Nacht.
Ich stieg aus, wandte mich dem Wagen zu und schloss die Tür.
Eine Stimme sagte: »Keine Bewegung. FBI. Hände aufs Autodach. Sofort!«
KAPITEL DREI
Die Stimme war weiblich. Jung. So wie die Hände, die meine Wange auf das polierte Dach des Lincoln pressten.
Ich hörte, wie George vergeblich versuchte, eine Erklärung hervorzustottern. Eine männliche Stimme wies ihn an, zurückzubleiben.
»Ganz ruhig, mein Name ist Eddie Flynn. Ich bin Anwalt. Leonard Howell hat mich angerufen …«
»Halt’s Maul«, sagte die männliche Stimme. Ich spürte Hände, die mich durchsuchten. Sie fanden den noch nicht unterschriebenen Mandantenvertrag, den Umschlag mit der gerichtlichen Anordnung, mein Handy und meine Brieftasche.
»Was für ein Anwalt kommt ohne Aktenkoffer?«, fragte die weibliche Stimme, als die dazugehörigen Hände meinen Schädel losließen.
Ich hob den Kopf, wandte mich aber nicht um.
»Ein Anwalt, der einen neuen Mandanten besucht und noch keine Akte angelegt hat.«
»Kopf runter. Hände aufs Dach«, kommandierte der Mann und presste seine Hände auf meine Schulterblätter, hielt mich fest.
Ich lehnte meinen Kopf aufs kühle Dach des Lincoln und hielt die Hände still. Das Letzte, was ich brauchen konnte, war, dass mir ein zappeliger Fed eine Kugel in den Bauch schoss. Wer auch immer da hinter mir stehen mochte, knipste eine Taschenlampe an. Das Licht leuchtete mir kurz ins Gesicht, dann hörte ich Papier rascheln.
»Diese Dokumente sind vertraulich«, sagte ich.
»Lass ihn los«, sagte die Frau. Die Hände, die mich hielten, ließen von mir ab. Zuerst sah ich George mit einem mitleidigen Ausdruck im Gesicht. Dann sah ich die Frau. Sie war kaum größer als eins fünfzig, brünett, kurze Haare, das grüne Hemd in eine Jeans gestopft. Die Schnürstiefel an ihren Füßen waren fast so groß wie sie selbst. Sie las den Vertrag. Das Licht der Taschenlampe leuchtete durchs Papier. Sie dämpfte den Lichtstrahl, indem sie sich die Lampe unter den Arm klemmte, dann faltete sie den Vertrag und reichte ihn mir. Ich schätzte sie auf Anfang dreißig, mit freundlichem, ovalem Gesicht, aber ihre Miene war alles andere als freundlich. Sie war stinksauer.
Der Typ neben ihr war so groß wie ich und trug Anzug und Krawatte. Er hatte kurze Haare, sauber ausrasiert. Auch ein Fed. Er reichte ihr den Umschlag zusammen mit meiner Brieftasche und sagte: »Die Personalien stimmen. Er scheint zu sein, was er behauptet.«
Sie ignorierte die Brieftasche und öffnete den Umschlag, nahm die Taschenlampe in die Hand, um die Vorladung zu lesen.
»Die Brieftasche können Sie checken, aber der Umschlag ist vertraulich.«
»Kann ja sein«, sagte sie, während sie die Vorladung las. Sie schüttelte den Kopf, nahm Brieftasche, Umschlag und Vorladung und schlug mir das Bündel vor die Brust.
»Sie sind nicht befugt, hier zu sein. George weiß, dass wir alle Besucher durchsuchen müssen. Die Wache am Tor hat uns keinen Besuchernamen genannt, also mussten wir Sie überprüfen. Hätten Sie was dagegen, mir zu erzählen, was Sie hier wollen?«, sagte sie. Zum ersten Mal fiel mir der Akzent auf. Mittlerer Westen und gebildet.
»Hätte ich«, sagte ich.
Sie legte ihre Hände an die Hüften und strich mit dem kleinen Finger über den Griff der Glock an ihrer Seite. Sie sah ihren Kollegen an. Mir schien, sie überlegte, ob sie mich verhaften oder es irgendwie anders versuchen sollte. Ihr Partner wandte sich mir zu und hob eine Hand.
»Am besten fangen wir noch mal von vorn an. Ich bin Special Agent Joe Washington«, sagte der Fed im Anzug, wobei er eine große Hand an seine Brust legte. Er wandte sich nach rechts, sah seine Kollegin an und sagte: »Das ist Special Agent Harper.«
Ich hielt ihr die Hand hin und sagte: »Haben Sie auch einen Vornamen, Agent Harper?«
»Leck mich«, erwiderte sie und behielt die Hände an den Hüften.
»Mit dem Namen waren Sie auf dem College bestimmt beliebt«, sagte ich.
Sie hob das Kinn, musterte mich von oben bis unten und konterte: »Wenigstens habe ich das College nicht als Jungfrau verlassen.«
Sie trat zurück und wandte sich dem Haus zu. Washington hatte Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. Ich konnte sie im Dunkeln nicht mehr sehen, hörte aber das wütende Stampfen ihrer Stiefel auf dem Kies. Ich sah zum Haus hinüber, wo noch immer die weibliche Silhouette in der Tür stand und einen langen Schatten über die Auffahrt warf.
»Tut mir leid, Mann. Wir stehen hier alle etwas unter Strom. Ihr Fahrer hätte Bescheid geben sollen, dass er Sie herbringt. Wir sind zu Mr Howells Schutz hier. Es ist nicht unsere Sache, uns in seine persönlichen Angelegenheiten einzumischen. Gehen Sie ruhig, und wenn nötig, können wir später reden.«
»Warum habe ich den Eindruck, dass Sie sich nicht zum ersten Mal für Ihre Partnerin entschuldigen müssen?«, fragte ich.
»Gehört zu meinem Job. Ich steh für sie ein. So läuft das.«
»Ist es das wert? Ist sie gut in ihrem Job?«, wollte ich wissen.
»Die Beste«, sagte er, als wäre es sein Ernst.
Sie waren vertraut miteinander. Es lag nah. Nach wie vor bestand das FBI überwiegend aus weißen Männern, sodass ein afroamerikanischer Agent und eine weibliche Agentin naturgemäß zusammenhielten. Der Club der alten weißen FBI-Recken behandelte sie vermutlich wie Außenseiter, und genau deshalb hatten sie zueinander gefunden. Ich war selbst ein Außenseiter. Es gab nicht allzu viele ehemalige Trickbetrüger aus Brooklyn mit einer Zulassung als Rechtsanwalt. Also beschwerte ich mich nicht, obwohl die beiden deutlich zu weit gegangen waren.
Ich war nicht zum ersten Mal gefilzt worden, und es würde wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Im Grunde war ich eher verwundert als ärgerlich. Wenn Caroline Howell vermisst wurde und man eine Entführung vermutete, bekäme die Familie normalerweise einmal in der Woche Besuch von einem Polizeipsychologen, und weil die Howells Millionäre waren, würde hin und wieder mal ein höhergestellter Beamter aus der Vermisstenabteilung vorbeischauen. Aber ganz bestimmt wäre das FBI nicht da. Das NYPD hätte hier keinen Van stehen. Sie wären nicht so verspannt, was die Security anging, und ganz sicher würden sich hier keine FBI-Agenten herumtreiben, gesichert von schwer bewaffneten Polizisten, die mit der Faust an der Waffe auf dem Rasen vor dem Haus herumstanden.
Irgendwas war hier los. Irgendwas Unerfreuliches.
KAPITEL VIER
Ich lief mit George zum Haus. Er hatte gemeint, ich müsste nicht auf ihn warten und sollte ruhig schon vorgehen, aber ich wollte verhindern, dass noch jemand aus dem Dunkel gesprungen kam und mir eine Waffe unter die Nase hielt. Ich dachte mir, mit George wäre ich sicherer. Außerdem mochte ich ihn.
Er holte einen faltbaren Gehstock aus seiner Schultertasche und klappte ihn mit Schwung auseinander, dann stützte er sich darauf ab, während wir uns im Dunkeln langsam die kiesbedeckte Auffahrt hinaufbewegten. Trotz Gehhilfe grub George mit seinem Fuß eine Furche in den losen Kies.
»Gibt es hier keine Außenbeleuchtung?«, fragte ich.
»Doch«, sagte George und deutete mit seinem Stock auf die Attrappe einer viktorianischen Straßenlaterne. Bei einem Blick in die Runde sah ich, dass davon mehrere dunkel und ungenutzt herumstanden. »Aber j…j…j…jemand hat die Leitungen gek…k…k…kappt.«
»Wer?«
Er zuckte mit den Schultern.
Die weibliche Gestalt, die in der Tür gestanden hatte, war verschwunden. An deren Stelle befand sich dort nun eine völlig andere Art von Silhouette. Sie verdeckte fast das ganze Licht aus der Eingangshalle. Ich musste direkt zweimal hinsehen, weil ich erst dachte, irgendwer hätte die Haustür zugemacht.
Es war ein Mann, an die zwei Meter groß. Wir ließen uns Zeit mit der Treppe, und je näher wir der Tür kamen, desto größer wirkte der Typ. Sein Schädel war fast quadratisch und saß auf etwas, das aussah, als hockte ein fremder Arsch auf seinen Schultern. Dann stellte ich fest, dass es sich um massiv überentwickelte Trapezmuskeln handelte. Auch die Schultern waren rund. Der Typ hatte viele harte Jahre Gewichte gestemmt, gefolgt vermutlich von reichlich Anabolika. Der gewaltige, fast lächerlich übergroße Oberkörper ging in eine schmale Taille und Beine über, die wie aufgepumpt aussahen. Ich nickte dem Mann zu. Er rührte sich nicht, und für einen Augenblick fragte ich mich, ob er echt war – oder so eine Figur, die Leute sich ins Fenster stellen, um Einbrecher abzuschrecken.
Aus der Nähe betrachtet, konnte ich ein kastenförmiges Kinn und eine lange, breite Nase ausmachen, aber der Mann hatte keine erkennbaren Augen. Nur schmale schwarze Schlitze über seinen dicken Backen.
»Mr Howell erwartet Sie«, sagte er mit einer Stimme, die für seine Größe viel zu hoch war. Ich hatte recht gehabt mit den Anabolika. Er trat beiseite und ließ mich ins Haus.
Ich nahm mir einen Moment Zeit, mich umzusehen. Eingangshalle aus weißem Marmor, geschwungene Treppe und rechts und links Türen. Und natürlich ein ausladender Kronleuchter direkt über uns. Alles war teuer, zeugte aber nicht gerade von Geschmack. Und außerdem war da irgendwas, das mich vom Haus und der Einrichtung ablenkte.
Spannung lag in der Luft.
Es war, als wäre das Haus selbst fest aufgezogen. Ich konnte förmlich hören, wie die Dielen über mir vor angespannter Atmosphäre knarrten. Ich musste daran denken, wie ich als Zehnjähriger mal mit meinem Vater bei einer irischen Totenwache in der Bronx gewesen war. Ich hatte schon früher an Trauerfeiern teilgenommen, und normalerweise waren es ziemlich laute Veranstaltungen, bei denen es Bier, Sandwiches, Whiskey und Selbstgebrannten gab, dazu wohlmeinende, oft genug urkomische Geschichten über den Verstorbenen. Eine irische Trauerfeier unterschied sich kaum von einer Party am Saint Patrick’s Day. Der einzige echte Unterschied bestand darin, dass jemand gestorben war, bevor die Party losging, nicht währenddessen.
Die Totenwache in der Bronx damals war anders gewesen. Es hatte keine lustigen Anekdoten gegeben, weil der Tote erst Anfang zwanzig gewesen war. Die Frauen und Männer hatten in ihre Bushmills’ geweint, und das ganze Haus wirkte düster und drückend. Genauso fühlte sich Howells Villa an. Man spürte den Luftdruck.
Der Berg machte kehrt und erwartete, dass ich ihm folgte.
»Gehen Sie ruhig, Mr Flynn. I…I…Ich mach mir erst mal eine schöne, heiße T…T…T…T…«
»Los jetzt. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit«, sagte der große Mann. Ich ignorierte ihn und blieb bei George stehen, wartete, bis er seinen Satz zu Ende brachte.
»… TASSE Tee. Bis später … später dann«, sagte er.
»Na, klar. Und danke für alles, George.«
Er verschwand durch eine Nische in der Wand. Der große Mann stand schon unter der Treppe und winkte mich heran.
Ich folgte ihm, als er scharf rechts abbog und durch eine große Eichentür trat. In der Lounge dahinter drängten sich Polizisten, manche in voller SWAT-Montur, andere mit Anzug und Krawatte. Die Anzugtypen musterten mich, als ich an ihnen vorbeiging. In der Ecke fielen mir zwei FBI-Agenten in Hemdsärmeln mit schusssicheren Westen auf. Man nutzte die Lounge als Kommandozentrale. Sie saßen vor offenen Laptops oder starrten die Landkarte auf dem 50-Zoll-Bildschirm an der Wand an. Überall standen Kaffeebecher und Fast-Food-Verpackungen herum. Gedämpfte Gespräche und das Tippen von Fingern auf Tasten, gelegentlich unterbrochen von metallischem Klicken, wenn ein SWAT-Officer sein AR-15-Sturmgewehr lud.
Sie machten sich bereit. Irgendwas ging hier vor sich, wenn ich auch keine Ahnung hatte, was.
Der Lärmpegel ließ nach, als ich Bigfoot durch die Lounge in den dahinterliegenden Flur folgte. Kurz bevor ich den Raum verließ, sah ich noch, wie Harper eine Kollegin anstieß und zu mir herübersah. Ich ignorierte die beiden und wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem großen Kerl zu.
Am Ende des Flurs führte er mich durch eine Eichentür. Wir kamen in ein geräumiges Arbeitszimmer. Die Jalousien waren geschlossen. Zwei Lampen beleuchteten den Raum, wenn auch nicht allzu hell. Zu meiner Linken stand ein braunes Ledersofa mit entsprechenden Sesseln. Ein kleiner, dunkelhäutiger Mann im nachtblauen Anzug hatte sich auf dem Sessel niedergelassen, der dem Fenster am nächsten war. Er nahm mich gar nicht wahr.
Zu meiner Rechten saß Leonard Howell hinter seinem Mahagoni-Schreibtisch, den Kopf geneigt, die Hände im Nacken gefaltet. Er holte tief Luft, nahm die Hände aus dem Nacken und richtete sich auf. Vor ihm auf dem Tisch lag eine Beretta samt Magazin. Hinter ihm nahm ich dieselbe Gestalt wahr, deren Silhouette ich bei meiner Ankunft in der Haustür gesehen hatte. Sie war attraktiv. Sie hatte die Haltung und roch nach dem teuren Parfum, das dazugehört, wenn man mit jemandem wie Howell verheiratet ist. Irgendwo hatte ich gelesen, dass ihr erster Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war und sie sich mit Howell zusammengetan hatte, nachdem dessen erste Frau nicht mehr am Leben war. Seltsam, wie der Tod zwei Menschen zueinanderführen kann.
Die aschblonden Haare fielen lose über ihre Schultern, als sie sich herabbeugte und Howell auf die Wange küsste. Ihr Kuss hatte nichts Zärtliches. Er wirkte eher oberflächlich.
»Bist du dir ganz sicher?«, fragte sie.
»Ich sehe keine andere Möglichkeit«, sagte Howell.
Sie nickte und machte sich auf den Weg zur Tür. Als sie an mir vorüberging, blieb ihr Blick kurz an mir hängen. Ich roch Alkohol. Der große Kerl schloss die Tür hinter ihr, kam zurück und klopfte mit seinen großen Händen unter meinen Armen herum.
»Arme hoch. Ich muss Sie durchsuchen«, sagte er.
Ich hob die Arme und wartete, während er mich abklopfte.
»Das FBI hat mich schon gefilzt. Ihr habt hier genug bewaffnete Polizei, um in ein kleines Land einzumarschieren. Was ist los?«, fragte ich.
Keiner reagierte.
Ich merkte, dass mir der große Mann mein Handy und meine Brieftasche abnahm. Beides legte er vor Howell auf den Schreibtisch.
»Sorg dafür, dass es aus ist«, sagte Howell.
Einen Moment lang hatten die dicken Daumen Probleme, den Knopf zu finden. Irgendwann grinste er zufrieden, und ich sah den Bildschirm schwarz werden. Howell vergewisserte sich, dass das Handy aus war.
»Danke, dass du gekommen bist, Eddie. Ich fürchte, ich muss dich gleich zweimal um Entschuldigung bitten. Erstens muss ich auf Sicherheit und Verschwiegenheit bestehen – also nimm es Marlon nicht übel. Zweitens werde ich alle deine Fragen so bald wie möglich beantworten, nur muss ich dir leider sagen, dass es eine sehr lange Nacht werden wird.«
KAPITEL FÜNF
Howell sah um einiges schlechter aus als bei der Pressekonferenz im Fernsehen. Seine Haut hatte einen gräulichen Ton, mit dunklen Schatten um die Augen. Die Augen selbst wirkten wund und müde, von Kummer gezeichnet. Für einen Mann von Ende fünfzig war er bemerkenswert schlank, und doch zeichnete sich unter dem weißen Seidenhemd ein noch jüngerer und sportlicherer Körper ab. Breite Schultern, breite Brust, muskulöse Arme. Schwarze Haare, vermutlich mithilfe einer zweihundert Dollar teuren Färbung.
Seine Hände zitterten ein bisschen, was ich auf körperliche und nervliche Erschöpfung zurückführte.
»Der junge Mann, der dich hergeführt hat, heißt Marlon Black. Er ist für die Security hier im Haus verantwortlich«, sagte Howell.
Ich wandte mich in die Richtung, in die er deutete, und starrte Marlons Brust an.
»Er ist nicht so geübt, was förmliche Vorstellungen angeht«, sagte Howell.
Ich reichte ihm die Hand. Marlon nickte sie an.
»Und hinter dir sitzt Mr McAuley. Er ist mein Geschäftspartner.«
Ich hielt McAuley gar nicht erst die Hand hin. Der dunkelhäutige Mann im nachtblauen Anzug steckte sich eine Zigarette an und lächelte nur zu mir auf.
»Nimm Platz«, sagte Howell.
Der Stuhl gegenüber von Howell sah aus wie eine Antiquität. Vorsichtig setzte ich mich darauf.
Mit den Ellenbogen auf dem Tisch und den Händen unterm Kinn betrachtete er mich eingehend. Die Waffe auf dem Tisch war nur Show. Offensichtlich wollte Leonard mir zeigen, dass er hier das Sagen hatte.
»Wie war deine Fahrt? George ist kein sonderlich hervorragender Fahrer und auch nicht besonders unterhaltsam. Aber er hat ein gutes Herz, und ich vertraue ihm. Das findet man bei Angestellten nur selten«, sagte er.
»Die Fahrt war okay. Ich mag George. Er scheint wirklich ein guter Mensch zu sein.«
»Gute Menschen sind rar gesät. Wenn man jemanden wie George findet, hält man an ihm fest und behandelt ihn gut. Das habe ich von deinem Vater gelernt. Es tat mir leid, zu hören, dass er verstorben ist.«
Ich nickte.
»Jeder im Viertel kannte Pat Flynn. Ein begnadeter Taschendieb und mit seinen Wetten immer ehrlich. Hat seine Leute geführt wie ein Pro. War man drin, war man ein gemachter Mann, aber sobald Pat Grund hatte, an dir zu zweifeln, warst du raus. Vertrauen war ihm wichtig. Davor habe ich Respekt. Dein Vater war gut zu mir, als ich ein kleiner Junge war. Er wäre bestimmt sehr stolz auf den Mann, der du geworden bist.«