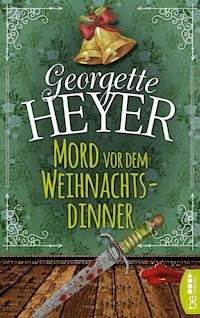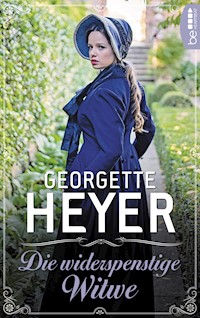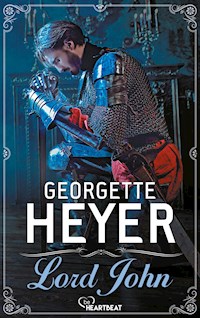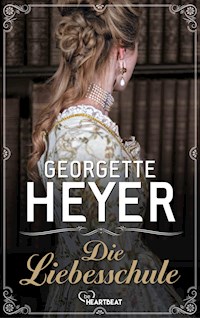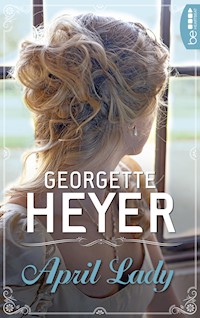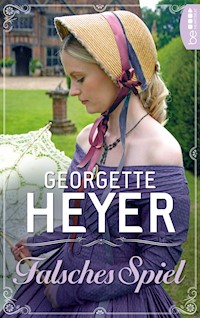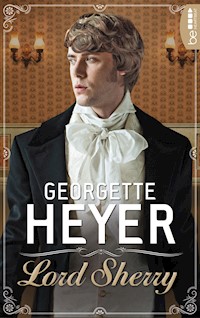
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der junge Viscount Sheringham, der von seinen Freunden liebevoll spöttisch nur "Sherry" genannt wird, ist bis über beide Ohren verschuldet. Sein Erbe kann er aber nur früher antreten, wenn er heiratet. Daher macht er kurzerhand der hübschen, aber mittellosen, Hero Wantage einen Heiratsantrag.
Doch bald schon ziehen dunkle Wolken am Ehehimmel auf: Die naive Hero kennt sich mit den Gepflogenheiten der Londoner High Society nicht aus und tappt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Obwohl sich in Lord Sherry ein zaghaftes Verantwortungsgefühl für seine Frau regt, ist es mit seinem Einfühlungsvermögen nicht sonderlich weit her. Und nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung ist Hero plötzlich spurlos verschwunden ...
"Lord Sherry" (im Original: Friday’s Child") ist einer der unterhaltsamsten und amüsantesten Regency Romane von Georgette Heyer. Der charmante Schurke Lord Sherry und sein liebenswertes "Kätzchen" sichern sich einen festen Platz im Herzen der Leser.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert
»Georgette Heyer verfügt über einen lächelnden, mitunter sogar boshaften Spott, aber man merkt doch, wie sie liebenswürdig zu dem Kopfkissenseufzer verführen möchte: ach, waren das noch Zeiten.« Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Über dieses Buch
Der junge Viscount Sheringham, der von seinen Freunden liebevoll spöttisch nur »Sherry« genannt wird, ist bis über beide Ohren verschuldet. Er kann sein Erbe nur früher antreten, wenn er heiratet. Daher macht er kurzerhand der hübschen, aber mittellosen, Hero Wantage einen Heiratsantrag.
Doch bald schon ziehen dunkle Wolken am Ehehimmel auf, denn die naive Hero kennt sich mit den Gepflogenheiten der Londoner High Society nicht aus und tappt von einem Fettnäpfchen ins nächste. Obwohl sich in Lord Sherry ein zaghaftes Verantwortungsgefühl für seine Frau regt, ist es mit seinem Einfühlungsvermögen nicht sonderlich weit her und nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung ist Hero plötzlich spurlos verschwunden …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Lord Sherry
Aus dem Englischen von Pia von Hartungen
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1944
Die Originalausgabe FRIDAY‘S CHILD erschien 1944 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© 1956, Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Illustration: © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4888-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
»Oh, schweigt, Mylord, ich bitte Euch«, sagte Miss Milborne in beschwörendem Ton, wobei sie ihr liebliches Antlitz etwas zur Seite neigte und beide Hände über dem Busen kreuzte.
Ihr Besuch, ein hochgewachsener junger Gentleman, der sich romantischerweise vor ihrem Stuhl auf ein Knie niedergelassen hatte, schien durch ihre gestammelte Bitte völlig aus der Fassung zu geraten.
»Verdammt, Isabella – ich meine, verwünscht –«, verbesserte er sich ein wenig ungeduldig, als die junge Dame ihre braunen Augen vorwurfsvoll auf ihn richtete; dann wendete er ein: »– ich habe doch noch gar nicht begonnen!«
»Ach, bitte, tut es nicht.«
»Ich habe aber die Absicht, um deine Hand anzuhalten«, sagte der Viscount mit weit mehr als bloß einem Anflug von Strenge.
»Ich ahnte es«, erwiderte die junge Dame. »Doch es ist völlig aussichtslos. Oh, schweigt, Mylord, ich bitte Euch.«
Der Viscount erhob sich aufs äußerste gekränkt von seinem Knie. »Ich muss sagen, Isabella, du hättest mich wenigstens zu Wort kommen lassen sollen!«, rief er ärgerlich.
»Mylord, den Kummer wollt ich Euch ersparen.«
»Ich wäre dir dankbar, wenn du endlich aufhören würdest, in dieser verdammt theatralischen Weise mit mir zu sprechen«, sagte der Viscount, »und hör endlich auf, zu mir ‹Mylord› zu sagen, als hättest du mich nicht dein ganzes Leben lang gekannt.«
Miss Milborne errötete und wurde womöglich noch etwas förmlicher. Da ihre Besitzungen aneinandergrenzten, war es vollkommen richtig, dass sie den Viscount zeitlebens gekannt hatte. Durch ihre blendende Karriere als anerkannte Beauté, der die Hälfte aller heiratsfähigen jungen Männer Londons zu Füßen lag, war sie aber an ein bei weitem ehrerbietigeres Benehmen gewöhnt als jenes, das der Spielgefährte ihrer Kindheit an den Tag legte. Etwas erzürnt, sah sie kühl aus dem Fenster, während ihr Freier einige Male hastig durch das Zimmer schritt.
Die Aussicht auf saubere Rasenflächen, reich besetzte Blumenbeete und gestutzte Hecken war wohl lieblich, aber Miss Milborne hielt sich durchaus nicht aus Liebe zu der herrlichen waldreichen Umgebung auf dem Lande auf.
Sie hatte sich vor einigen Wochen aus der Hauptstadt zurückziehen müssen, weil sie sich an einer abscheulichen Kinderkrankheit angesteckt hatte, die sie zwang, in einem Moment den Augen der vornehmen Welt zu entschwinden, in dem es ihr von niemandem übel genommen worden wäre, hätte sie sich, wenn schon nicht als ihren Mittelpunkt, so doch als ihren Hauptanziehungspunkt betrachtet. Ihre Mama war, was die Lächerlichkeit ihrer Erkrankung anbelangte, ebenso vernünftig wie sie selbst und hatte das Gerücht verbreitet, dass Isabella durch die Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens völlig erschöpft sei. Sie hatte sie in einer vierspännigen Kutsche eiligst nach Kent gebracht, wo sie sich in angemessener Weise in einem bequemen Herrenhaus vor den Verfolgungen der jeunesse dorée verbergen konnte und in völliger Abgeschiedenheit nicht nur Gelegenheit fand, Gesundheit und Schönheit wiederzuerlangen, sondern ihre Krankheit auch auf zwei Kammerzofen und einen kleinen Pagen zu übertragen. Sie hatte das Krankenzimmer bereits vor einigen Wochen verlassen, da sie aber noch immer etwas blass war und noch nicht im vollen Besitz ihrer Schönheit, hatte sich Mrs. Milborne, eine Dame, die sich durch ihren bewunderungswürdig scharfen Verstand auszeichnete, entschlossen, sie auf dem Land zu lassen, bis die Rosen – wie sie sich ausdrückte – wieder auf ihren Wangen erblühten.
Eine Schar glühender Bewunderer stellte sich in Milborne House ein, die in der Hoffnung, dass man ihnen gestatten würde, einen Schimmer der Unvergleichlichen zu erhaschen, den weiten Weg von London hergefahren kamen. Die Tür blieb ihnen jedoch verschlossen, und sie waren genötigt, ihre Blumensträuße und leidenschaftlichen Billetts in den Händen eines keineswegs empfindsamen Butlers zu lassen und ihre mannigfaltigen Wagen wieder stadtwärts zu lenken, ohne wenigstens der Erquickung teilhaftig geworden zu sein, ihre Lippen auf die lilienweißen Hände der Beauté drücken zu dürfen.
Lord Sheringham wäre zweifellos derselbe Empfang zuteil geworden, wäre er nicht, in höchst unschöner Weise auf seine lange Bekanntschaft mit der Familie pochend, von Sheringham Place, wo er die Nacht verbrachte, herübergeritten, um, nachdem er sein Pferd in den Stallungen eingestellt hatte, den Garten zu durchschreiten und das Haus durch eine der hohen Fenstertüren zu betreten, die auf den Rasenplatz führten. Als er auf einen ziemlich überraschten Lakaien stieß, warf Seine Lordschaft, der tat, als wäre er hier zu Hause, Reitpeitsche und Handschuhe auf einen Tisch, legte seinen breitrandigen Filzhut daneben und verlangte den Herrn des Hauses zu sprechen.
Mr. Milborne, keineswegs mit jener weltlichen Weisheit gesegnet, die seine Gemahlin auszeichnete, hatte kaum den Zweck dieses Besuches erfasst, als er etwas vage und nicht sehr hoffnungsfreudig vorschlug, Seine Lordschaft täte besser daran, mit Isabella persönlich zu spreche. »Denn ich weiß es wahrhaftig nicht, Anthony«, hatte er gesagt, wobei er den Viscount bedenklich ansah. »Man kann nie sagen, was in ihren Köpfen vorgeht, nein, ganz bestimmt nicht.«
Worauf Seine Lordschaft, der richtig erriet, dass sich diese rätselhafte Äußerung auf Mr. Milbornes Frau und Tochter bezog, fragte: »Und Sie selbst, Sir, haben jedenfalls nichts dagegen, nicht wahr?«
»Nein«, erwiderte Mr. Milborne. »Das heißt – ach nein –, ich glaube, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Sie sprechen aber am besten mit Isabella selbst.«
Also wurde der Viscount vor das Antlitz der Schönen geführt, bevor diese auch nur Zeit gehabt hätte, sich durch herabgelassene Vorhänge vor dem zu verräterischen Tageslicht zu schützen. Hierauf hatte er sich, ohne die geringste Einleitung, in den ersten Heiratsantrag seines Lebens gestürzt.
Miss Milborne befand sich in der unangenehmen Lage, selbst nicht zu wissen, was sie wollte. Der Viscount hatte im vergangenen Jahr zu ihren anerkannten Bewerbern gezählt, und auch die Tatsache, dass sie ihn fast von der Wiege an kannte, machte sie seinem Charme gegenüber nicht unempfänglich. Er war ein eleganter junger Mann, von dem man sich genügend tolle Streiche erzählte, um die weibliche Phantasie anzuregen, und wenn er auch keine so brillante Partie war wie der Herzog von Severn, der ihr in letzter Zeit durch allerlei schmeichelhafte Anzeichen zu verstehen gegeben hatte, dass er nahe daran sei, sich ihr zu erklären, so war er zumindest von weit einnehmenderem Äußeren als Seine Gnaden, denn dieser war bedauerlicherweise ein phlegmatischer junger Mensch, der zur Fettleibigkeit neigte. Andererseits brachte ihr der Viscount nicht die hingebende Liebe entgegen wie sein Freund Lord Wrotham, der seiner Bereitwilligkeit verschiedene Male Ausdruck verliehen hatte, sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen, falls ihr ein derartiger Gewaltakt Vergnügen bereiten sollte. In der Tat war Miss Milborne mehr als einmal der Verdacht aufgestiegen, dass sich der Viscount der Schar ihrer Bewunderer nur aus dem wenig schmeichelhaften Grunde angeschlossen habe, dass er nicht zu jenen gehörte, die sich von einer Mode ausschlossen. Seine angebliche Verehrung war nie so weit gegangen, ihn dazu zu veranlassen, seine ewige Jagd auf Balletttänzerinnen und käufliche Mädchen aufzugeben oder jene Charakterfehler zu verbessern, über die sich Miss Milborne mehr als einmal beklagt hatte. Sie war über ihn etwas aufgebracht. Hätte er nur einige sichtbare Zeichen seiner Ergebenheit an den Tag gelegt, wie etwa, seinen skandalösen Lebenswandel zu ändern, abzumagern wie der arme Wrotham, bei einer Zurechtweisung zu erbleichen oder durch ein Lächeln von ihr in Verzückung zu geraten, dann, dachte sie, wäre sie sehr geneigt gewesen, seine Werbung anzunehmen. Aber anstatt sich auf die Art zu betragen, die sie als ihr gutes Recht zu betrachten gelernt hatte, setzte der Viscount – obwohl er ihr gewiss eine Menge Huldigungen darbrachte – seinen beklagenswerten Lebenswandel fort und verschaffte sich nach wie vor seine Vergnügungen durch die unterschiedlichsten Belustigungen, die er anscheinend im Hinblick darauf wählte, seiner Familie ein Maximum an Angst und Sorgen zu bereiten.
Unter dem Schutz ihrer langen Wimpern warf ihm Isabella einen verstohlenen Blick zu. Nein, er sah nicht so blendend aus wie der arme Wrotham, dessen dunkle leidenschaftliche Schönheit ihre Träume nicht wenig beunruhigte. Denn Wrotham war eine romantische Gestalt, besonders wenn seine schwarzen Locken in Unordnung gerieten, was oft geschah, weil er in seiner Verzweiflung stets darin wühlte. Auch die blonden Locken des Viscount schienen sich in Unordnung zu befinden, dabei konnte man aber durchaus nichts Romantisches finden, weil diese Unordnung das Ergebnis raffiniertester Friseurkunst war und Miss Milborne den schweren Verdacht hegte, dass seine Leidenschaft für sie nie so ungestüme Formen annehmen könnte, ihn zu veranlassen, in dieses inspirierte Kunstwerk seines Kammerdieners störend einzugreifen. Er war größer als Wrotham, ziemlich schlaksig und neigte dazu, in seinem Äußeren eher etwas achtlos zu sein. Diese Kritik wäre, wie Miss Milborne anzuerkennen gezwungen war, bei dieser Gelegenheit allerdings nicht berechtigt gewesen. Er hatte sich unverkennbar mit großer Sorgfalt gekleidet. Nichts hätte zierlicher sein können als das Halstuch, das er trug, und nichts sorgfältiger gestärkt als die hohen Spitzen seines Hemdkragens. Sein langschößiger Rock aus blauem Tuch, den kein Geringerer als der große Stulz selbst angefertigt hatte, saß faltenlos auf seinen Schultern; die Reithosen waren, der Mode entsprechend, blassgelb und die Stulpenstiefel auf Hochglanz poliert. Während er jetzt im Zimmer auf und ab schritt, wurde sein Gesicht durch einen ziemlich finsteren Blick entstellt; doch seine Gesichtszüge waren gut geschnitten, und wenn ihm auch der romantische Ausdruck Wrothams fehlte, konnte man doch nicht leugnen, dass er, wenn er wollte, auf eine Art lächeln konnte, die seinem eigensinnigen Mund ungemein viel Charme verlieh. Er besaß irreführenderweise die blauen Augen eines Engels, die einen seltsamen Kontrast zu dem undefinierbar flotten Anstrich bildeten, der seiner Person anhaftete. Während ihn Miss Milborne betrachtete, begegneten sich zufällig ihre Blicke. Einen Moment lang starrten sie einander kriegerisch an, dann aber gewann die Gutmütigkeit Seiner Lordschaft die Oberhand, und er sagte grinsend: »Ach was, hol’s der Teufel, Bella, du weißt doch, dass ich bis über die Ohren in dich verliebt bin.«
»Nein, das weiß ich nicht«, sagte Miss Milborne mit unvermuteter Ehrlichkeit.
Der Viscount zog ein langes Gesicht. »Aber, mein liebes Mädel! Nein, wirklich, Bella! Bin dein ergebenster Sklave. Ehrenwort eines Gentleman, das bin ich wahrhaftig! Du lieber Gott, bin ich dir denn nicht, seit ich dich kenne, nachgelaufen?«
»Nein«, sagte Miss Milborne.
Der Viscount sah sie flüchtig an.
»Als du mich kennen lerntest«, sagte Miss Milborne keineswegs boshaft, sondern lediglich wie jemand, der die Wahrheit feststellt, »sagtest du, dass alle Mädchen lästige Quälgeister sind. Und du nanntest mich Füchslein, weil du behauptetest, ich hätte fuchsrote Haare.«
»Tatsächlich?«, sagte Seine Lordschaft, und der Mund blieb ihm vor Entsetzen über diese Ketzerei offen.
»Ja, das hast du getan, Sherry; und überdies hast du mich in den Gärtnerschuppen eingesperrt, und wäre nicht Cassy Bagshot gewesen, hätte ich den ganzen Tag dort bleiben müssen.«
»Nein, nein«, protestierte Seine Lordschaft schwach. »Doch nicht den ganzen Tag.«
»Jawohl, den ganzen Tag, denn du weißt ganz genau, dass du mit der Vogelflinte deines Vaters Taubenschießen gegangen bist und keinen Gedanken mehr an mich verschwendet hast!«
»Du lieber Himmel, das hatte ich total vergessen«, rief Sherry aus. »Habe dem alten Grimsby auch noch den Hut vom Kopf geschossen. Der war aber toll vor Wut! Hatte ein höllisch unangenehmes Temperament, dieser Grimsby! Ging schnurstracks zu meinem Vater und erzählte es ihm. Wenn ich an die Prügel denke, die mir mein alter Herr verabfolgte ... Ja, übrigens, da du mich darauf gebracht hast, Bella, wie, zum Kuckuck, hätte ich da noch an dich denken können, wenn mich mein Vater beim Ohr kriegte und mir so verdammt weh getan hat, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte? Sei vernünftig, mein liebes Mädel, bitte, sei doch vernünftig.«
»Das hat auch nicht so viel zu bedeuten«, erwiderte Miss Milborne. »Aber wenn du sagst, du wärest mir nachgelaufen, seit du mich zum ersten Mal sahst, so ist das die größte Unwahrheit, die ich je gehört habe.«
»Jedenfalls habe ich dich lieber als alle andern Mädchen, die ich kenne«, sagte der Viscount verzweifelt.
Miss Milborne sah ihn an, während ihre Gedanken offensichtlich in der Vergangenheit weilten, eine Tatsache, die Sherry besonders auf die Nerven fiel. »Nein, das glaube ich nicht«, sagte sie schließlich. »Wenn du überhaupt jemanden bevorzugt hast, dann war es Hero Wantage.«
»Hero?«, rief der Viscount aus. »Nein, zum Kuckuck, Bella, ich habe mein ganzes Leben nie an Hero gedacht. Ich schwöre es!«
»Nein, das weiß ich«, sagte Miss Milborne ungeduldig, »aber als wir noch Kinder waren, hattest du sie lieber als mich, Cassy, Eudora oder Sophy, weil sie dir alle Arbeiten abnahm und dir vorheuchelte, es mache ihr gar nichts aus, wenn du ihr mit deinen abscheulichen Kricketbällen weh tatest. Sie war eben noch ein Baby, sonst hätte sie schon gemerkt, was für ein ekelhafter Junge du warst. Denn das warst du, Sherry, das weißt auch du ganz genau.«
Erregt erklärte der Viscount mit dem Brustton der Überzeugung: »Ich kann es beschwören, dass ich nicht halb so ekelhaft war wie die Bagshot-Mädchen. Himmel, Bella, erinnerst du dich noch, wie die kleine falsche Katze Sophy zu ihrer Mutter lief und uns alle vertratscht hat?«
»Mich nicht«, sagte Miss Milborne kühl. »Denn über mich gab’s nichts zu tratschen.« Da sie aber bemerkte, dass ihre Laune, sich in der Vergangenheit zu ergehen, den Viscount angesteckt hatte, und da ein merkwürdiger Glanz in seinen Augen sie warnte, es könnten für sie äußerst unerwünschte Erinnerungen in seinem Gedächtnis auftauchen, beeilte sie sich, ihn in die Gegenwart zurückzurufen. »Natürlich weiß ich, dass das nichts zu bedeuten hat. Der wahre Grund ist, dass wir nicht zueinander passen würden, Sherry, ich bin tief ergriffen über die Ehre, die du mir erwiesen hast, aber ...«
»Lass diesen Blödsinn!«, unterbrach sie ihr Freier. »Ich kann beim besten Willen nicht einsehen, warum wir nicht außerordentlich gut miteinander auskommen sollten. Hier hast du mich, Bella, wie verrückt in dich verliebt – und ich gebe dir mein Wort, dass ich mich deinethalben zu Tode gräme! Nein, mein liebes Kind, ich scherze durchaus nicht! Stulz hat es festgestellt, als er mir für diesen Rock Maß nahm.«
»Ich glaube, Mylord«, sagte Miss Milborne steif, »wenn Sie abgemagert sind, dann ist das Leben, das Sie führen, weit eher dafür verantwortlich. Ich schmeichle mir durchaus nicht, die Ursache zu sein.«
»Also, da hört sich wirklich alles auf!«, rief Seine Lordschaft ungehalten. »Ich wüsste gerne, wer mich so vertratscht hat!«
»Niemand hat dich vertratscht. Ich spreche nicht gern darüber, aber du wirst zugeben müssen, dass deine Eskapaden kein Geheimnis sind. Und ich muss sagen, Sherry, ich glaube, wenn du mich wirklich so liebtest, wie du behauptest, dann würdest du dir doch ein bisschen Mühe geben, mir etwas zu Gefallen zu tun!«
»Mühe geben, dir etwas zu Gefallen zu tun! Bemühen – nein, bei Gott, Bella, das ist zu viel! Wenn ich bedenke, wie ich dir im Almack den Hof gemacht habe und Abend für Abend meine Zeit damit vergeudet habe –«
»Um mich frühzeitig zu verlassen und in eine der abscheulichen Spielhöllen zu gehen«, warf Miss Milborne ein.
Der Viscount hatte so viel Anstand zu erröten, er sah sie aber mit funkelnden Augen an und sagte grimmig: »Bitte, Miss, wollen Sie mir vielleicht sagen, was Sie von Spielhöllen wissen?«
»Ich bin so glücklich, sagen zu können, dass ich gar nichts über sie weiß, außer, dass Sie sich ständig in einer von ihnen aufhalten, was alle Welt weiß. Und das kränkt mich ungemein.«
»Ach, was du nicht sagst!«, brachte Seine Lordschaft hervor, alles eher denn erfreut über diesen Beweis der Besorgnis seiner Angebeteten.
»Ja«, sagte Miss Milborne, und die beglückende Vision eines Viscount erschien vor ihrem geistigen Auge, der sich, durch seine Liebe zu einer edlen Frau bekehrt, vom Pfade des Lasters abwandte. Sie erhob ihre schönen Augen zu seinem Antlitz und sagte: »Vielleicht sollte ich nicht darüber sprechen, aber – aber du hast eine Charakterschwäche gezeigt, Sherry, einen – einen Mangel an Prinzipien, die es mir unmöglich machen, deinen Antrag anzunehmen. Ich will dir nicht wehtun, aber die Gesellschaft, in der du dich bewegst, deine Verschwendungssucht, deine wilden hemmungslosen Exzesse müssen jedes zartfühlende Mädchen daran hindern, dir ihre Hand zu reichen.«
»Aber, Bella!«, protestierte Seine Lordschaft entsetzt. »Du lieber Gott, mein liebes Mädel, das wäre doch alles eine Sache der Vergangenheit! Ich würde dir ein ausgezeichneter Gatte sein. Ich schwöre es! Ich habe nie eine andere Frau angesehen –«
»Nie eine andere Frau angesehen? Sherry, wie kannst du? Mit meinen eigenen Augen sah ich dich im Vauxhall mit dem vulgärsten, verabscheuungswürdigsten –«
»Ich meine natürlich, was eine Ehe betrifft!«, sagte der Viscount hastig. »Das war doch nichts – das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Hättest du mich nicht dazu getrieben, mich zu zerstreuen –«
»Blödsinn!«, sagte Miss Milborne gereizt.
»Aber ich erkläre dir, dass ich dich wahnsinnig liebe – hingebungsvoll! Wenn du mich nicht heiratest, ist mein ganzes Leben zerstört!«
»Keine Sorge. Du wirst auch weiter hirnrissige Wetten abschließen, dich an Rennen beteiligen und hasardieren und –«
»Also, da bist du aber auf dem Holzweg«, unterbrach sie Sherry. »Das könnte ich gar nicht, weil ich total pleite bin, wenn ich nicht heirate.«
Dieses wenig empfindsame Geständnis bewirkte, dass Miss Milborne auf beunruhigende Weise wie erstarrt dasaß. »Was Sie nicht sagen!«, rief sie dann aus. »Soll ich das so verstehen, Mylord, dass Sie nur deshalb um meine Hand anhielten, um sich Ihrer Schulden zu entledigen?«
»Nein, nein, das natürlich nicht. Wäre das der einzige Grund gewesen, dann hätte ich in den vergangenen drei Jahren um eine Menge Mädchen anhalten können«, erwiderte Seine Lordschaft mit schöner Offenheit. »Tatsache ist, Bella, dass ich bis jetzt außerstande war, dazu den Mut aufzubringen, obwohl ich es, weiß Gott, versuchte! Habe außer dir nie ein Mädchen kennen gelernt, an das ich mich fürs Leben hätte binden können – das kann ich beschwören! Frag Gil! Frag Ferdy! Frag George! Frag, wen du willst! Alle werden dir sagen, dass es wahr ist.«
»Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, sie zu fragen. Vermutlich hättest du auch nie daran gedacht, um mich anzuhalten, wenn dir dein Vater sein Vermögen nicht in dieser albernen Form hinterlassen hätte!«
»Nein, wahrscheinlich nicht«, stimmte der Viscount zu. »Das heißt, doch, ich hätte es getan! Natürlich hätte ich es getan! Aber bedenk doch nur, mein liebes Kind! Mein ganzes Vermögen würde bis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr verwaltet, außer wenn ich vorher heirate! Du musst verstehen, in welch höllisch übler Lage ich mich befinde!«
»Gewiss«, sagte Miss Milborne eisig. »Ich kann nur nicht verstehen, warum du nicht auf der Stelle um eines der vielen Mädchen anhältst, die zweifellos glücklich wären, dich heiraten zu können.«
»Aber ich will niemanden heiraten als dich!«, erklärte ihr gepeinigter Freier. »Könnte nicht einmal daran denken. Zum Kuckuck, Isabella, ich wiederhole doch immer wieder, dass ich dich liebe!«
»Nun, und ich erwidere Ihre Liebe keineswegs, Mylord«, sagte Miss Milborne äußerst verärgert. »Vielleicht machen Sie statt dessen Cassy einen Antrag, denn ich bin überzeugt, Mrs. Bagshot hat sie Ihnen in den verflossenen sechs Monaten immer wieder an den Hals geworfen. Sollten Sie aber so wählerisch sein und Einwände gegen Cassys Teint erheben, von dem ich allerdings zugeben muss, dass er arg sommersprossig ist, so zweifle ich nicht, dass Eudora die Ehre zu schätzen wüsste, wenn Sie Ihr Taschentuch in ihre Richtung werfen würden. Was aber mich betrifft, Mylord, so ist mir der Gedanke, Sie zu heiraten – obwohl ich Ihnen bestimmt alles Gute wünsche –, nie in den Sinn gekommen, und ich muss Ihnen nochmals sagen, und zwar zum letzten Mal, dass ich Ihren ehrenvollen Antrag nicht annehmen kann.«
»Isabella«, sagte Lord Sheringham in prophetischem Ton, »treib es nicht zu arg mit mir! Wenn du einen anderen liebst – höre, Bella, wenn du dir Severn in den Kopf gesetzt hast, so kann ich dir heute schon sagen, dass du ihn nie bekommen wirst. Du kennst die Herzogin nicht! Der arme Severn kann nicht einmal behaupten, dass ihm seine Seele gehört, und sie würde nie zugeben, dass er dich heiratet, darauf kannst du dich verlassen.«
Miss Milborne stand jäh von ihrem Stuhle auf. »Ich finde, dass du das widerwärtigste und abscheulichste Geschöpf der Welt bist!«, sagte sie ärgerlich. »Nein, so etwas – ich wollte wirklich, du gingest endlich!«
»Schickst du mich weg, dann gehe ich schnurstracks zum Teufel!«, drohte Seine Lordschaft.
Miss Milborne lachte höhnisch. »Ich glaube, Mylord, dass Sie sich dort äußerst zu Hause fühlen würden.«
Der Viscount knirschte hörbar mit den Zähnen. »Madam, Sie werden Ihre Grausamkeit noch bereuen – wenn es zu spät ist!«
»In der Tat, Mylord, wenn wir vom Theaterspielen sprechen –!«
»Wer spricht vom Theaterspielen?«, fragte der Viscount.
»Sie.«
»Habe nie etwas Derartiges gesagt. Wahrhaftig, Isabella, du kannst einen Mann um den Verstand bringen!«
Sie zuckte die Achseln und wandte sich ab. Der Viscount, der plötzlich das Gefühl hatte, dass er ihr vielleicht seine glühende Liebe – die ihn, wie er glaubte, verzehrte – nicht genügend bewiesen hätte, machte zwei Schritte auf sie zu und versuchte, sie in die Arme zu schließen. Er erhielt aber nur eine Ohrfeige, die ihm die Tränen in die Augen trieb, und befand sich einen Augenblick in Gefahr, zu vergessen, dass er nicht mehr ein Schuljunge war, der einem lästigen kleinen Mädchen gegenüberstand.
Miss Milborne, die in seinen Augen Rachegelüste aufblitzen sah, unternahm einen strategischen Rückzug hinter ein kleines Tischchen und rief in theatralischem Ton: »Gehen Sie!«
Der Viscount sah sie von oben bis unten prüfend an. »Bei Gott, Bella, wenn ich dir jetzt eine Tracht Prügel geben könnte, würde ich –« Er brach ab, da sein erzürnter Blick durch ihre unleugbare Schönheit gefesselt wurde. Sein Gesichtsausdruck besänftigte sich. »Nein, ich täte es doch nicht«, sagte er. »Könnte dir nicht ein Haar krümmen! Also, Bella, willst du nicht doch –«
»Nein!«, schrie Miss Milborne beinahe. »Und ich möchte, dass du mich nicht Bella nennst.«
»Also gut, dann Isabella«, sagte Seine Lordschaft, zu Konzessionen bereit. »Aber willst du nicht –«
»Nein!«, wiederholte Miss Milborne. »Geh! Ich hasse dich!«
»Nein, das tust du nicht«, sagte Seine Lordschaft. »Wenigstens hast du es bisher nicht getan, und ich will verdammt sein, wenn ich verstehe, warum du deine Meinung so plötzlich geändert haben solltest.«
»Doch, ich hasse dich! Du bist ein Spieler und ein Wüstling und ein –«
»Wenn du noch ein Wort sagst, dann bekommst du eine Ohrfeige!«, rief der Viscount wütend. »Wüstling, verflucht noch einmal! Du solltest dich schämen, Bella!«
Miss Milborne, die erkannte, dass sie sich zu einem wenig mädchenhaften Benehmen hatte hinreißen lassen, brach in Tränen aus. Doch ehe der in hohem Maße aus der Fassung gebrachte Viscount etwas Zweckmäßiges unternehmen konnte, öffnete sich die Tür und Mrs. Milborne betrat das Zimmer.
Mrs. Milborne durchschaute die Situation mit einem Blick und verlor keine Zeit, den fassungslosen jungen Mann aus dem Haus zu drängen. Seine Beteuerungen fanden taube Ohren. Sie sagte: »Ja, ja, Anthony, aber Sie müssen jetzt gehen, Sie müssen wirklich gehen. Isabella ist nicht wohl genug, um Besuche zu empfangen. Ich kann mir gar nicht denken, wer Sie überhaupt ins Haus eingelassen hat. Es war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie uns aufgesucht haben, und bitte empfehlen Sie mich Ihrer lieben Mama, aber derzeit empfangen wir keine Besuche.«
Sie steckte ihm Hut und Handschuhe in die Hand und schob ihn unerbittlich aus der Haustür. Als sie in den Salon zurückkehrte, hatte Isabella die Tränen getrocknet und ihre Haltung wieder gefunden. Ihre Mutter sah sie mit emporgezogenen Augenbrauen an. »Hat er um dich angehalten, mein Liebling?«
»Ja«, erwiderte Isabella und schnüffelte in ihr Taschentuch.
»Nun, es liegt kein Grund vor, deshalb zu weinen«, sagte Mrs. Milborne energisch. »Du solltest daran denken, meine Liebe, dass das Vergießen von Tränen die höchst unangenehme Wirkung hat, weibliche Augen zu röten. Ich nehme an, dass du ihm einen Korb gegeben hast?«
Ihre Tochter nickte und schnüffelte noch krampfhafter. »Ja, Mama, natürlich. Und ich sagte, dass ich jemanden mit so wenig gefestigten G-Grundsätzen nie heiraten würde, oder –«
»Völlig überflüssig«, sagte Mrs. Milborne. »Ich staune, Isabella, dass du so wenig Feingefühl bewiesen hast, dich auf jene Seiten im Leben eines Gentleman zu beziehen, von denen ein wohlerzogenes Mädchen nichts wissen sollte.«
»Ganz recht, Mama, ich weiß nur nicht, wie jemand es verhindern könnte, etwas über die Exzesse von Sherry zu erfahren, wenn die ganze Stadt darüber spricht.«
»Unsinn! Jedenfalls besteht nicht der geringste Grund für dich, derartige Dinge zu erwähnen. Ich verarge dir nicht, dass du Sherry einen Korb gegeben hast, obwohl ich zugeben muss, dass er in gewisser Beziehung eine ideale Partie gewesen wäre, denn er ist außerordentlich reich, und wir waren stets besondere Freunde von ... Aber wenn Severn dir einen Antrag macht, dann kann man die beiden natürlich nicht miteinander vergleichen!«
Miss Milborne errötete. »Mama! Wie kannst du nur so sprechen! Ich bin nicht so berechnend. Es ist eben nur, dass ich Sherry nicht liebe, und weil ich außerdem überzeugt bin, dass auch er mich nicht liebt, trotz all seiner Beteuerungen.«
»Ach was, ich glaube, eine Enttäuschung wird ihm nicht schaden«, erwiderte Mrs. Milborne behaglich. »Zehn zu eins wette ich, dass er dadurch erst den richtigen Begriff seiner Stellung bekommt. Aber, meine Liebe, solltest du etwa an George Wrotham denken, dann hoffe ich, dass du es dir noch sorgfältig überlegst, ehe du dich an jemanden wegwirfst, der bloß Baron ist und dessen Güter nach allem, was ich erfahren habe, schwer verschuldet sind. Außerdem fehlt es Wrotham an einer gewissen Beständigkeit, und das missfällt mir sehr.«
Angesichts des auffallenden Mangels an Beständigkeit, der den Viscount Sheringham charakterisierte, erschien diese Bemerkung Miss Milborne äußerst ungerecht, was sie ihrer Mutter auch sagte, wobei sie hinzufügte, dass der arme Wrotham nicht die Hälfte von Sherrys Torheiten begangen habe. Mrs. Milborne leugnete dies nicht. Sie erklärte, es bestehe für Isabella kein Grund, eine überstürzte Wahl zu treffen, und riet ihr, einen Gang durch den Park zu machen, um sich zu beruhigen und ihre heißen Wangen zu kühlen.
Inzwischen ritt der Viscount in größter Wut nach Sheringham Place zurück. Seine Eigenliebe hatte eine unerträgliche Demütigung erfahren; und da er während der letzten zwölf Monate der Meinung gewesen war, in die »unvergleichliche Isabella« unaussprechlich verliebt zu sein, und er auch nicht zu den jungen Leuten gehörte, die sich der Seelenforschung hingeben, währte es nicht lange, bis er im schönsten Zuge war, sich einzureden, dass sein Leben hoffnungslos zerstört sei. Er durchschritt das Tor seines Ahnenschlosses in allem eher als einer ausgeglichenen Stimmung und war daher nicht im Geringsten durch die Mitteilung des Butlers besänftigt, dass Mylady sich im Blauen Salon befinde und ihn zu sprechen wünsche. Er hatte gute Lust, dem alten Romsey zu sagen, er solle sich zur Hölle scheren, da er aber vermutete, dass er seine Mutter vor seiner Rückkehr nach London doch noch einmal besuchen müsse, nahm er von dieser befreienden Äußerung Abstand und begnügte sich damit, dem Butler einen düsteren Blick zuzuwerfen, bevor er in Richtung Blauer Salon davonschritt.
Hier fand er nicht nur seine Mutter vor, eine stets mit ihrer Gesundheit beschäftigte Dame von höchst erstaunlicher Widerstandskraft, sondern auch seinen Onkel Horace Paulett.
Seit Mr. Paulett, nach dem vor einigen Jahren erfolgten Tod Lord Sheringhams, seinen Wohnsitz in Sheringham Place aufgeschlagen hatte, vermochte den Viscount in dieser Beziehung nichts mehr zu überraschen. Er hatte in der Tat erwartet, seinen Onkel hier vorzufinden, was ihn aber nicht hinderte, in aufreizendem Ton zu sagen: »Du lieber Himmel, Sie sind hier, Onkel?«
Mr. Paulett, ein dicklicher Gentleman mit einem unüberwindlichen beständigen Lächeln und sehr weichen weißen Händen, gestattete sich nie, über die offenkundige Abneigung seines Neffen und seine häufigen Ungezogenheiten ärgerlich zu werden. Er lächelte nur breiter denn je und erwiderte: »Ja, mein Junge, ja! Wie du siehst, bin ich hier und auf meinem Platz neben deiner lieben Mama.«
Lady Sheringham, die sich mit einem Riechsalzfläschchen versorgt hatte, um ihre Nerven während der Unterredung mit ihrem einzigen Kind zu stärken, entfernte den Stöpsel, um ein wenig zu inhalieren. »Ich weiß wahrhaftig nicht, was aus mir würde, wenn ich meinen guten Bruder nicht hätte, der mir in meiner Verlassenheit beisteht«, sagte sie in dem schwachen klagenden Ton, der ihre eiserne Konstitution und ihre Entschlossenheit, ihren Willen durchzusetzen, so bewunderungswürdig verbarg.
Ihr Sohn, der ebenso starrköpfig war wie seine Mutter, aber weit aufrichtiger, erwiderte mit erschütternder Offenherzigkeit: »Soviel ich weiß, Madam, wäre es Ihnen ausgezeichnet gegangen. Überdies wäre ich vielleicht dann und wann zu Hause geblieben. Ich will nicht behaupten, dass ich es unbedingt getan hätte, weil ich dieses Haus hier ganz und gar nicht mag, aber es wäre doch möglich gewesen.«
Weit entfernt, sich über dieses schöne Zugeständnis befriedigt zu zeigen, suchte Lady Sheringham in ihrem Ridikül nach einem Taschentuch und führte diesen Hauch aus Spitzen und Musselin an ihre Augenwinkel. »Oh, Horace«, sagte sie. »Ich wusste, wie alles werden würde. Er ähnelt seinem Vater so sehr!«
Der Viscount verfiel keineswegs dem Irrtum, diese Bemerkung für eine Schmeichelei zu halten. Er sagte: »Nun, zum Kuckuck, Madam, das ist doch kein Fehler! Wenn ich darüber nachdenke, möchte ich wissen, wen ich sonst ähnlich sein sollte?«
»Wem, mein Junge, wem!«, verbesserte sein Onkel milde. »Wir dürfen unsere Grammatik nicht vergessen!«
»Habe ich nie gekonnt«, erwiderte der Viscount. »Und sagen Sie nicht ständig ‹mein Junge› zu mir! Ich mag viele Fehler haben, aber das ist wenigstens einer, den mir niemand vorwerfen kann!«
»Anthony, nimmst du denn gar keine Rücksicht auf meine armen Nerven?«, fragte seine Mutter mit bebender Stimme und setzte ihr Riechsalz wieder in Aktion.
»Dann sag diesem flachgesichtigen alten Zappelfritzen, er soll sich davonscheren!«, sagte der Viscount gereizt. »Versteht nie, dass er überflüssig ist, und weiß Gott, ich habe ihm zahllose Male einen unmissverständlichen Wink gegeben.«
»Ach, mein J–, aber ich soll dich doch nicht so nennen, nicht wahr? Ich werde also Sherry sagen, denn so rufen dich, wie ich glaube, deine Freunde und Zechkumpane, nicht wahr?«
»Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat«, erwiderte sein Neffe. »Wenn Sie es sich nicht in den Kopf gesetzt hätten, hier herzukommen und ständig hier zu leben, brauchten Sie mich überhaupt bei keinem Namen zu nennen, was ich nur herzlich begrüßen würde.«
Mr. Paulett drohte ihm mit dem Finger, dann sagte er: »Sherry, Sherry, ich fürchte, deine Werbung ist nicht glücklich ausgegangen. Aber mach dir nichts draus, mein lieber Junge. Bleib standhaft, und du wirst sehen, dass du sie noch herumkriegst.«
Die himmelblauen Augen des Viscount blitzten in einem plötzlichen Wutanfall auf und eine Blutwelle rötete seine Wangen. »Hölle und Teufel!«, rief er wütend. »Also darum kümmern Sie sich, was? Ich wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie sich etwas weniger mit meinen Angelegenheiten beschäftigen würden!«
Lady Sheringham gab ihre bisherige Taktik auf, die anscheinend doch keinen Erfolg versprach, und es gelang ihr, sich einer der Hände des Viscount zu bemächtigen. Sie hielt sie zwischen ihren beiden fest, drückte sie beredt und sagte mit leiser Stimme: »Liebster Anthony, bedenke, dass ich deine Mutter bin, und halte mich nicht länger in dieser Ungewissheit. Hast du mit unserer lieben Isabella gesprochen?«
»Ja«, knurrte der Viscount.
»Komm, setz dich hier neben mich, mein Liebling. Hast du – hast du um ihre Hand angehalten?«
»Ja. Aber sie will mich nicht.«
»Oh, wie schade! Es war mein sehnlichster Herzenswunsch«, seufzte Lady Sheringham. »Ach, wenn ich dich nur mit Isabella verheiratet sehen könnte, dann würde ich in Frieden gehen.«
Ihr Sohn sah sie erstaunt an. »Wohin gehen?«, fragte er. »Wenn Sie an den Witwensitz denken, dann verstehe ich nicht, was Sie daran hindert, an jedem beliebigen Tag hinzuziehen. Außerdem könnten Sie meinen Onkel mitnehmen, und diesbezüglich würden Sie bestimmt kein Wort des Widerspruchs von mir hören«, fügte er großmütig hinzu.
»Manchmal glaube ich, dass du mich absichtlich missverstehst«, klagte Lady Sheringham. »Denn mein schwacher Gesundheitszustand kann dir keineswegs entgangen sein.«
»Was, Sie wollen damit doch nicht sagen, dass Sie sterben werden«, sagte der Viscount ungläubig. »Nein, nein, das werden Sie nicht. Ich erinnere mich sehr genau, dass Sie das schon immer zu meinem Vater sagten, aber es wurde nie etwas daraus. Zehn zu eins ist’s nur mein Onkel, der Sie so ermüdet, weil er ständig hier herumsitzt. Ich gebe Ihnen mein Wort, mich würde das in einer Woche töten, und mit meinen Nerven war bisher bestimmt nie etwas los.«
»Anthony, wenn du schon für mich keine Rücksicht aufbringst, solltest du wenigstens das Zartgefühl deines Onkels schonen.«
»Ach was, wenn ihm etwas nicht passt, kann er ja gehen«, erwiderte Seine Lordschaft unverbesserlich.
»Nein, oh nein, ich bin viel zu weltklug, um mich durch einen jungen Mann beleidigt zu fühlen, der eben in der Liebe eine Enttäuschung erfahren hat«, versicherte ihm Mr. Paulett. »Oh, ich kenne das Gefühl der Demütigung nur zu gut, unter dem du zu leiden hast. Es ist in der Tat äußerst schmerzlich, und ich möchte sagen, für uns alle eine schwere Enttäuschung.«
»Und diese Verbindung wäre in jeder Beziehung so wünschenswert gewesen«, klagte Lady Sheringham. »Ihre Ländereien hätten die deinen so wundervoll arrondiert, Anthony, und die liebe Isabella ist unter allen Mädchen genauso, wie ich sie selbst für meinen einzigen Sohn ausgewählt hätte. Obwohl sich ihr Vermögen mit dem deinen natürlich nicht vergleichen lässt, wäre es, da sie die einzige Erbin ihres Vaters ist, durchaus nicht zu verachten gewesen.«
»Zum Kuckuck, Madam, ich pfeife auf ihr Geld! Ich will nichts als mein eigenes Vermögen!«, sagte Seine Lordschaft.
»Wenn sie deine Hand akzeptiert hätte, dann hättest du es ja bekommen, und ich wäre froh gewesen, es in deinen Händen zu sehen, obwohl du, weiß der Himmel, das ganze Kapital verschwendet hättest, bevor man sich vorsehen könnte. Ach, Anthony, wenn ich dich nur dazu bewegen könnte, deinen Lebenswandel aufzugeben, der mein armes Herz mit Entsetzen vor deiner Zukunft erfüllt.«
Seine Lordschaft befreite sich eiligst. »Um Gottes willen, Madam, regen Sie sich meinetwegen nicht auf!«, bat er.
»Ich wusste, dass sie dich ablehnen würde«, sagte Lady Sheringham. »Und ich frage dich, mein Sohn, welches wohlerzogene Mädchen würde einwilligen, jemanden zu heiraten, der den Weg des Lasters beschreitet? Muss sie denn nicht vor zügellosen Neigungen zurückschrecken, die –«
»Nun hören Sie mal, Madam«, protestierte der erschrockene Viscount. »So schlimm ist es nicht, meiner Seel’, so ist es wieder nicht!«
Sein Onkel seufzte. »Du wirst doch zugeben müssen, mein lieber Junge, dass es kaum eine extravagante Torheit gibt, die du, seit du großjährig bist, nicht begangen hättest.«
»Nein, gewiss nicht«, erwiderte der Viscount. »Verwünscht, ein junger Mensch kann nicht in der Stadt leben, ohne wenigstens hie und da einen tollen Streich zu begehen.«
»Anthony, kannst du deiner Mutter aufrichtig sagen, dass es kein Geschöpf gibt (denn ich kann es nicht über mich bringen, sie ein Mädchen zu nennen!), mit dem du dich nicht schämen müsstest, an den meisten öffentlichen Plätzen gesehen zu werden? Und dass dieses Geschöpf an deinem Arm hängt und in einer Art und Weise zärtlich mit dir ist, die mich mit Abscheu erfüllt?«
»Nein, das kann ich nicht«, erwiderte der Viscount. »Aber ich würde viel drum geben, zu erfahren, wer dir etwas von dem kleinen Vögelchen erzählt hat.«
Während er sprach, richtete er seine Augen jähzornig auf seinen Onkel, aber die Aufmerksamkeit dieses Gentleman konzentrierte sich auf die gegenüberliegende Wand, und seine Gedanken schienen weit entfernt von irdischen Betrachtungen zu sein.
»Du wirst mir noch das Herz brechen«, erklärte Lady Sheringham und führte ihr Taschentuch neuerdings an die Augen.
»Nein, Madam, das wird bestimmt nicht der Fall sein«, sagte ihr Sohn offenherzig. »Denn ich habe nie etwas darüber gehört, dass Ihr Herz wegen irgendeiner der Passionen meines Vaters gebrochen ist. Oder wenn es geschehen wäre, dann kann es nicht nochmals geschehen. Das ist doch klar. Außerdem werde ich das alles aufgeben, wenn ich erst einmal verheiratet bin.«
»Aber du wirst doch nicht heiraten«, erklärte Lady Sheringham. »Und das ist noch nicht alles. Nie im Leben wurde ich so gedemütigt wie an dem Tag des vergangenen Monats, an dem ich mich gezwungen sah, mich bei General Ware für dein unerhörtes Betragen auf der Straße nach Kensington zu entschuldigen. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Natürlich warst du angeheitert.«
»Das war ich nicht!«, schrie Seine Lordschaft auf, an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. »Du lieber Gott, Madam, Sie glauben doch nicht, dass es mir gelungen wäre, die Speichen der Räder von fünf Equipagen zu streifen, wenn ich einen Affen gehabt hätte!«
Seine Mutter ließ das Taschentuch aus ihrer plötzlich erschlafften Hand fallen. »Die Speichen der Räder von fünf Equipagen streifen?«, stotterte sie, während sie ihn ansah, als fürchte sie für seinen gesunden Menschenverstand.
»Fünf Stück hintereinander und ohne Unfall!«, bestätigte der Viscount. »War bloß ein unglücklicher Zufall, dass ich den Phaeton des alten Ware umschmiss. Muss den richtigen Moment verpasst haben. Hat mich obendrein eine Wette gekostet. Habe gewettet, ich könnte die Speichen der ersten sieben Wagen, die ich jenseits des Schlagbaums im Hydepark antreffe, streifen, ohne einen von ihnen umzustürzen. Verstehe nicht, wieso ich es verpfuschte. Muss die Art gewesen sein, wie Ware kutschierte. Konnte nie in Reih und Glied bleiben: Er ist nichts als ein alter Peitschenknaller! Hat keine Präzision des Auges!«
»Mein unglückliches Kind!«, rief seine Mutter mit zitternder Stimme. »Ist denn jedes Schamgefühl in dir erstorben? Horace, sprich du mit ihm!«
»Wenn er das tut«, sagte der Viscount, und sein Kinn streckte sich gefährlich vor, »dann werfe ich ihn aus diesem Fenster, Onkel hin, Onkel her!«
»Oh!«, stöhnte seine schwergeprüfte Mutter, sank auf den Diwan zurück und führte ihre Hand an die Stirn. »Was, was, frage ich dich, mein Bruder, habe ich verbrochen, um das zu verdienen?«
»Still, meine liebe Valeria. Bitte beruhige dich«, sagte Mr. Paulett und ergriff ihre andere Hand.
»Kein Wunder, dass die arme Isabella seine Hand ausschlug. Ich kann es ihr nicht verdenken.«
»Leider kann man nur sagen, dass es auch für die Ländereien so am besten ist«, sagte Mr. Paulett, der ihre zarte schützende Hand als alter Stratege auch weiterhin festhielt. »Ich sage es nur ungern, aber ich halte Sherry nicht für reif genug, um die Kontrolle über sein Vermögen zu übernehmen. Es ist nur zu seinem eigenen Vorteil, wenn es für ihn verwaltet wird.«
»So, es ist also zu meinem eigenen Vorteil?«, warf der arme Sherry zornig ein. »Weil Sie so viel davon verstehen! Wieso es meinem Vater aber je einfiel, Sie zum Treuhänder zu bestellen, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ich habe nichts gegen Onkel Prosper einzuwenden – wenigstens glaube ich, dass ich mit ihm schon fertig würde, wenn Sie nicht wären, der mir ständig in die Suppe spuckt. Und stellen Sie sich nicht, als ob Sie mich bedauern würden und es Ihnen leid täte, dass Bella mich nicht mag, ich weiß ja doch, dass das nicht wahr ist! Ist erst einmal die verwünschte Verwaltung aufgehoben, dann fliegen Sie hinaus, das wissen Sie ganz genau. Wenn es meiner Mutter Spaß macht, dass Sie bei ihr schmarotzen, dann soll sie tun, was sie will, aber bei mir werden Sie nicht länger herumschmarotzen, bei Jupiter, nein, das werden Sie nicht!«
»Ach, mein lieber Junge«, sagte Mr. Paulett und lächelte noch immer, dass es einen verrückt machen konnte, »es dauert aber noch zwei Jahre bis zur Aufhebung der Verwaltung, und wir wollen hoffen, dass du bis dahin eingesehen hast, wie falsch dein Lebenswandel ist.«
»Außer, wenn ich heirate!«, erinnerte ihn der Viscount, und seine Augen schienen Funken zu sprühen.
»Sicher. Aber schließlich, mein lieber Junge, heiratest du ja nicht«, erklärte sein Onkel.
»So, glauben Sie?«, erwiderte Seine Lordschaft und schritt auf die Tür zu.
»Anthony!«, rief Lady Sheringham. »Um Himmels willen, was willst du tun?« Sie befreite sich von der Hand ihres Bruders und richtete sich auf. »Wohin gehst du? Antworte mir, ich befehle es dir!«
»Ich fahre nach London zurück«, antwortete der Viscount. »Und ich heirate das erste Mädchen, dem ich begegne!«
Kapitel 2
Wie nicht anders zu erwarten war, warf der Partherpfeil des Viscount seine Mutter augenblicklich danieder. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass sie einem hysterischen Anfall erliegen würde, und lediglich der Umstand belebte sie wieder, dass der Viscount nicht mehr anwesend war, um durch den Anblick des schweren Anfalls seiner Mutter bestraft zu werden. Ein wenig Hirschhorngeist mit Wasser vermischt, von Mr. Paulett sorglich eingeflößt, einige Tropfen Lavendel auf ihr Taschentuch geträufelt, und einige sanfte Schläge mit der flachen Hand ermöglichten es der schwergeprüften Dame, ihre Augen wieder zu öffnen und ihren Turban zurechtzurücken. Sie vertraute Mr. Paulett sofort ihre Überzeugung an, dass Anthony, nur ihr zu Trotz, mit einem fürchterlich vulgären Geschöpf aus dem Opernballett am Arm erscheinen werde, und gab gleichzeitig ihrer brennenden Sehnsucht nach dem Frieden der Familiengruft beredten Ausdruck.
Mr. Paulett hatte nicht das Gefühl, dass große Gefahr bestünde, sein Neffe könnte in nächster Zeit jemanden heiraten. Er erklärte sich bereit, Anthony aufzusuchen und ihm vorzuhalten, dass sein unkindliches Betragen die taumelnden Schritte seiner armen Mutter an den Rand des Grabes führten. Als er Mylady aber so weit hergestellt sah, wie es ihr Gesundheitszustand erlaubte, und darauf hingewiesen hatte, dass sich ein junger Mann, der in ein blendend schönes Mädchen verliebt war, kaum in die Ehe mit einem andern Mädchen stürzen würde, befand sich der Viscount bereits auf der Straße nach London.
Er fuhr in seinem Kabriolett, vor das ein feuriges Fuchspaar gespannt war; der Reitknecht mit dem scharfgeschnittenen Gesicht hatte hinter ihm aufgesessen und sein Portemanteau war an seinem Platz festgeschnallt. Der Viscount zeigte das Gehaben eines Menschen, der den Staub eines tief verabscheuten Ortes von den Schuhen schüttelt, er fuhr in schärfstem Trab und äußerst rücksichtslos gegen die anderen Wagen, denen er auf der Straße begegnete.
Eine stattliche Reihe von Reitknechten und Stallburschen hatte schon im Dienste des Viscount gestanden, aber es bedurfte eiserner Nerven, um mit ihm zu fahren, wenn ihn eine seiner tollen Launen anwandelte; und da sich dies mit beunruhigender Häufigkeit abspielte und nur zehn wenige Reitknechte die dafür benötigte Geringschätzung des eigenen Lebens und ihrer geraden Glieder besaßen, war keiner lange in seinen Diensten geblieben. Durch einen glücklichen Zufall war er an das Individuum geraten, das sich nun hinter ihm an seinen luftigen Sitz anklammerte. Die Bekanntschaft hatte damit begonnen, dass er dem Viscount in dem Augenblick, als er aus dem Geschäft eines Juweliers in Ludgate Hill trat, seine Geldbörse zu stehlen versuchte. Jason, dessen Leben in einem Findelhaus begann und der über die Straßen Londons in einen Rennstall geriet, von dort aber durch eine Reihe schimpflicher Umstände zurück auf die Londoner Straßen, war wohl ein unbegabter Dieb, dafür aber unerhört geschickt in der Behandlung von Pferden. Im selben Moment, als der Viscount den Burschen beim Kragen erwischte und im Begriff war, ihn ins nächste Wachtzimmer zu schleppen, nahm es einer der Vollblüter zwischen den Wagendeichseln Seiner Lordschaft äußerst übel, dass ein anderer Wagen die Straße heraufkam, er bäumte sich plötzlich in die Höhe und warf den Groom zu Boden, der, statt die Köpfe der Pferde zu halten, den Viscount anstarrte. Es entstand sofort ein ungeheures Getümmel, während dessen sich Jason aus dem gelockerten Griff des Viscount befreite und, statt davonzulaufen, zum Kopf des scheuenden Tieres eilte. In wenigen Augenblicken war die Ordnung wiederhergestellt, der Fuchs hatte offenbar in dem zerlumpten, schmutzstarrenden Geschöpf, das ihn davor bewahrt hatte, durchzugehen, seinen Herrn und Meister erkannt, und drängte sich jetzt mit plumper Zärtlichkeit an ihn. Da der Fuchs aus guten Gründen das unbeliebteste Tier in den Stallungen des Viscount war, ja, da er sogar in dem Rufe stand, jeden aufs grausamste anzufallen, machte der Umstand, dass er seinen Kopf vertrauensvoll an den übel riechenden Busen des Burschen sinken ließ, auf seinen Besitzer den größten Eindruck. Der Viscount vergaß sofort den widrigen Zwischenfall, der seine Aufmerksamkeit auf diesen Hexenmeister gelenkt hatte, und ernannte ihn auf der Stelle zu seinem neuen Reitknecht. Jason – er hatte keinen andern Namen und niemand, am wenigsten er selbst, wusste, wie er zu diesem gekommen war – hatte in den von niemandem gezählten Jahren seines Lebens noch nie ein so unbekümmert gutartiges Wesen kennen gelernt, wie es der Viscount war. Er tauchte allmählich aus seinem Trancezustand auf, in den ihn dieser unerwartete Glücksfall Hals über Kopf befördert hatte, um sich im Dienste eines Edelmanns zu finden, den seine Verwandten für unverbesserlich flatterhaft hielten, in dem er selbst aber in einem Augenblick blendender Erleuchtung einen Gott erblickte, der zur Erde herabgestiegen war.
Der Viscount, der nie die geringsten Anstalten zu seiner eigenen Bekehrung getroffen hatte, trug viel dazu bei, den neuen Reitknecht zu reformieren, nicht etwa weil ihn besonderer Eifer beseelte, sondern weil er dem Druck der Vorstellungen seiner Freunde erlag, die erklärten, dass ein weiterer vertrauter Verkehr mit einem Mann, von dessen Reitknecht man erwarten musste, um Geldbörse, Uhrkette und Siegel erleichtert zu werden, schwere Nachteile habe. Der Viscount versprach diese Angelegenheit zu ordnen, was er auch tat, indem er den Reitknecht kräftig verprügelte und ihn strengstens verwarnte, nie wieder einen seiner Freunde zu bestehlen. Jason, dem die Prügel weniger ausmachten als der finstere Blick seines Gottes, versprach, fürderhin den Pfad der Tugend und Redlichkeit zu beschreiten. Er gab sich auch so große Mühe, sein Versprechen zu halten, dass in kurzer Zeit ein warnendes Wort genügte oder schlimmstenfalls der Befehl, wieder herauszugeben, was er einem zufällig begegneten Bekannten entwendet hatte, um die äußerste Harmonie zwischen dem Viscount und seinen Freunden wiederherzustellen.
Im Übrigen erwies er sich, wenn es ihm auch an äußerem Schliff fehlte, als der ergebenste Diener, den der Viscount je gehabt hatte. Nicht einmal ein Sklave hätte die Launen seines Eigentümers kritikloser betrachten oder unermüdlicher in hingebendem Fleiß sein können. Er war fünfmal aus dem Kabriolett Seiner Lordschaft gestürzt; ein halbzugerittenes Pferd brach ihm ein Bein; er begleitete den Viscount auf einigen seiner gewagtesten Exkursionen, und alle waren überzeugt, dass er bereit war, jede Tollkühnheit zu seines Herrn Schutz auf sich zu nehmen, einschließlich eines Mordes.
Während er hinter dem Viscount an den Gurten des Kabrioletts hing, bemerkte er gelassen, er habe gleich gewusst, dass sie nicht mehr als zwei Tage in diesem Haus bleiben würden. Da er auf diese Bemerkung keine Antwort erhielt, versank er in Schweigen, das er nach etwa einer Meile nur unterbrach, um dem Viscount zu raten, die Pferde an der Kurve zu zügeln, falls er nicht wünschte, dass sie beide auf ihre Gesichtserker fielen. Sein Ton ließ aber erkennen, dass er, falls der Viscount dies wünschen sollte, freudigst bereit sei, auch dieses Schicksal zu erdulden.
Der Viscount, der inzwischen Zeit gehabt hatte, seinen ersten Grimm abzureagieren, zügelte dann doch seine Pferde und nahm die Kurve nicht rascher als in leichtem Trab. Die Hauptstraße nach London war noch einige Meilen entfernt und der Feldweg, der Sheringham Place mit ihr verband, lief einige Zeit an den Äckern des Viscount entlang, um sich plötzlich davonzuschlängeln und zu einem kleinen Dörfchen, einigen verstreuten Hütten, und dem bescheidenen Gut zu führen, das Mr. Humphry Bagshot gehörte. Das Haus Mr. Bagshots lag noch ziemlich weit entfernt von dem Feldweg, es wurde durch Bäume und Büsche verborgen und war von einer niedrigen Steinmauer umgeben. Der Viscount, der seine Aufmerksamkeit ziemlich gleichmäßig zwischen seine Pferde und seine letzte Enttäuschung teilte, starrte düster vor sich auf die Straße und hätte keinen Blick auf das Mäuerchen geworfen, wenn ihm sein Reitknecht nicht plötzlich geraten hätte, das »Licht seiner Augen« nach links zu wenden.
»Da winkt Ihnen ein Mädchen, Guv’nor«, benachrichtigte er seinen – Herrn.
Der Viscount wandte den Kopf und bemerkte, dass er an einer Dame vorbeijagte, die auf der Mauerkrone saß und ihn ein wenig sehnsüchtig ansah. Als er die junge Dame erkannte, zügelte er seine Pferde, trieb sie zurück und rief: »Hallo, Fratz!«
Miss Hero Wantage schien die Art der Begrüßung durchaus nicht übel zu nehmen. Eine leichte Röte färbte ihre Wangen, sie lächelte scheu und erwiderte: »Hallo, Sherry!«
Der Viscount betrachtete sie aufmerksam. Sie war eine noch sehr junge Dame und sah in diesem Augenblick nicht sonderlich vorteilhaft aus. Das weite Gewand, das sie trug, hatte nicht nur eine äußerst unkleidsame Farbe, sie hatte es offensichtlich auch aus zweiter Hand übernommen, denn es sah so aus, als wäre es ursprünglich für ein weit größeres Mädchen gearbeitet und nachher ungeschickt für ihre winzige Gestalt abgeändert worden. Ein grauer Mantel war um ihren Hals geknüpft, dessen Kapuze ihr über die Schultern hing; in der Hand hielt sie ein zerknülltes feuchtes Taschentuch. Auf ihren Wangen waren Tränenspuren zu entdecken, und ihre großen grauen Augen waren gerötet und ein wenig trübe. Die dunklen Locken, die sich aus einem zerschlissenen Band gelöst hatten, waren unordentlich herabgeglitten.
»Hallo, was ist denn los?«, fragte der Viscount plötzlich, als er die Tränenspuren bemerkte.
Miss Wantage schluchzte krampfhaft auf, dann sagte sie kurz und bündig: »Alles!«
Der Viscount war ein gutmütiger junger Mann, und wenn er an Miss Wantage dachte, was sich nicht sehr häufig ereignete, dann geschah es mit einer Art nachsichtiger Zuneigung. In den Flegeljahren hatte er sich ihre ständige Dienstbereitschaft zunutze gemacht, er hatte sie im Kricket unterrichtet, dafür musste sie aber mit der schweren Jagdtasche hinter ihm hertrotten, wenn er an den Hecken ein wenig schießen ging. Er hatte sie tyrannisiert, sie angeschrien, sie geohrfeigt und sie gezwungen, sich mit den verschiedensten Sportarten und allerlei Kurzweil zu beschäftigen, die sie mit Angst erfüllten. Aber er hatte ihr gestattet, hinter ihm herzulaufen, und niemandem andern erlaubt, sie zu hänseln oder schlecht zu behandeln. Sie befand sich in keiner sehr glücklichen Lage. Sie war Waise und wurde im Alter von acht Jahren aus Gnade und Barmherzigkeit im Hause einer Cousine aufgenommen, um mit deren drei Töchtern Cassandra, Eudora und Sophronia erzogen zu werden. Sie wurden gemeinsam unterrichtet, und sie durfte ihre ausgewachsenen Kleider tragen, wofür sie aber zahllose Botengänge machen musste – da derlei Dienste, wie ihr Cousine Jane mitteilte, eine sehr geringe Gegenleistung für die ihr erwiesene Großmut seien. Der Viscount, der Cassandra, Eudora und Sophronia nur um einen geringen Bruchteil weniger verabscheute als ihre Mutter, hatte im Alter von fünfzehn Jahren erklärt, dass sie seiner wohlüberlegten Überzeugung nach Biester seien, die ihre arme kleine Cousine wie einen Hund behandelten. Als er jetzt Miss Wantage ansah, bereitete es ihm daher keinerlei Schwierigkeiten, ihre zu allgemein gehaltenen Angaben richtig zu interpretieren. »Haben dich diese Katzen wieder tyrannisiert?«, fragte er.
Miss Wantage schnäuzte sich. »Ach, Sherry, ich muss Erzieherin werden«, erklärte sie traurig.
»Was musst du werden?«, fragte der Viscount.
»Erzieherin. Meine Cousine Jane will es haben.«
»Habe noch nie im Leben so einen Blödsinn gehört«, sagte der Viscount leicht gereizt. »Dazu bist du doch auch nicht alt genug.«
»Cousine Jane meint, dass ich alt genug wäre. Ich werde in vierzehn Tagen siebzehn, weißt du?«
»Soso, man sieht es dir aber nicht an«, sagte Sherry und tat die Sache damit ab. »Du warst schon immer ein dummes kleines Ding, Hero. Du solltest nicht alles glauben, was die Leute sagen. Zehn zu eins wette ich, dass sie es nicht so meint.«
»Oh ja«, sagte Miss Wantage traurig. »Weißt du, ich habe ja schon immer gewusst, dass ich es eines Tages werden müsse, das war auch der Grund, weshalb ich das abscheuliche Klavierspiel erlernen musste und mit Wasserfarben malen, damit ich, wenn ich einmal erwachsen bin, Erzieherin werden kann. Aber ich will es nicht werden, Sherry, wenigstens jetzt noch nicht! Nicht bevor ich mich wenigstens kurze Zeit unterhalten habe!«
Der Viscount warf die Decke ab, die seine wohlgeformten Beine verhüllt hatte.
»Jason, spring ab und bewege die Pferde!«, befahl er, sprang vom Kabriolett herunter und schritt auf die niedrige Steinmauer zu. »Ist’s hier feucht von dem Moos?«, fragte er misstrauisch. »Ich will verdammt sein, wenn ich mir deinethalben oder für jemand andern meine Reithosen ruinieren ließe!«
»Nein, nein, wirklich nicht«, versicherte ihm Miss Wantage. »Du kannst dich auch auf meinen Mantel setzen, Sherry.«
»Ich kann ohnedies nicht lange bleiben«, kündigte der Viscount an. Er schwang sich neben sie auf die Mauer und legte seinen Arm brüderlich um ihre Schultern. »Und jetzt weine nicht mehr, Fratz, denn wenn du weinst, siehst du verteufelt hässlich aus«, sagte er. »Außerdem kann ich es nicht vertragen. Aber warum hat sich’s diese alte Katze plötzlich in den Kopf gesetzt, dich wegzuschicken? Wahrscheinlich hast du wieder etwas getan, was du nicht tun durftest?«
»Nein, das ist es nicht, obwohl ich eine ihrer schönsten Teetassen zerbrochen habe«, sagte Hero und lehnte sich dankbar an seine Schulter. »Ich glaube, es ist zum Teil, weil Edwin mich küsste.«
»Jetzt schwindelst du mich aber an«, sagte Seine Lordschaft ungläubig. »Dein lächerlicher kleiner Cousin Edwin hat nicht einmal genug Mumm, um ein Stubenmädchen zu küssen!«
»Ach, darüber weiß ich nichts, Sherry, aber er hat mich geküsst, und das war unbeschreiblich abscheulich, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Und meine Cousine Jane hat es irgendwie herausbekommen und gesagt, dass ich daran schuld sei und dass ich ein berechnendes Frauenzimmer wäre und dass sie eine Schlange an ihrem Busen genährt habe. Aber ich bin keine Schlange, Sherry!«
»Mach dir nichts draus«, sagte Sherry. »Aber über Edwin kann ich mich nicht beruhigen. Das übertrifft alles! Er muss betrunken gewesen sein, anders kann ich es mir nicht erklären.«
»Nein, das war er wirklich nicht«, sagte Hero ernsthaft.
»Dann beweist es nur, wie man sich in einem Menschen täuschen kann. Trotzdem, Hero, du solltest es einem so jämmerlichen rotznäsigen Burschen wie diesem Edwin nicht gestatten, dass er dich küsst. Das gehört sich nicht.«
»Aber, Sherry, wie hätte ich mich wehren sollen, wenn er mich gepackt und so zusammengequetscht hat, dass ich kaum atmen konnte?«
Der Viscount lachte schallend auf. »Herrgott, wenn man bedenkt, dass Edwin sich in so einen Mordskerl verwandelt hat! Mir scheint, ich werde dir einen Trick beibringen müssen, damit du dich solcher Angriffe erwehren kannst. Verstehe nicht, dass ich es nicht schon längst getan habe.«
»Danke, Sherry«, sagte Hero, aufrichtig dankbar. »Nur glaube ich nicht, dass ich diesen Trick noch brauchen werde, da man mich doch als Erzieherin in diese abscheuliche Schule nach Bath schickt.«
»Ich bin überzeugt, dass das alles nur Unsinn ist«, erklärte Sherry. »Du siehst nicht so aus wie irgendeine Erzieherin, die ich je kennen gelernt habe, und ich lege die längsten Odds, dass dich keine Schule engagieren würde. Weißt du denn irgendetwas, Hero?«
»Ich glaube es nicht«, erwiderte Hero, »aber Miss Mundesley sagte, dass ich es ganz gut machen werde, und da die Schule ihrer Schwester gehört, so glaube ich, dass sie alles untereinander abgemacht haben. Weißt du, das ist nämlich unsere Erzieherin. Wenigstens war sie es.«
»Ich weiß«, nickte Sherry, »und eine sauertöpfische alte Jungfer außerdem. Ich werde dir etwas sagen, Fratz: Wenn du in diese schauderhafte Schule gehst, machen sie aus dir nur einen verdammten Sklaven, ich warne dich! Wenn ich es recht überlege, was, zum Teufel, können sie nur vorhaben, ein junges Ding wie dich in die Welt hinauszustoßen?«
»Miss Mundesley sagte, dass man mich sehr streng halten würde«, erklärte Hero. »Genau genommen, stoßen sie mich also nicht in die Welt hinaus.«
»Darauf kommt es nicht an. Verdammt, je länger ich darüber nachdenke, desto übler scheint mir die Sache. Du bist doch schließlich kein Bettelkind.«
Miss Wantage hob ihren unschuldigen Blick zu seinem Gesicht. »Doch, Sherry, das bin ich. Ich habe doch gar kein Geld.«
»Das hat nichts zu bedeuten«, sagte der Viscount ungeduldig. »Ich meine, dass ein Mädchen deiner Herkunft nicht Erzieherin wird! Habe deinen Vater nicht persönlich gekannt, habe aber alles über ihn erfahren. Sehr gute Familie – verdammt besser als die der Bagshots! Und außerdem hast du eine Menge höllisch feiner Verwandtschaft. In Norfolk oder so irgendwo. Habe gehört, wie meine Mutter darüber sprach. Sie kommen mir wie eine sehr langweilige Gesellschaft von Dummköpfen vor, aber das spielt keine Rolle. Am besten wäre es, wenn du ihnen schriebest.«
»Das hat keinen Zweck«, seufzte Hero. »Ich glaube, mein Vater hat sich mit ihnen zerstritten, weil sie nichts für mich tun wollten, als er im Sterben lag. Also glaube ich, hätten sie gar nichts dagegen einzuwenden, wenn ich Erzieherin würde.«
»So, aber ich habe etwas dagegen einzuwenden«, sagte der Viscount. »Ich werde das keineswegs dulden. Du musst an etwas anderes denken.«
Miss Wantage kam seine Rede weder despotisch noch unvernünftig vor. Sie stimmte mit ihm überein, wenn auch etwas bedenklich. »Du meinst also, dass ich den Hilfsgeistlichen heiraten soll, Sherry?«, fragte sie und zog ihr kurzes Näschen kraus.
Der Viscount starrte sie äußerst erstaunt an. »Warum, zum Teufel, sollte ich etwas Derartiges meinen? Natürlich meine ich es nicht. Du bist von allen albernen Mädchen wahrhaftig das albernste, Hero!«
Miss Wantage nahm diese Zurechtweisung demütig und bescheiden genug entgegen, sagte aber: »Ich halte es ja auch für eine alberne Idee, aber meine Cousine Jane sagt, entweder den Hilfsgeistlichen oder die abscheuliche Schule.«
»Du willst damit doch nicht etwa behaupten, dass der Hilfsgeistliche dich heiraten will?«, fragte Sherry.
Miss Wantage nickte. »Er hat um mich angehalten«, erklärte sie nicht ohne Stolz.
»Mir kommt vor«, sagte Seine Lordschaft streng, »als wärest du, seitdem ich dich zum letzten Mal sah, verteufelt leichtsinnig geworden. Was du nicht sagst! Den Hilfsgeistlichen heiraten! Hat er dich etwa auch hinter der Tür geküsst?«
»Oh nein, Sherry«, versicherte ihm Miss Wantage. »Meine Cousine Jane sagt auch, dass er sich mit der größten Schicklichkeit benommen hat.«
»Das will ich auch hoffen«, sagte Seine Lordschaft und verdarb den Ernst dieser Bemerkung etwas, indem er einen Augenblick später nachdenklich hinzufügte: »Der kommt mir auch wie ein fader Hund vor.«
»Ja, das ist er auch«, stimmte Hero zu. »Ich glaube schon, dass er vielleicht sehr gütig ist, aber – oh Sherry, wenn du mir deswegen nicht böse wärest, würde ich doch lieber Erzieherin werden, weil ich ihn wirklich nicht heiraten möchte.«
»Was ich nicht verstehen kann«, sagte Seine Lordschaft, »warum will er dich eigentlich heiraten? Er muss im Oberstübchen nicht ganz richtig sein. Weißt du, Hero, du eignest dich einfach nicht zur Frau eines Geistlichen, und du hast ihm bestimmt nicht erzählt, dass du damals den Kirchenstuhl von Bassenthwaites mit Leim bestrichen hast, so dass alle Anwesenden außer sich vor Verlegenheit waren?«
»Nein, das habe ich ihm nicht erzählt«, gestand Hero. »Aber, Sherry, in Wirklichkeit warst doch du es, der den Leim aufgestrichen hat.«
»Das ist wieder echt weiblich«, rief Sherry aus. »Nächstens wirst du noch behaupten, dass du überhaupt nichts damit zu tun hattest.«
Miss Wantage schob ihre kleine Hand vertrauensvoll unter seinen Arm. »Aber nicht wahr, Anthony, ich habe dir dabei doch geholfen?«
»Ja, und hast mir den Leim über meine neuen Hosen gegossen, weil du glaubtest, jemanden kommen zu hören, du dummes Ding!«, sagte der Viscount, der sich dieses Zwischenfalls mit verdüstertem Blick erinnerte.
Miss Wantage lachte leise. »Oh, und wie du mich dafür geohrfeigt hast. Meine Wange war stundenlang feuerrot, und ich musste eine Mordsgeschichte erfinden, um den Grund dafür zu erklären.«
»Nein, wirklich?«, sagte der Viscount, etwas schuldbewusst, und strich ihr freundlich über die Wange. »Was für ein höllisch junger Grobian muss ich gewesen sein! Aber weißt du, Fratz, du hättest selbst die Geduld eines Heiligen oft auf die Probe gestellt.«