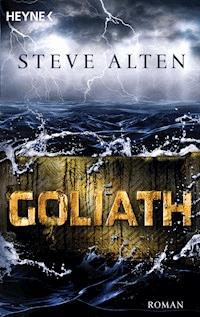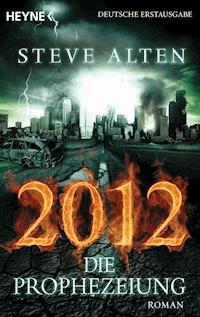9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Fortsetzung des Blockbusters MEG
Sein Appetit ist gewaltig, seine Zähne sind messerscharf. Wenn er einmal Blut gerochen hat, ist er nicht mehr zu bremsen ... Ein prähistorischer gigantischer Hai bricht aus einer künstlichen Lagune aus und versetzt die Bevölkerung entlang der kalifornischen Küste in Angst und Schrecken. Kann der Tiefseetaucher Jonas Taylor die Meeresbestie stoppen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
Das Buch
Zweiundzwanzig Meter lang, achtundzwanzig Tonnen schwer, messerscharfe Zähne und hoch entwickelte Sinne; schrecklicher als Tyrannosaurus rex und gefährlicher als der weiße Hai – das ist Carcharodon megalodon. Elf Jahre ist es her, dass der Tiefseeforscher Jonas Taylor im Marianengraben auf den Monsterhai stieß und zusehen musste, wie zwei seiner Forscherkollegen Opfer der Bestie wurden. Nun lebt ein Exemplar dieser Spezies – Angel – als Touristenattraktion in einer künstlichen Lagune in Kalifornien. Doch dann bricht Angel aus! Für Taylor beginnt der Kampf gegen die Bestie von Neuem – gewaltiger als je zuvor!
Erleben Sie die Fortsetzung von MEG, dem Buch zur Blockbusterverfilmung (ebenfalls bei Heyne erschienen)
Der Autor
Steve Alten wurde in Philadelphia geboren. Der Sportmediziner und Hobby-Paläontologe wurde mit seinem Debütroman »MEG – Die Angst aus der Tiefe« und der Fortsetzung »Höllenschlund – MEG 2« praktisch über Nacht zum internationalen Bestsellerautor.
STEVEALTEN
MEG
HÖLLENSCHLUND
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kleinschmidt
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Für Mom und Dad,die immer für mich da waren
DERDRUCKDERTIEFE
Marianengraben12 Grad nördlicher Breite144 Grad östlicher Länge22. März 2001
Barry Leace, Tiefseepilot der US-Navy außer Dienst, wischte sich den Schweiß von den Handflächen, während er den Tiefenmesser der Proteus beobachtete. 10 582 Meter. Mehr als zehn Kilometer Ozean über dem Kopf, und draußen ein Druck von 1100 Bar.
Hör bloß auf, daran zu denken …
Leace ließ den Blick durch die enge Kabine des Vier-Mann-Tauchbootes schweifen. Reihen von Computermonitoren, elektronische Geräte und ein verwirrender Kabeldschungel füllten die druckgeschützte Hülle. Der wasserdichte Sarg bot kaum genug Platz für seine Mannschaft.
Unter dem Steuerpult starrten Teamchef Ellis Richards und seine Assistentin Linda Heron durch winzige Fenster im Boden des Bugs.
»Siehst du die Tiere mit der pelzigen grünen Haut?«, fragte Linda. »Das sind Pompejiwürmer, die in Temperaturen zwischen 20 und 80 Grad Celsius überleben können. Die Hydrothermalquellen liefern Schwefel, von dem Bakterien leben, und die werden von Röhrenwürmern verdaut …«
»Linda …«
»… die wiederum als Nahrungsquelle für eine ganze Reihe seltsam aussehender Lebewesen dienen.«
»Linda, Schluss mit der verdammten Biologiestunde«, sagte Richards.
»Tut mir leid.« Verlegen wandte sich die Heine-Geologin wieder ihrem Fenster zu. Sie legte die Hände an die Augen, um das störende Licht abzuschirmen.
Khali Habash, das vierte Besatzungsmitglied, sah von seiner Kontrolltafel auf Linda hinab und grinste vor sich hin. Das Mädchen redete gern, besonders wenn es nervös war; eine Eigenschaft, die der vermeintliche Araber nie auszunutzen vergaß.
Habashs wirklicher Name war Arie Levy. Er war als Jude in Syrien geboren und aufgewachsen. Vor fast zehn Jahren war Arie vom israelischen Geheimdienst Mossad rekrutiert worden und hatte seither ein Doppelleben geführt. Die halbe Zeit verbrachte er in Israel bei seiner Frau und seinen drei Kindern, sonst reiste er in der arabischen Welt und in Russland umher, wobei er sich als Plasmaphysiker ausgab. Es hatte vier Jahre harter Arbeit bedurft, um sich in Benedict Singers Organisation einzuschleichen, aber schließlich hatte es geklappt. Und nun war er zehn Kilometer unter dem Wasserspiegel des Pazifiks, um den Geheimnissen nachzuspüren, die das Schicksal der Menschheit für immer verändern konnten.
Levy sah auf die Außentemperaturanzeige. »He, Linda, kannst du dir vorstellen, dass das Wasser 78 Grad hat?«
Die junge Frau blickte auf. »Unglaublich, nicht? Wir nennen das hydrothermale Rauchfahnen. Das heißt, mineralhaltiges Wasser, das aus den Black Smokers austritt, hat eine Temperatur von 700 Grad. Beim Aufstieg erwärmt es eine Säule aus eiskaltem Meerwasser, bis deren Auftrieb ungefähr 360 Meter über dem Grund des Grabens eine Ruhelage erreicht. Meeresströmungen breiten die Fahne waagrecht aus. Eine schwebende Rußschicht aus Mineralien bildet eine isolierende Decke, die die tropische Wasserschicht über dem Grund der Schlucht schützt.«
»Und diese Schicht kühlt nie ab?«
»Nie. Die Hydrothermalquellen werden als ›chronisch‹ bezeichnet. Sie sind schon seit der Kreidezeit aktiv.«
Ellis Richards sah auf seine Uhr. Als Teamchef des Projekts machte er sich ständig Sorgen, hinter den Zeitplan zurückzufallen. »Mensch, jetzt sind wir schon drei Stunden hier, und es sieht aus, als wären wir kaum vorwärtsgekommen. Linda, liegt das an mir, oder hat der Pilot keine Ahnung, was er eigentlich tut?«
Barry Leace ignorierte die Frotzelei. Er sah auf sein Sonargerät und fluchte leise vor sich hin. Sie hatten sich zu weit von der Benthos entfernt, die ihrem Auftraggeber GTI – Geo-Tech Industries – als mobiles Tiefseelabor und Tauchbootstation diente. Das Milliarden Dollar teure Mutterschiff glich einer überkuppelten Sporthalle mit einem flachen Unterbauch, von dem drei gewaltige, als Stoßdämpfer dienende Beine herabhingen. Knapp über dem unruhigen Meeresboden schwebend, erinnerte die über 4000 Quadratmeter große Titanstruktur, die dem Tauchboot in nördlicher Richtung durch das feindlichste Milieu der Erde folgte, Leace an ein monströses Kriegsschiff.
Barry Leace hatte während seiner Zeit bei der Navy auf drei verschiedenen U-Booten gedient, weshalb er schon seit Langem daran gewöhnt war, in klaustrophobisch engen Räumen unter den Wellen zu leben. Nicht jeder war zum U-Boot-Mann geeignet. Man musste in perfektem mentalem und psychischem Zustand sein, musste die volle Leistung erbringen im steten Bewusstsein, dass es nur eines einzigen Missgeschicks bedurfte, um in der Finsternis zu ertrinken, während man Hunderte von Faden unter dem Meeresspiegel in einem Stahlschiff eingeschlossen war.
Leace besaß diese Kraft, diese mentale Stärke. In seinen 26 Dienstjahren hatte er das immer wieder unter Beweis gestellt. Deshalb war er auch so überrascht, wie leicht seine Psyche im Marianengraben zu erschüttern war. Sein in Tausenden von U-Boot-Stunden erworbenes Selbstvertrauen hatte sich plötzlich in Luft aufgelöst, als die Proteus ihr Dock an Bord der Benthos verlassen hatte.
Es lag allerdings nicht an der Tiefe, dass er so nervös war. Vier Jahre zuvor war durch menschliche Schuld ein 18 Meter langes Exemplar des prähistorischen Hais Carcharodon megalodon, eines Vorläufers des Weißen Hais, mit verheerenden Folgen aus eben diesem Graben an die Oberfläche gelangt. Zwar hatte man den kolosshaften Albino am Ende vernichtet und sein überlebendes Junges gefangen, doch waren mindestens ein Dutzend Menschen von seinen zwei Meter breiten Kiefern zermalmt worden. Wo ein solches Wesen gelebt hatte, musste es weitere geben. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und technischen Innovationen, die Geo-Tech vorgenommen hatte, war der Tauchbootpilot ein Nervenbündel.
Leace zog den Gashebel zurück, um den Hauptantrieb zu verlangsamen. Er hatte keinerlei Bedürfnis, sich zu weit vom Mutterschiff zu entfernen.
»Was ist denn jetzt wieder, Kapitän?« wollte Richards wissen. »Warum werden wir langsamer?«
»Die Temperatur steigt wieder an. Wir nähern uns offenbar einer weiteren Reihe von Hydrothermalquellen, und ich will auf keinen Fall mit einem der Black Smoker kollidieren.«
Richards kniff wütend die Augen zusammen. »Verdammt nochmal …«
Leace drückte sein Gesicht ans Fenster, um der Tirade zu entgehen.
Die Scheinwerfer des Tauchboots erleuchteten einen versteinerten Wald aus Schwefel- und Mineralienablagerungen. Die mächtigen Säulen erhoben sich mehr als zehn Meter über den Meeresboden. Dunkle, wogende Wolken extrem heißen, mineralreichen Wassers schossen aus den Mündern der bizarren Schlote.
Levy sah, wie Ellis Richards sich drohend auf das Steuerpult des Piloten zubewegte. »Kapitän, jetzt wollen wir mal was klarstellen. Ich bin für diese Unternehmung verantwortlich, nicht Sie. Meine Anweisungen lauten, täglich mindestens 30 Kilometer abzusuchen, und das schaffen wir in diesem Schneckentempo noch nicht mal annähernd.«
»Immer mit der Ruhe, Mr. Richards. Ich will mich nicht zu weit von der Benthos entfernen, zumindest nicht, bis ich ein Gefühl für das Boot habe.«
»Ein Gefühl für … Ich dachte, Sie sind ein erfahrener Pilot?«
»Ganz recht«, sagte Leace, »und deshalb habe ich die Geschwindigkeit gedrosselt.«
Linda sah von ihrem Fenster auf. »Wie weit sind wir denn eigentlich von der Benthos entfernt, Kapitän?«
»Knapp über sechs Kilometer.«
»Sechs Kilometer, mehr nicht? Benedict Singer wird ausrasten.« Richards sah aus, als stünde er kurz vor einem Schlaganfall. »Hören Sie mal, Kapitän, Anfang nächster Woche werden da oben die Prometheus und die Epimetheus erwartet. Keines der beiden Boote kann mit der Arbeit beginnen, bevor wir unsere nicht erledigt haben.«
»Das weiß ich.«
»Gut so. GTI zahlt Ihnen eine Wahnsinnssumme, um die Proteus zu steuern. Wir können einfach nicht immer auf die Benthos warten, wenn wir unterwegs sind. Sonst brauchen wir mindestens 30 Tage mehr als vorgesehen, und das ist absolut unannehmbar.«
»Das gilt auch fürs Sterben, Mr. Richards. Mein Job ist es, uns in diesem höllischen Abgrund am Leben zu erhalten, ohne irgendwelche Risiken einzugehen, nur damit Sie Ihren Bonus kriegen, weil wir den Terminplan schlagen.«
Der Teamchef starrte ihn an. »Sie haben Angst, Kapitän, stimmt’s?«
»Ellis …«
»Doch, Linda, ich liege da bestimmt nicht falsch.«
Levy beobachtete, wie die Gemüter sich erhitzten. In den wenigen Wochen, die er nun in der Tiefe lebte, hatte der Mossad-Agent feststellen können, dass Ellis Richards ein halsstarriger Mann war, der lieber zu Einschüchterungstaktiken griff als zuzugeben, dass er unrecht haben könnte. Obwohl die Menschheit mehr über weit entfernte Galaxien wusste als über den Marianengraben, benahm Richards sich wie ein Experte, der auf wundersame Weise über alles Bescheid wusste, von der unbekannten geologischen Struktur der Tiefe bis hin zu den dort vorkommenden mysteriösen Lebewesen.
In Arie Levys Augen machte Richards’ wichtigtuerische Pose ihn zu einem gefährlichen Mann.
Kapitän Leace erwiderte Richards’ drohenden Blick. »Ich habe eine gesunde Portion Angst in mir, wenn es das ist, was Sie meinen. Offenbar ist sich keiner von Ihnen ganz darüber im Klaren, wie gefährlich es ist, in mehr als 10 000 Metern Tiefe zu operieren. Versuchen Sie doch mal zu kapieren, was passiert, wenn irgendwas schiefläuft – wenn wir versehentlich auf etwas aufprallen … oder wenn was auf uns aufprallt. Dann können wir weder wasserdichte Türen schließen noch irgendwelche Vorschriften befolgen. Wird der Rumpf beschädigt, haben Sie nicht mal Zeit, sich den Schnuller aus dem Mund zu nehmen.«
»Hört sich ganz so an, als hätten Sie die Nerven verloren«, sagte Richards.
»Wie bitte?«
»Was meinen Sie, Habash? Hat unser Kapitän die Nerven verloren oder nicht?«
»Angesichts dessen, dass weitere Exemplare des Carcharodon megalodon irgendwo in dieser Schlucht leben könnten, muss ich die Meinung des Kapitäns respektieren«, sagte Levy. »Andererseits haben wir mehr als 150 000 Quadratkilometer Meeresgrund abzusuchen. Außerdem soll uns das Sonargerät im Schlepptau unseres Begleitschiffs oben vor sich nähernden Lebewesen warnen, sodass wir mehr als genug Zeit haben, um es zurück in die Sicherheit der Benthos zu schaffen.«
»Mehr als genug Zeit?« Leace schüttelte fassungslos den Kopf. »Woher zum Teufel wissen wir, mit welcher Geschwindigkeit sich diese Lebewesen nähern? Außerdem ist die Goliath gerade inmitten eines Sturms. Die raue See stört die Verbindung.«
»In diesem Fall schlage ich vor, dass wir hier unsere ersten Proben einsammeln, um der Benthos Gelegenheit zu geben, uns einzuholen. Sobald das Wetter sich beruhigt hat, fällt Ihnen bestimmt etwas ein, wie wir die verlorene Zeit aufholen können.«
Leace warf Linda einen wütenden Blick zu, bevor er sich wieder seinen Instrumenten zuwandte. Er überprüfte eingehend die Radarbake, warf einen kurzen Blick aus seinem Fenster und aktivierte die Seitendüsen. Zwischen einer Reihe von Black Smokers sank die Proteus langsam zu Boden, um direkt über einer Kolonie leuchtender Röhrenwürmer schwebend stehen zu bleiben. Das Gewirr der mundlosen, vier Meter langen Lebewesen wand sich in der Strömung wie die Schlangen auf dem Haupt der Medusa.
»Ich stelle jetzt unseren Gaschromatografen an«, sagte Levy. »Wenn wir hier feststellen sollten, dass aus den Hydrothermalquellen Heliumisotope dringen, dann ist das schon die halbe Miete.«
»Gut, gut, machen Sie schon.« Richards kämpfte mit der Steuerung auf seinem Schoß, die die mechanischen Arme des Tauchboots kontrollierte. Er begann, die beiden Hauptkontrollknöpfe zu bedienen, und führte mithilfe der Unterwasserkamera die beiden Arme aus. Behutsam holte er mit dem Greifer des linken Arms den Sammelkorb aus seiner Verankerung.
Kapitän Leace sah zu, wie sich die Arme dem Meeresboden näherten. Ihre Bewegungen ließen Schlammwolken aufsteigen. Er schloss die Augen und versuchte, sich zu entspannen, während er dem hydraulischen Pfeifen der Greifer lauschte.
»Mehr nach links«, sagte Linda, die Richards von ihrem Fenster aus dirigierte. »Gleich neben den Röhrenwürmern.«
Eine Abfolge lauter Echosignale aus dem Sonar ließ dem Piloten das Blut in den Adern gefrieren. Er griff nach dem Ausdruck, starrte dann wieder ungläubig auf den Bildschirm.
Ein Verband eng nebeneinander schwimmender Objekte war zu sehen. Es waren große Objekte.
Leace spürte, wie ihm der Atem stockte. Die anderen arbeiteten weiter, ohne auch nur aufzublicken.
»Habash, wir haben Gesellschaft.«
Levy wandte sich um. »Was ist es?«
»Im Sonar erscheinen drei nicht identifizierbare Objekte, Position null-eins-fünf. Entfernung sieben Komma vier Kilometer. Geschwindigkeit 15 Knoten. Sie kommen direkt auf uns zu.«
»Irgendeine Nachricht von oben?«
»Ich versuch’s gerade. Keine Antwort. Wir sind auf uns allein gestellt.«
»Was schlagen Sie vor?« Levy fühlte sich plötzlich selbst ein wenig klaustrophobisch.
Leace starrte auf den Sonarschirm. »Ich würde sagen, wir sollten schleunigst abhauen. Richards, ziehen Sie die Arme ein, wir kehren unverzüglich zur Benthos zurück.«
»Soll das ein Scherz sein?«
»Kapitän, sind Sie sich da sicher?« Linda spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte.
»Sehen Sie doch selbst! Was das auch für Biester sein mögen, sie kommen immer schneller durch den Graben auf uns zu. Richards, ich habe doch gesagt, Sie sollen die Arme einziehen.«
»Und ich sage Ihnen, Sie können mich mal! Ich habe 20 Minuten gebraucht, um diese Proben einzusammeln, und ich denke nicht im Traum daran zu starten, bevor ich den Korb wieder gesichert habe.«
Levy trat zum Sonar und starrte auf die drei Lichtpunkte. Er dachte an seine Instruktionsstunden zurück. Jagt das Megalodon im Rudel?
»Vielleicht ist es bloß ein Schwarm Fische«, sagte Linda. »Kein Grund zur Aufregung …«
»Ein Schwarm Fische? Bleiben Sie bei Ihrer Geologie, Linda! Das Sonar zeigt an, dass diese Dinger mehr als zwölf Meter lang sind. Aus dem Weg!«
Leace aktivierte die Seitendüsen. Ruhig Blut. Nicht zu schnell. Stoß bloß nirgends an, sonst beschädigst du den Rumpf. Das Tauchboot drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Ein furchtbarer Stoß erschütterte die Proteus.
»Verdammt noch mal, Leace«, brüllte Richards. »Sie haben fast den Greifarrn abgerissen! Ich habe gerade sämtliche Proben verloren.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen die Arme einfahren.« Leace beschleunigte die Proteus auf ihre Spitzengeschwindigkeit von knapp zwei Knoten. Er wusste, dass sich irgendwo in der Finsternis die Benthos auf sie zu bewegte.
Die Echosignale wurden stärker.
Noch 32 Minuten bis zur Benthos, dachte Levy. Wir sind zu weit weg.
»Kapitän, hören Sie doch!« Linda packte den Piloten am Arm. »Das sind keine Haie.«
Leace starrte geradeaus. »Hier spricht die Biologin, was?«
»Ich glaube, Linda hat recht«, sagte Levy, während er versuchte, seine aufkeimende Angst zu bändigen.
»Hören Sie, Habash, was immer diese Dinger sind, sie sind verdammt viel größer und verdammt viel schneller als die Proteus.«
Die Abstände der Echosignale wurden kleiner. Levys Herz raste, als wollte es deren Rhythmus folgen.
»Das ist doch lächerlich«, sagte Richards.
Leace achtete nicht auf ihn. Er beugte sich vor, um durch das Fenster in die Finsternis zu starren. Der von den Hydrothermalquellen aufsteigende Rauch machte es schwierig, mehr als eine kleine Distanz zu überblicken. Leace schirmte die Augen ab und bemühte sich, möglichst scharf zu sehen.
Lange Minuten vergingen in völligem Schweigen.
Eine rasche Bewegung voraus. Eine weitere an Steuerbord. Sehr schnell. Sehr groß.
»Da sind sie«, flüsterte der Kapitän mit einem Kloß im Hals. Verdammt fix, die Scheißkerle.
Einen langen Augenblick sagte wieder niemand ein Wort. Das einzige Geräusch kam von der Schraube der Proteus.
Mit einem plötzlichen Ruck neigte das U-Boot sich nach Steuerbord. Leace krachte mit dem Gesicht in die Konsole vor ihm.
»Was ist passiert?«, fragte Richards. »Wo sind Sie drangestoßen?«
»An gar nichts. Das waren die da draußen.« Leace kämpfte mit der Steuerung. »Das Boot reagiert nicht … irgendwas muss kaputtgegangen sein.«
»Pst. Hört doch mal«, flüsterte Linda.
Über ihren Köpfen konnten die vier ein leises Geräusch wahrnehmen – das Ächzen von Metall.
»Um Gottes willen, einer von denen ist über uns.«
Levy starrte auf den Bildschirm und lauschte dem Piepsen des Sonars.
»Leace, tun Sie doch was«, befahl Richards.
»Festhalten.« Der Pilot ließ das Tauchboot erst scharf nach Backbord und dann zurück nach Steuerbord schwenken, um den Angreifer abzuschütteln.
»Aufhören, Kapitän«, brüllte Linda, »die Platte lockert sich!« Von der Oberseite des Rumpfs her war ein metallisches Knirschen zu hören. Leace streckte die Hand aus und berührte einen der Titanbolzen, die in die Platte über seinem Kopf geschweißt waren. Er spürte Feuchtigkeit und leckte an seinen Fingern. »Meerwasser«, ächzte er. Er beugte sich vor und betete, dass die Benthos in seinem Blickfeld erscheinen möge.
Die Proteus kippte zur Seite, und das Geräusch berstenden Metalls fraß sich in die Ohren der Besatzung.
»Verfluchte Scheiße.« Leace wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. »Die reißen die Heckflosse ab.«
Linda presste ihr Gesicht ans Fenster. »Wo ist die Benthos?«
Etwas Großes prallte mit voller Wucht auf das U-Boot. Geräte, die nicht befestigt waren, wurden durch die Kabine geschleudert.
»Kapitän, ich glaube, ich weiß, was die vorhaben«, rief Levy. »Die beiden kleineren Exemplare stoßen uns auf das größere zu.«
»Sind die Viecher etwa intelligent?«
»Da!«, brüllte Linda auf und zeigte auf ihr Fenster. Undeutlich konnte Leace erkennen, dass sich ein vertrauter Schatten auf sie zu bewegte. »Das ist die Benthos …«
»Uns bleibt keine Zeit zum Andocken«, sagte Levy. »Melden Sie der Benthos, sie sollen die Hangartore öffnen!«
»Es dauert aber fünf Minuten, um die Kammer zu fluten«, rief Linda.
Leace packte das Funkmikrofon. »Mayday … Mayday Benthos, hier spricht die Proteus, öffnet sofort die Hangartore …«
»Begeben Sie sich zu Ihrer Andockzone, Proteus.«
»Verdammt noch mal, öffnet die Hangartore, und zwar sofort.«
Die Arme zur Decke erhoben, stand Arie Levy unter den sich lockernden Bolzen und spürte, wie die Titanplatte über seinen schwitzenden Handflächen vibrierte. »Was immer das für Biester sind, sie reißen das ganze Teil hier runter!«
Ein pfeifendes Geräusch drang in die Kabine.
»Was ist das?«, flüsterte Richards.
Leace blickte auf. »Unsere Platten lösen sich langsam aus dem Verbund.«
»Kapitän«, brüllte Levy, »das dritte Biest«.
Ein gewaltiger Stoß traf den Bug des U-Boots und warf Linda und Richards zu Boden. Leace taumelte in sein Schaltpult. Er prallte mit dem Kopf auf das Glas des Fensters auf. Blut strömte über seine Stirn. Er wischte es sich aus den Augen und erstarrte vor Schreck.
Ein leuchtend rotes Auge spähte durchs Fenster.
Verzweifelt presste Levy die Hände an die Titanplatte, die über ihm vibrierte. Er dachte an die Fakten, denen er so lange nachgejagt war und die er noch nicht hatte weitergeben können. Er dachte an seine Frau und seine Kinder, die er seinem Dienst geopfert hatte.
Das Pfeifen über ihm erlosch. Zwei verbogene Bolzen spritzten in die Kabine wie Maschinengewehrgeschosse.
Der Kopf des Mossad-Agenten implodierte, noch bevor die Bolzen auf dem Boden aufprallten.
EINALBTRAUMWIRDWAHR
Monterey, Kalifornien
Flimmerndes Sonnenlicht drang in die graugrüne Tiefe. Kopfüber stürzte Jonas Taylor ins Leere. Sein Atem ging schwer, irgendetwas drückte ihm die Brust zusammen, seine Kehle brannte. Die Augen weit aufgerissen, presste er die Hände an die ihn umhüllende Lexankapsel.
Der Ozean wurde pechschwarz. Jonas sank weiter in die Tiefe, trudelte abwärts in den Schlund, während er unablässig die Finsternis unter sich absuchte.
Ein kreisender schwarzer Wirbel aus Ruß erschien im Scheinwerferkegel des Tauchboots. Aus der trüben Strömung erhob sich ein Objekt, eine zweite Lexankapsel. In ihrem Innern lag der Körper einer Frau. Ihr Gesicht war von Schatten verhüllt, aber Jonas konnte ihr langes schwarzes Haar erkennen, das sie wie Seide umfloss. Einen kurzen Moment lang sah er ihre dunklen Mandelaugen – leere Augen, die durch ihn hindurchstarrten.
Terry …
Er beschleunigte sein Boot in ihre Richtung, kam aber kaum vorwärts, weil er durch eine starke Strömung behindert wurde. Wieder schrie er ihren Namen, während ihn ein Grauen überkam.
Aus dem Trümmerstrudel hinter ihr erschien ein fahles Leuchten. Das unheimliche Licht verwandelte Terrys Körper in eine graue Silhouette.
Jonas stockte der Atem, als Angels monströser Kopf auftauchte. Mit dämonischem Grinsen öffnete sich das gewaltige Maul und ließ rosafarbenes Zahnfleisch und mehrere Reihen gezackter, dreieckiger Zähne sichtbar werden.
Jonas versuchte zu schreien, brachte aber keinen Laut hervor.
Terry hob den Blick. Freude, ihn zu sehen, lag darin – und Angst. »Jonas«, flüsterte sie, während das Monster die ganze Kapsel mit dem Maul umschloss.
»Jonas.«
»Nein!« Jonas schnellte kerzengerade im Bett hoch. Er schnaufte heftig, und die Hände zitterten unbeherrscht.
»Ruhig, Liebling, ganz ruhig.« Terry setzte sich auf und strich ihm übers Haar. Nach dem plötzlichen Aufschrei ihres Mannes flatterte ihr selbst das Herz.
Morgenlicht fiel durch die hölzernen Rollläden und erleuchtete das vertraute Schlafzimmer, während Jonas aus dem Grauen der Nacht auftauchte. Er drehte sich um und küsste Terrys Hand.
»Alles wieder gut?«, fragte sie.
Er nickte, brachte aber immer noch keinen Laut hervor. »War es wieder derselbe Traum? Der, in dem du unten im Graben bist?«
»Ja.« Jonas ließ sich zurücksinken, sodass seine Frau den Kopf auf seine Brust legen konnte. Er streichelte ihr langes seidenschwarzes Haar, ließ seine Hand dann an ihrem Rücken entlang zu ihrem glatten nackten Po gleiten.
»Es wird einfach nicht besser«, sagte sie. »Du solltest mal mit Dr. Wishnov reden, bevor ich wegen dir ’nen Herzinfarkt bekomme.«
»Posttraumatisches Stresssyndrom. Ich weiß schon, was er mir sagen wird. Er wird mir raten, das Institut zu verlassen.«
»Vielleicht solltest du das wirklich tun. Sich vier Jahre lang mit diesem Monstrum zu beschäftigen würde jedem Albträume verschaffen. Besonders jemandem, der so viel durchgemacht hat wie du.«
Das Läuten des Telefons ließ die beiden zusammenfahren. Sie lächelten sich an. »Ich habe den Eindruck, wir sind beide ein bisschen nervös«, sagte Jonas.
Sie drehte sich um und schmiegte sich an ihn. »Heb nicht ab.«
Jonas zog sie zu sich heran und rieb die Nase an ihrem Hals, während er die Hände über ihre Brüste gleiten ließ.
Das Telefon läutete weiter.
»Verdammt.« Jonas packte den Hörer. »Ja?«
»Doc, hier spricht Manny. Tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber ich glaube, Sie sollten sofort zur Lagune kommen.«
Der Tonfall in der Stimme seines Mitarbeiters ließ Jonas hochfahren. »Was gibt’s?«
»Es geht um Angel. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Wäre wirklich gut, wenn Sie kämen.«
Jonas spürte, wie ihm das Blut in der Kehle pochte. »In 20 Minuten bin ich da.« Er legte auf und sprang aus dem Bett, um sich anzuziehen.
»Jonas, was ist denn los?«
Er wandte sich um. »Manny meint, dass mit Angel irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich muss hin …«
»Ganz ruhig, Schatz. Vielleicht solltest du erst mal was essen; du bist ja noch leichenblass.« Zu Terrys Überraschung hielt er im Ankleiden inne und setzte sich auf die Bettkante, um sie zu umarmen.
»Ich liebe dich«, flüsterte er.
»Ich dich auch. Jonas, sag mir doch, was los ist. Ich spüre, wie du zitterst.«
»Ich weiß es auch nicht. Ich hatte wohl gerade so eine Art Déjà-vu-Erlebnis – als würde mein allerschlimmster Albtraum Wirklichkeit werden.«
Elf Jahre waren vergangen, seit Jonas Taylor zum ersten Mal auf Carcharodon megaladon getroffen war, das grimmigste Raubtier, das je auf Erden gelebt hat. In mehr als zehn Kilometern Tiefe hatte er im Marianengraben, der tiefsten und am wenigsten erforschten Region unseres Planeten, ein Drei-Mann-Tauchboot der amerikanischen Navy gesteuert, die Seocliff. Bei der Letzten der unter strengster Geheimhaltung durchgeführten Tauchfahrten hatte der erschöpfte Aquanaut ins Wasser gestarrt und auf einmal ein unheimliches weißes Leuchten gesehen. Zuerst gebannt von dem, was er zunächst für eine Sinnestäuschung hielt, wurde er dann rasch von Furcht ergriffen, als der lumineszierende torpedoförmige Kopf des 18 Meter langen Weißen Hais aus der Tiefe emporstieg und mit einem dämonischen Grinsen 20 Zentimeter lange Zähne entblößte.
Eine Urangst überkam ihn, und er tat etwas, was sein Leben für immer verändern sollte. Ohne auf die Vorschriften zu achten, hatte er sämtlichen Ballast abgeworfen und das Fahrzeug in rasender Fahrt an die Oberfläche gesteuert. Dabei hatte der rapide Aufstieg zu einem Versagen des Druckausgleichs geführt. Die beiden Wissenschaftler, die sich zusammen mit ihm an Bord des Tauchboots befanden, waren zu Tode gekommen. Jonas’ Karriere als Aquanaut war beendet. Jedenfalls hatte er das damals gedacht.
Innerhalb der folgenden sieben Jahre war Jonas wie besessen davon, der ganzen Welt zu beweisen, dass jenes Lebewesen tatsächlich existierte. Er war wieder auf die Universität gegangen und hatte in Paläobiologie promoviert, während seine damalige, erste Frau ihn finanziell unterstützte. Seine Forschungen über das mysteriöse Verschwinden der Spezies Carcharodon megalodon hatten zu einer umstrittenen Theorie geführt, die er in mehreren Veröffentlichungen ausbreitete. Jonas hatte nämlich die Hypothese aufgestellt, dass viele der prähistorischen Riesenhaie ins wärmere Wasser tief im Marianengraben gewandert waren, um den kalten Temperaturen der letzten Eiszeit zu entgehen. Trotz der wissenschaftlichen Basis für seine Schlüsse hatten Kollegen seine Forschung als reine Fantasie abgekanzelt. An vielen Hochschulen waren seine Publikationen tabu.
Vier Jahre später ergab sich durch Masao Tanaka, einen alten Freund und Mentor, die Gelegenheit zur Rückkehr in den Marianengraben. Der Gründer des Tanaka Oceanographic Institute war allerdings nicht am Megalodon oder an den Thesen über dessen mögliches Überleben interessiert. Masao stand vielmehr im Begriff, eine künstliche Lagune an der Küste von Monterey zu errichten, ein von Menschenhand geschaffenes Habitat zur Beobachtung von Walen. Um das Projekt zu finanzieren, hatte er mit der japanischen Regierung vereinbart, am Grund des Marianengrabens eine Reihe von Apparaturen zur Erforschung seismischer Störungen zu platzieren. Mit einer Anzahl dieser als UNIS – »Unbemannte nautische Informations-Sonden« – bezeichneten Geräte war irgendetwas geschehen, und Masao brauchte Jonas’ Unterstützung, um eines von ihnen zu bergen. Zuerst hatte der einstige Tiefseepilot abgelehnt, weil er seiner Angst nicht ins Auge schauen konnte. Als seine erste Ehe dann aber in die Brüche ging und seine Karriere ins Wanken geriet, wurde der Gedanke, sich irgendwie zu rehabilitieren, einfach zu verführerisch, um länger ignoriert werden zu können.
Außerdem war da auch noch Terry.
Masao Tanakas einzige Tochter war ebenso hübsch wie eigensinnig. Hätte nicht Jonas ihren Bruder D. J. damals in die Tiefe begleitet, wäre sie an seiner Stelle gefahren. So war Jonas also in die Schlucht zurückgekehrt, diesmal in einem Ein-Mann-Tauchboot. Und wieder wollte es das Schicksal, dass sich sein Weg mit dem des Wesens kreuzte, das die Natur zu ihrer vollkommensten Mordmaschine gemacht hatte. Tanakas Sohn war zwischen den Kiefern eines solchen Exemplars zu Tode gekommen. Im Anschluss daran war es einem zweiten – einem riesigen trächtigen Weibchen – gelungen, aus seinem Fegefeuer in der Tiefe zu entkommen. Am Ende war Jonas gezwungen gewesen, das Tier zu töten, das er zunächst hatte retten wollen, und seine Heldentaten waren zur Legende geworden. Zuvor von seinen Kollegen verlacht und verhöhnt, hatte der Paläontologe plötzlich eine glänzende Karriere vor sich und war über Nacht zu einer internationalen Berühmtheit geworden. Er war der Mann, der dem Rachen des Megalodon entronnen war. Talkshows, Fernsehberichte, Reporter – es schien, als wollte jeder in irgendeiner Weise an seinem Erfolg teilhaben, und natürlich einen Blick auf das weibliche Megalodon-Junge tun, das man in der Tanaka-Lagune gefangen hielt.
Jonas und Terry heirateten, und Masao beteiligte seinen Schwiegersohn am Institut. Ein Jahr später hatte das fortan populärste Aquarium der Welt in Monterey seine Pforten geöffnet. Ruhm ist jedoch vergänglich, und obwohl man als Berühmtheit viele Vorteile genießt, wird man auch leicht zum Ziel von Angriffen. Acht Monate nach der Eröffnung der Lagune wurden Jonas und das Tanaka-Institut mit einer 200 Millionen Dollar teuren Sammelklage konfrontiert, eingereicht von den trauernden Hinterbliebenen der Menschen, die den zermalmenden Kiefern des Megalodon zum Opfer fielen. Terry war gerade im fünften Monat schwanger, als der Prozess begann. Das ihn begleitende Medienspektakel stand dem bei O. J. Simpsons Mordprozess in nichts nach.
»Professor Taylor, würden Sie dem Gericht bitte erklären, warum Sie ein derartiges Risiko eingegangen sind, um ein Tier einzufangen, das zuvor als der gefährlichste Räuber aller Zeiten bezeichnet wurde?«
»Es bestanden gute Aussichten, das Megalodon zu bändigen, um es dann zu studieren.«
»Erzählen Sie uns doch bitte, Professor – als es Ihnen tatsächlich gelungen war, das Monstrum zu betäuben und mit einem Netz einzufangen, haben Sie da jemals daran gedacht, es zu töten?«
»Nein. Wir hatten es unter Kontrolle. Es gab keinen Grund …«
»Keinen Grund? Sollte man nicht vielmehr sagen, dass Sie und das Tanaka-Institut einfach eine geschäftliche Entscheidung getroffen haben, das Tier nicht zu töten? Geld, Professor, es ging nur um Geld, nicht wahr? Trotz ausreichender Gelegenheit, die sprichwörtliche Gans zu schlachten, haben Sie es nicht getan, weil Sie an deren goldene Eier wollten. Am Ende hat Ihre Gier unschuldige Menschen das Leben gekostet. Und jetzt verschafft der Nachwuchs des Tieres, durch das die Angehörigen meiner Klienten gewaltsam zu Tode gekommen sind, dem Tanaka-Institut viele Millionen Dollar Profit. Ist das etwa Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit, Professor Taylor?«
Am Ende hatten die Geschworenen eine Schadensersatzhöhe bestimmt, die alle Voraussagen übertraf. Nachdem die Gerichte eine Berufung ablehnten, war das Tanaka-Institut zum Bankrott gezwungen gewesen. Und dann war wie aus heiterem Himmel wieder das japanische Meeresforschungszentrum JAMSTEC auf den Plan getreten, das Masao ursprünglich schon einmal in den Marianengraben gelockt hatte. Es hatte dem Institut einen Weg aus dessen finanzieller Krise angeboten. Besorgt über die zunehmende seismische Aktivität entlang der tektonischen Platten im Westpazifik, gaben die Japaner dem Tanaka-Institut erneut die Chance, ein ganzes Aufgebot von UNIS-Sonden am Grund des Marianengrabens zu platzieren. Der angebotene Vertrag war lukrativ, aber die zu fürchtenden Gefahren, die eine Rückkehr in die Tiefe mit sich brachte, zwangen Masao, sich der Hilfe des milliardenschweren Energiemagnaten Benedict Singer zu versichern. Singer war gerade dabei, eine eigene flotte von Tiefsee-Tauchbooten zu bauen, um die Schluchten der Weltozeane zu erforschen. Man vereinbarte eine Partnerschaft, und Masao blieb nichts anderes übrig, als die alleinige Kontrolle über sein geliebtes Institut aufzugeben. Auf diese Weise erfüllte er den Vertrag mit JAMSTEC, um seine Lagune weiterhin betreiben zu können.
Jonas fuhr an der riesigen Reklametafel vorbei, mit der für das Megalodon geworben wurde: BESUCHENSIEANGEL – DIEPHÄNOMENALSTEMORDMASCHINEDERNATUR. DREIVORFÜHRUNGENTÄGLICH. Er bog in die den Angestellten vorbehaltene Zufahrt ein, winkte dem Wachmann zu und stellte den Wagen auf seinem Parkplatz ab.
Der unheimliche Klang von Basstrommeln drang aus den Lautsprechern der offenen Arena. Jonas sah auf die Uhr. Die Zehn-Uhr-Vorführung musste gleich beginnen.
Von oben wirkte die von Menschenhand geschaffene Tanaka-Lagune wie ein von einem Betonstadion umrahmter ovaler See. Sie war entlang der Küste des Pazifischen Ozeans angelegt. Als Verbindung des gewaltigen Aquariums mit dem Meer diente ein 25 Meter tiefer und 300 Meter langer Kanal, der in der Mitte des westlichen Walls der Lagune begann. Er bestand aus zwei parallel verlaufenden Betonmauern und wurde vom Ozean durch die riesigen Doppelflügel eines stählernen Tores abgeschirmt, das den Star der Lagune an der Flucht hindern sollte.
Als Jonas das ausverkaufte Stadion mit seinen zehntausend Sitzplätzen betrat, verstummte die ungeduldige Menge gerade. Alle Augen und alle Kameraobjektive richteten sich auf die Südseite des Aquariums, wo der annähernd 200 Kilo schwere kopflose Rumpf eines Rindes an einer dicken Kette befestigt wurde, die von einem gewaltigen Gestell herabhing. Irgendwo tief in der 1200 Meter langen Lagune lauerte unsichtbar »Angel«, das Ungeheuer, für dessen Anblick die Besucher ein hübsches Eintrittsgeld bezahlt hatten. Der Augenblick, auf den sie warteten, würde bald da sein. Das Frühstück war angerichtet.
Jonas folgte dem gebogenen Weg um die Arena, bis er die Betonplattform erreichte, auf der die Stahlwinde befestigt war. Als er aufblickte, sah er, wie sein Assistent Manny Vasquez gerade den rohen Fleischberg vorsichtig in die richtige Position über dem ruhigen blauen Wasser schwenkte.
Unter der Plattform befand sich eine Stahltür mit der Aufschrift KEINZUTRITTFURUNBEFUGTE. Jonas bemerkte, dass die den Schließmechanismus schützende Metallplatte teilweise aufgebogen worden war. Verdammte Rowdys … Er machte sich im Kopf eine Notiz, die Tür umgehend reparieren zu lassen; dann schloss er auf, betrat den dumpfigen Treppenaufgang und schlug die Tür hinter sich zu.
Jonas sog die vertraute kühle Feuchtigkeit ein und nahm sich einen Moment Zeit, um die Augen an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Langsam stieg er die beiden Treppen empor. Als er ins Innere des Baus vordrang, wurden die an Voodoo-Trommeln erinnernden Schläge leiser.
Die Treppe führte zu einem unterirdischen Korridor, der halbkreisförmig am Südrand des riesigen Beckens entlangführte. Gespenstische Spiegelungen blaugrünen Lichts erleuchteten den dunklen Gang. Jonas bewegte sich langsam auf die Lichtquelle zu: die fünf Meter hohen und 15 Zentimeter dicken gewölbten Lexanfenster des Aquariums.
Er befand sich jetzt knapp zehn Meter unter der Erdoberfläche und starrte in das kristallblaue Wasser der künstlichen Lagune. Als er aufsah, fiel sein Blick auf ein neu angebrachtes Schild: LEBENSGEFAHR! INANWESENHEITDESMEGALODONNICHTBEWEGEN!
Er drückte eine Handfläche an die Lexanscheibe. Ihre kalte Oberfläche vibrierte von den Unterwassertönen, die ins Becken ausgestrahlt wurden, um die Bestie zur Fütterung zu rufen. Das von dem herabbaumelnden Kadaver tropfende Blut vermischte sich mit dem Wasser, in das Jonas über sich blickte.
Er schloss die Hände ums Geländer.
Tief in der hintersten Ecke des zum Ozean führenden Kanals setzte ein vollkommen weißer, dreieckiger Kopf seine mechanische Pendelbewegung fort. Der Kopf hatte die Größe eines kleinen Hauses. Hin und her schwingend, rieb das Tier sich die kegelförmige Schnauze an den ausgestanzten Löchern des Stahltors wund. Während das Pazifikwasser hereinströmte, saugte das Tier durch die Kopfbewegungen die Gerüche des Meeres in die Nasenöffnungen. Viele Kilometer entfernt zogen Walherden entlang der kalifornischen Küste nach Norden. Das 22 Meter lange Haiweibchen konnte den süßen, erregenden Geruch der Meeressäuger wahrnehmen.
Der tiefe Bass der Unterwassertöne wurde jetzt stärker und stimulierte die hochempfindlichen Zellen entlang der Seitenlinie des Tieres. Die sanften Erschütterungen bedeuteten Nahrung. Der Hai wandte sich vom Tor ab, blieb jedoch in der Tiefe, um dem elektrischen Feld auszuweichen, das von einem im oberen Bereich der Mauer angebrachten Leitungssystem erzeugt wurde. Es sollte den 28 Tonnen schweren Koloss daran hindern, einfach seitwärts aus dem Kanal zu springen.
Als eine gewaltige Welle sich mit zunehmendem Tempo durch die Lagune schob, wurde die Menge unruhig, und als dann endlich die kalkweiße, zwei Meter hohe Rückenflosse erschien und die azurblaue Wasseroberfläche durchschnitt, begannen zehntausend Herzen zu flattern. Die Bewegung des Kolosses ließ vier Meter hohe Wellen über den östlichen Wall des Beckens branden.
Die Flosse verschwand wieder, als der Fisch abtauchte, um in der Tiefe zu kreisen.
Das Publikum stieß einen kollektiven Seufzer aus.
»Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Angel, unseren weißen Todesengel!«
Mit einem mächtigen Rauschen barst die Bestie jäh aus dem Becken. Mörderische Kiefer dehnten sich volle drei Meter weit auf, Reihen von Zähnen, so groß wie Spatenblätter, schoben sich im Zeitlupentempo vor. Einzelne Schreie stiegen aus der Menge auf. Einen schaurigen Moment lang ragte der Vorderteil des Tieres aus dem Wasser, als würde es der Schwerkraft trotzen. Dann packte das Ungeheuer den gesamten Kadaver mit einem einzigen furchtbaren Biss.
Das Gerüst ächzte und bog sich, weil die Bestie ihren riesenhaften Kopf mit unbändiger Kraft hin und her warf, um die Mahlzeit aus der stählernen Klammer zu reißen. Rosarot schäumende Wellen schlugen meterhoch an das Plexiglas, das die Zuschauer abschirmte. Dann löste sich der Kadaver mit einem scharfen Ruck, und der Stahlrahmen bäumte sich zurück, nachdem der gespenstische prähistorische Räuber seine Beute endgültig in Besitz genommen hatte.
Wie hypnotisiert starrte die Menge auf das bleiche Monstrum, das in sein Becken zurückglitt und dann abtauchte. Die sauber abgezupfte Klammer tanzte noch immer am Ende der pendelnden Kette, während die Stahlträger des Gerüsts von der Gewalt der Attacke vibrierten wie eine gigantische Stimmgabel.
Durch die Myriaden von Bläschen und die wirbelnden Rindfleischfetzen hindurch starrte Jonas auf den alabasterweißen Bauch der Bestie, die jetzt ihr Fressen in sich schlang. Die kraftstrotzenden Muskelkontraktionen der Kiefer liefen wellenförmig über Kiemenschlitze und Bauch aus.
Die von dem fressenden Koloss geschaffenen Wellen schlugen ans Fenster und ließen die Lexanscheibe in ihrem Rahmen erzittern. Gebannt beobachtete Jonas den riesenhaften Leib des weiblichen Tieres, das inzwischen noch größer war als seine damals getötete Mutter. Angels ständiger Aufenthalt im sauerstoffreichen Oberflächenwasser hatte unübersehbare Auswirkungen auf ihren Umfang wie auch auf ihren gewaltigen Appetit gehabt. Die gesamte Hauthülle war – wie die ihrer Mutter – von lumineszierendem Weiß; eine genetische Anpassung, die die Vorfahren des Hais durchlaufen hatten, um in der ewigen Finsternis des Marianengrabens Beute anzulocken.
Immer noch reglos starrte Jonas auf seinen Fleisch gewordenen Albtraum. Das seelenlose graue Auge, das er da vor sich sah, kehrte erst wieder in seine normale Lage zurück, nachdem das Ungeheuer seinen letzten Bissen verschlungen hatte.
Das rote Telefon an der Wand läutete. Jonas griff nach dem Hörer.
Das Megalodon hatte die Bewegung offenbar entdeckt, denn es krümmte den Rücken und schob sich vorwärts, um die Schnauze an die Lexanscheibe zu drücken, als wollte es zu Jonas hinüberblicken.
Jonas erstarrte. Er hatte das Tier noch nie so erregt gesehen.
»Hallo? Doc, sind Sie am Apparat?«
Jonas fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach, als Angel sich weiter an das gewölbte Unterwasserfenster drückte und ihn fixierte. Das Lexan begann sich zu biegen.
Jonas rief sich die Worte des Institutsingenieurs ins Gedächtnis. Dass das Lexan sich biegt, ist ganz normal. Flexible Scheiben werden dadurch nur noch fester. Zerbricht das Fenster, schließen sich automatisch die Türen im äußeren Korridor.
Angel presste die Seite ihres massigen Kopfs ans Fenster. Das stahlgraue Auge hatte ihn genau im Blick.
Jonas verspürte einen unheimlichen Schauder. Ganze 15 Zentimeter Lexan trennten ihn vom sicheren Tod. Wenn der Ingenieur nun mit seinen Angaben unrecht hatte? Schließlich hatte man das Becken ursprünglich zur Aufnahme von Walen vorgesehen.
Das Megalodon drehte ab und verschwand in der Lagune, geradewegs auf den Kanal zu.
Jonas zitterte am ganzen Leib und stieß jetzt hörbar die Luft aus. Er lehnte sich an die Wand und versuchte zu ergründen, was sich gerade abgespielt hatte.
»Doc, sind Sie da?«
»Ja, Manny. Tja, mir ist inzwischen klar geworden, was Sie damit meinten, dass unser Mädchen ein bisschen durcheinander ist.«
»Kommen Sie rauf in den Kontrollraum, Chef. Hier gibt es etwas zu sehen, was Sie bestimmt nicht versäumen wollen.«
Jonas verließ den Unterwasserbeobachtungsbereich und ging durch die offene Arena zum Verwaltungsflügel hinüber. Er wartete nicht auf den Aufzug, sondern rannte die Treppe hinauf, wobei er immer zwei Stufen auf einmal nahm. Im zweiten Stock angekommen, stieß er die Doppeltür des Hauptkontrollraums der Lagune auf.
Manny Vasquez stand neben zwei Technikern, die vor einer mit Computern bestückten Schalttafel saßen. Von hier aus konnte man die Umgebung der Lagune überwachen, ihre gesamte Elektronik, ihre Alarm- und Lautsprecheranlage. Über der Schalttafel waren sechs Videomonitore angebracht.
Manny deutete auf ein Unterwasserbild, das auf einem der Monitore zu sehen war. Jonas erkannte den Umriss der gigantischen Torflügel, die den Kanal vom Pazifik trennten.
»Was soll denn da zu sehen sein?«
»Schauen Sie nur weiter hin.«
Jonas starrte auf den Bildschirm. Nachdem gut eine Minute vergangen war, schoss plötzlich ein weißer Schatten an der Kamera vorbei und raste wie ein Lastzug aufs Tor zu. Seine Geschwindigkeit betrug bestimmt an die 100 Stundenkilometer. Der Kopf des Ungeheuers rammte in das geschlossene Doppeltor, dass selbst das Fernsehbild erzitterte.
»Du lieber Himmel – sie attackiert das Tor!«
Manny nickte. »Kein Zweifel, Doc, Ihr Fisch will raus.«
VORBEREITUNGEN
Tanaka-Institut
Sadia Kleffner trat zu den Erkerfenstern des Büros, ließ die Jalousien hochfahren und gab den Blick zum zwei Stockwerke tiefer liegenden schimmernden Riesenaquarium frei. Sie drehte sich wieder um und starrte ihren Arbeitgeber lange an.
»Ist alles in Ordnung, Professor Taylor?«
Jonas sah von seinen Papieren auf. »Ja. Warum?«
»Sie haben dunkle Ringe um die Augen.«
»Ich bin bloß müde. Wären Sie wohl so nett, Mac anzupiepsen; ich muss sofort mit ihm sprechen.«
»Gern, Chef.« Die Sekretärin zog die Doppeltür hinter sich zu.
Zehn Minuten später stürmte James »Mac« Mackreides, ohne anzuklopfen, ins Zimmer. Gut eins neunzig groß, machte der 51-jährige einstige Marineoffizier mit seinem kantigen Unterkiefer, seinem vorschriftsmäßigen Kurzhaarschnitt und seinem muskulösen Oberkörper den Eindruck, als wäre er immer noch im Dienst. Paradoxerweise hatte der rebellische Hubschrauberpilot sich erst nach seiner unfreiwilligen Entlassung aus der Navy dazu entschlossen, sich regelmäßig zu stählen und zu rasieren.
Mac lümmelte sich auf Jonas’ Couch. »Du willst mit mir reden?«
»Wir haben ein Problem, Mac. Das Megalodon versucht wieder, aus dem Kanal auszubrechen. Den ganzen Morgen hat es den Kopf ans Tor gerammt.«
»Und was soll ich dabei tun?«
»Ich arbeite gerade an einem Konzept. Geo-Tech soll das Tor endlich so verstärken, wie wir es schon vor Jahren vorgehabt haben.«
»Und wie viel soll das Ganze kosten?«
»Na, so drei Millionen. Außerdem sollten wir den Laden erst mal ganz dicht machen, um das Megalodon für vielleicht zwei Wochen ganz ruhig zu stellen.«
»Das wird Celeste nie mitmachen. Sie schert sich nämlich einen Dreck um die Sicherheit und das Institut. Teufel auch, es ist jetzt mehr als ein Jahr her, dass Singer sie zur Chefin ernannt hat, aber wie oft hat sie sich überhaupt jemals die Mühe gemacht hierherzukommen?«
»Dann müssen wir die Sache eben selbst in die Hand nehmen.«
»Wie wir’s im letzten Jahr schon besprochen haben?« Mac grinste. »Wird auch allmählich Zeit.«
»Wie lange brauchst du, um die nötige Ausrüstung zusammenzubekommen?«
»Ich nehme jetzt sofort mit meinem Kumpel Kontakt auf. Der Sender dürfte aber kein Problem sein. Nur für die Waffe brauche ich vielleicht ein bis zwei Wochen.«
Die beiden wurden durch die Stimme aus der Sprechanlage unterbrochen. »Professor, Sie möchten bitte sofort zu Masao ins Büro kommen.«
Jonas erhob sich. »Ich werde mit Masao über das Megalodon sprechen, aber der Rest bleibt unter uns.«
Masao Tanaka studierte schon zum dritten Mal ein Telefax, als sein Schwiegersohn das Büro betrat.
»Morgen, Jonas. Setz dich, bitte.«
Jonas fiel sofort der düstere Unterton des alten Japaners auf. »Was ist denn passiert?«
»Ich habe gerade von Benedict Singer die Nachricht erhalten, dass die Proteus im Graben implodiert ist. Vier Menschen sind bei dem Unfall ums Leben gekommen.«
Jonas gerann das Blut in den Adern.
»Singer besteht darauf, dass du sofort mit ihm an Bord der Goliath zusammenkommst. Er schickt einen Privatjet her, der dich nach Guam bringen soll. Dort holt dich dann sein Helikopter ab …«
»Masao, das geht nicht. Ich kann nicht weg. Wir haben hier selbst einen Notfall. Das Megalodon versucht, zu entkommen.«
Masao sog die Luft ein. »Bist du dir da sicher? Ich dachte, das hätten wir schon letztes Jahr erfolgreich überstanden. Nachdem die Wale auf ihrer Wanderung nach Norden vorbeigezogen waren, hat das Tier sich doch wieder beruhigt.«
»Es ist jetzt aber noch mal um einiges gewachsen. Es ist an der Zeit, das Tor permanent zu verbarrikadieren.«
»Willst du das Tor nicht erst einmal einer genaueren Prüfung unterziehen?«
»Doch, und zwar gleich morgen früh.«
Masao schloss die Augen und schien in Gedanken versunken zu sein. »Jonas, heute morgen hat mich Dr. Tsukamoto angerufen. JAMSTEC besteht darauf, dass wir eine eigenständige Untersuchung des Protcus-Unfalls durchführen. Vor allem will man, dass du selbst an Bord der Goliath gehst, um sämtliche Sonaraufzeichnungen des Vorfalls zu analysieren. Wenn wir nicht schleunigst einen Bericht vorlegen, kann das unseren UNIS-Vertrag ernsthaft gefährden.«
»Das darf doch nicht wahr sein!«
Masao öffnete die Augen. »Du solltest jetzt die ganze Tragweite so einer Untersuchung erkannt haben. Kann ich auf dich zählen?«
»Ich sehe ja ein, dass JAMSTEC meine Erfahrung als Tauchbootpilot nutzen will, aber warum besteht denn Benedict Singer darauf, dass ich komme?«
»Keine Ahnung. Er ist ja oft ein bisschen exzentrisch, also hielt ich es für besser, nicht zu genau nachzufragen.«
Jonas schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht weg, Masao. Nicht jetzt.«
»Jonas, niemand verlangt von dir, in die Tiefsee zu fahren. Du sollst dich lediglich an Bord der Goliath mit Singer treffen und die vorliegenden Daten analysieren.«
»Das ist mir schon klar. Trotzdem geht es jetzt einfach nicht.«
»Dir ist doch bewusst, in welch prekäre Lage du mich damit bringst?«
Jonas sah ihm direkt in die Augen. »Ja.«
Masao kam hinter seinem Tisch hervor und legte eine Hand auf die Schulter seines Schwiegersohns. »Ich verstehe, warum du zögerst, Singers Ruf zu folgen. Terry hat mir von deinen Träumen erzählt. Aber irgendwann musst du aufhören, beständig in Furcht zu leben.«
Jonas spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Er stand auf, trat zu den Erkerfenstern, ließ die Jalousien hochfahren und blickte auf die Lagune hinab. »Du willst, dass ich nicht mehr in Furcht leben muss? Dann legen wir doch die Lagune trocken und bringen das verfluchte Monstrum um, bevor es uns noch entkommt. Wenn wir das tun, schlafe ich wesentlich besser.«
Masao schüttelte den Kopf. »Den Hai zu töten ist keine Lösung. Die Dämonen, die dich in deinen Träumen verfolgen, kommen aus deiner Vergangenheit. Je eher du das erkennst, desto eher kannst du in Frieden weiterleben.« Masao setzte sich wieder. »Da du dich aber offenbar weigerst, die Reise zu machen, bleibt mir wohl keine andere Wahl, als an deiner Stelle zu fahren.«
Jonas nickte. »Tut mir leid, Masao.«
Masao sah ihm hinterher.
Eine Stunde später, während er an der Pazifikküste entlangfuhr, dachte Jonas noch immer über Masaos Bitte nach. In den vergangenen vier Jahren hatte sich ihm mindestens ein Dutzend Gelegenheiten geboten, den Marianengraben wiederzusehen. Manche Anfragen liefen darauf hinaus, wieder ein Tauchboot zu führen, sonst sollte er nur in Dokumentarfilmen an Bord eines Schiffs erscheinen. Egal, worum es ging, er hatte immer abgelehnt.
Nach allem, was er durchgemacht hatte, konnte keiner es dem Paläobiologen übel nehmen, dass er Angst vor der Tiefe hatte. Jonas’ Furcht ging jedoch weiter. Kein Psychiater konnte seine Ängste lindern; weder Medikamente noch Hypnose waren in der Lage, seine ständigen Albträume zu unterdrücken. Selbst Masaos inständige Bitte, mit Benedict Singer auf dem Schiff zusammenzutreffen, war angesichts seiner Phobie wirkungslos. Die Wahrheit war einfach: Jonas Taylor war davon überzeugt, es sei sein Schicksal, im Marianengraben zu sterben. Und so elend sein Leben auch geworden war, hatte er nicht die Absicht, diese Theorie auf die Probe zu stellen.
Als er in die Garageneinfahrt seines Hauses einbog, sah er zu seinem Erstaunen ein Taxi am Gehsteig warten. Gerade kam der Fahrer mit zwei Koffern aus der Haustür.
Jonas schob sich an ihm vorbei, als auch schon seine Frau erschien. »Terry, was geht hier vor? Wo willst du hin?«
»Reg dich nicht auf …«
»Wie bitte?«
»Ich fliege mit Masao zu Benedict Singer.«
Zum zweiten Mal an diesem Tag wurde Jonas von seinen Angstgefühlen überwältigt. »Terry, hör mich an. Ich will nicht, dass du fährst. Bitte – können wir wenigstens darüber reden?«
»Was gibt es da zu reden? Du hast meinem Vater schon unmissverständlich klargemacht, dass du dich weigerst hinzufliegen, und das trotz der Tatsache, dass Benedict Singer dich explizit darum gebeten hat.«
Jonas blieb die Wut in ihrer Stimme nicht verborgen. »Hat dein Vater dir vielleicht auch gesagt, warum ich nicht weg kann?«
»Ja, das weiß ich alles. Wir denken aber beide, dass du ein bisschen überreagierst. Wir haben die ganze Sache doch schon letztes Jahr mal durchgemacht. Da hat das Tier eine ganze Woche lang das Tor gerammt und sich dann doch wieder beruhigt.« Sie schüttelte den Kopf. »Jonas, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Du weißt, dass Dad zu alt ist, um solche Reisen noch allein zu unternehmen. Wo ist dein Verantwortungsgefühl? Mein Vater behandelt dich wie seinen eigenen Sohn.«
»Mein Verantwortungsgefühl?« Wut kochte in Jonas hoch. »Ich will dir mal was sagen: Es liegt nur an meinem Verantwortungsgefühl, dass ich überhaupt so lange am Institut geblieben bin.«
»Was soll das wieder heißen?«
»Das heißt, dass ich schon lange aufhören wollte und nur geblieben bin, weil ich wusste, dass Angel zu groß werden würde, um noch problemlos im Zaum gehalten werden zu können. Die Kombination aus sauerstoffreichem Oberflächenwasser und unbegrenzter Nahrung hat ja inzwischen auch dazu geführt, dass sie eine Größe erreicht hat, der sie, wenn sie im Marianengraben aufgewachsen wäre, nicht einmal nahegekommen wäre. Und die Lagune in ihrer jetzigen Form ist einfach nicht dazu angelegt, sie am Ausbruch zu hindern. Irgend etwas muss geschehen, bevor es zu spät ist.«
»Dann flieg doch in den Westpazifik und besprich die Sache mit Benedict Singer. Es ist jetzt sein Hai.«
»Und was ist, wenn er ablehnt?«
»Jonas, das ist nicht deine Sache. Singer ist jetzt der Eigentümer des Megalodon, nicht du.«
»Dann bringe ich das Vieh eben um, bevor es fliehen kann. Soll er mich doch verklagen …«
Terry starrte ihn mit großen Augen an. »Du willst den Hai töten?«
»Besser der Hai als …, besser, als ihn entkommen zu lassen.«
»Jonas, merkst du denn gar nicht, was du da redest? Du bist von der Sache so besessen, dass …«
»Dass was? Dass ich verrückt werde? Los, sprich es nur aus!«
»Jonas, es ist doch irgendwie in Ordnung, dass du etwas Angst hast, bei allem, was du durchgemacht hast.«
»Es ist nicht der Tod, vor dem ich Angst habe, es ist der Gedanke, dich zu verlieren. In meinen Albträumen bist du im Marianengraben. Angel taucht auf …«
»Schluss jetzt!« Terry packte ihn an den Schultern. »Es gibt ’ne wichtige Neuigkeit, Jonas. Du verlierst mich noch tatsächlich.«
Die Worte drangen wie ein Dolch in seine Seele. »Was willst du damit sagen?«
Sie wich seinem Blick aus und fragte sich, wie viel sie ihm gestehen sollte. »Ich bin nicht glücklich, Jonas. Ich habe das Gefühl, dass wir uns auseinandergelebt haben.«
»Terry, ich liebe dich …«
»Ja, aber du verbringst mehr Zeit mit dem verdammten Hai als mit mir. Was ist mit uns geschehen? Die letzten paar Jahre sind die reine Hölle gewesen, und damit meine ich nicht nur, dass ich das Baby verloren habe. Auch wenn wir zusammen sind, bist du mit den Gedanken immer ganz woanders. Was muss ich tun, um das einzige weibliche Wesen in deinem Leben zu werden?«
Jonas schwieg lange, um ihre Worte in sich aufzunehmen. »Du hast recht. Wer möchte schon mit jemandem zusammen sein, der ständig an den Tod denkt?«
»Jonas, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht liebe …« Das Hupen des Taxis unterbrach sie. Sie warf einen Blick über die Schulter. »Ich muss jetzt wirklich los.«
Jonas packte sie am Arm. »Terry, warte doch, bitte! Hör mal zu, es tut mir leid. Ich will dich nicht verlieren. Ich kann mich ändern. Sag mir einfach, was ich tun soll, und das tu ich dann auch.«
Terry wischte sich eine Träne aus dem Auge. »Zuerst mal solltest du einen Termin mit dem Psychiater vereinbaren.«
»Abgemacht. Ich rufe ihn gleich an. Was noch?«
»Ich glaube, es ist an der Zeit, deiner Karriere eine neue Richtung zu geben. Die elf Jahre, die du dich mit diesen Ungeheuern beschäftigt hast, sind genug.«
»Einverstanden. Ich verlasse das Institut. Ich will nur noch dafür sorgen, dass das Megalodon es nie schaffen wird, zu entkommen.«
Sie entzog sich ihm. »Verdammt, Jonas, es ist einfach hoffnungslos mit dir, ist dir das nicht klar?« Sie drängte sich an ihm vorbei und ging aufs Taxi zu.
»Terry, so warte doch …«
»Es gibt nichts mehr zu sagen. Das Flugzeug wartet.« Er ging ihr hinterher. »Versprich mir wenigstens, dass du an Bord der Goliath bleiben wirst.«
»Lass mich in Ruhe. Geh mit Angel spielen.« Er packte sie und riss sie herum. »Terry, bitte …« Wut in den Augen, sah sie ihn an. »Schön. Ich verspreche, dass ich nicht mit Singer in den verfluchten Marianengraben fahre. Aber wenn du dir so viel Sorgen machst, kannst du ja mitkommen.«
»Das geht nicht. Nicht jetzt, nicht dieses Mal …« Der Taxifahrer hupte wieder und rief: »Alles in Ordnung, Miss?«
»Durchaus.« Sie riss sich los und stieg ins Taxi ein, ohne noch einmal zurückzublicken.
BENEDICTSINGER
Westpazifik13 Grad nördlicher Breite143 Grad östlicher Länge
Terry Taylor zwängte sich in den rückwärtigen Teil des Helikopters vom Typ Sikorsky AS-61, wo Masao Tanaka sich auf zwei Sitzen ausgestreckt hatte.
»Trink das, Dad.« Terry drückte ihrem Vater eine Dose Ginger Ale in die Hand, nachdem er sich aufgesetzt hatte. »Fühlst du dich schon etwas besser?«
»Ein bisschen. Ich hasse es, in diesen Dingern zu fliegen. Wie lange brauchen wir noch bis zur Goliath?«
»Der Co-Pilot meint, noch 15 Minuten.«
»Ich war nicht gerade ein toller Reisebegleiter, was?«, fragte Masao.
»Ist schon gut. Du musstest dich ausruhen, und ich brauchte Zeit, um nachzudenken.«
»Sei nicht so kritisch gegenüber Jonas. Er hat viel durchgemacht.«
»Das haben wir alle. Ich glaube, er steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch.«
»Er braucht jetzt deine Liebe und Unterstützung.«
»Ich liebe ihn ja. Ich bin mir bloß nicht sicher, wie viel ich noch ertragen kann. Im Grunde bin ich froh, dass du mich gebeten hast mitzukommen. Ich glaube, Jonas und ich brauchen mal ein wenig Ferien voneinander.«
Masao schüttelte traurig den Kopf. »Übrigens, Celeste wird an Bord der Goliath sein.«
Terry stöhnte. »Da geht er hin, mein Seelenfrieden.«
»Du kannst die Frau nicht leiden?«
»Sie ist mir zuwider. So, wie die umherstolziert und ihr Aussehen zur Schau stellt, könnte man meinen, es wäre 24 Stunden am Tag eine Kamera auf sie gerichtet. Sie behandelt ihre Mitarbeiter wie den letzten Dreck, flirtet aber offen mit jedem Mann, der in ihre Nähe kommt.«
»Dazu gehört auch Jonas, nehme ich an.«
»Besonders Jonas. Warum zum Teufel musste Singer seine russische Geliebte bloß zur Chefin des Instituts machen?«
Masao lächelte. »Singer bezeichnet sie als seinen Schützling.«
»Ich weiß nicht, was sie ist, aber ich kann sie einfach nicht ertragen. Ich hasse Wasserstoffblondinen.«
»Es wäre für alle das Beste, wenn ihr euch bemühen würdet, miteinander auszukommen.«
»Es ist erniedrigend.«
»Versuch es mal. Mir zuliebe.«
»Also gut, ich versuch’s.« Sie blickte aus dem Fenster auf den Pazifik, der wie eine Glasfläche wirkte. »Weißt du, ich freue mich wirklich darauf, Singer kennenzulernen. Wie ist er eigentlich?«
»Singer? Ein wunderbarer Mensch, in Europa aufgewachsen. Ein reicher und mächtiger Mann, der die Kunst der Manipulation perfekt beherrscht. Er spricht fließend ein Dutzend Sprachen, zieht es allerdings vor, seine Gesprächspartner mit Zitaten auf Latein und Französisch zu beeindrucken. Ich finde ihn ein wenig exzentrisch. Vor allem liebt er es ungemein, sich selbst reden zu hören. So mancher könnte ihn sogar für verrückt halten. Wir müssen taktvoll vorgehen, Terry, und sehr diplomatisch. Wir können es uns genauso wenig leisten, ihn zu reizen, wie wir die Forderungen der Japaner ignorieren können.«
»Wie wird er deiner Meinung nach reagieren, wenn wir ihm berichten, dass JAMSTEC damit droht, unseren Vertrag zu kündigen, wenn wir den Unfall der Proteus nicht untersuchen?«
»Das kommt auf uns an. Oft hängt das Ergebnis davon ab, wie man eine Sache präsentiert.«
Der Helikopter legte sich scharf in die Kurve. Als Terry aus dem Fenster sah, erschien gerade ein gewaltiges graues Kriegsschiff unter ihnen.
Die Goliath war ein außer Dienst gestellter sowjetischer Lenkwaffenkreuzer der Kirow-Klasse. Die russische Regierung hatte ihn Geo-Tech Industries im Rahmen eines auf 20 Jahre abgeschlossenen Vertrags zur Verfügung gestellt, um alternative Energieressourcen zu erforschen und gegebenenfalls zu beschaffen. Der Name des Schiffes passte: Mit einer Länge von 248 Metern und einer maximalen Breite von 28 Metern war es das größte Forschungsschiff der Welt.
Mit einem Hybridtriebwerk ausgestattet, nutzte die Goliath nukleare und fossile Energie, um ihre beiden Turbinen und die Zwillingsschraube anzutreiben. Da die Waffensysteme entfernt worden waren, konnte das Schiff eine Geschwindigkeit von 33 Knoten erreichen. Noch wichtiger war aber, dass die Goliath die ausreichende Größe und Kraft hatte, um Geo-Techs gewaltiges Tiefseelabor, die Benthos, zu transportieren und auszusetzen.
Der Sikorsky hüpfte zweimal hoch, bevor er auf dem Hubschrauberlandeplatz am Heck zum Stehen kam. Terry folgte ihrem Vater und dem Kopiloten aus der Kabine. Sie wurden ungeduldig von einer hinreißenden Frau Ende zwanzig erwartet. Sie war tief gebräunt und trug einen weißen, eng anliegenden Body, der ihren athletischen Körperbau sichtbar werden ließ. Langes platinblondes Haar wehte wild im Wind und entblößte hohe slawische Backenknochen.
»Sie sind spät dran«, schrie Celeste dem Co-Piloten durch den Wind entgegen.
»Wir hatten ein paar Turbulenzen …«
»Sparen Sie sich das Gefasel. Sie sind schon spät in Guam abgeflogen. Bringen Sie das Gepäck Ihrer Passagiere ins Gästequartier, und dann runter in die Kantine. Sie haben eine halbe Stunde Zeit zum Essen, bevor Sie wieder starten.«
»Noch heute Abend?«
Celeste drehte dem Mann den Rücken zu, um sich Masao zuzuwenden.
»Sdrawstwuitje, Mr. Tanaka, Sie haben wir gar nicht erwartet. Wo ist Jonas Taylor?«
»Er hat seine bessere Hälfte geschickt«, sagte Terry, die gerade aus dem Helikopter kletterte.
Celestes Augen funkelten wütend. »Benedict wollte unbedingt, dass Jonas kommt. Das wird ihm gar nicht gefallen.«
»Das Megalodon hat wieder das Tor attackiert«, sagte Masao. »Jonas hielt es für nötig, im Institut zu bleiben. Er hat uns gebeten, Ihnen sein ausgearbeitetes Konzept zu überreichen.«
»Na schön. Benedict erwartet uns in seiner Privatkabine.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, marschierte Celeste über das offene Deck des Hecks auf einen stahlgrauen Aufbau aus mehreren Decks und Türmen zu.
Masaos Blick fiel auf zwei leere Plattformen an beiden Seiten des Decks. »Celeste, könnten Sie mir sagen, wozu diese Aufbauten dienen?«
Ohne sich umzuwenden, sagte sie: »Früher wurden sie dazu benutzt, die beiden 100-mm-Geschütze des Schiffs zu tragen. Die Russen haben sämtliche Waffensysteme entfernt, aber als dieses Schiff noch voll ausgerüstet war, war es ein ziemlich fieses Luder.«
Genau wie du, dachte Terry.
Celeste führte die beiden zu einer kurzen Treppe, die auf ein zweites Deck und dann ins Innere des Schiffes führte. Sie folgten einem Korridor bis zu einer Wendeltreppe, über die sie zwei weitere Ebenen emporstiegen, bis sie auf Deck C gelangten.
»Ab hier ist das meiste ausgeschlachtet und neu eingerichtet worden«, sagte Celeste.
Im Gegensatz zu den wasserdichten Gängen, durch die sie gerade gekommen waren, war Deck C zu einem breiten, getäfelten Flur umgestaltet worden. Die Böden waren mit tiefblauem, strapazierfähigem Teppichboden ausgelegt. Das Interieur erinnerte mehr an ein Bürogebäude als an ein Forschungsschiff. Celeste ging auf das Ende des Flurs zu. Sie klopfte kurz, öffnete dann die beiden Flügel einer mit Kirschholz furnierten Tür und winkte die beiden herein.
Benedict Singer hatte ihnen den Rücken zugewandt. Nur die Krone seines kahl rasierten Schädels war hinter der Lehne eines mit braunem Wildleder bezogenen Sessels erkennbar. Terry und Masao setzten sich auf eine dazu passende Couch, die an der Wand stand, und warteten, während der milliardenschwere Chef von Geo-Tech Industries das russisch geführte Geschäftsgespräch beendete.
Singer legte auf und erhob sich, um seine Gäste zu begrüßen.
»Ah, verehrter Meister Tanaka, o genki desu ka?«
Masao lächelte. »Mir geht es gut. Und Ihnen?«
»Ich bin am Leben, was immer noch besser ist als die Alternative. Aber wo ist Professor Taylor?« Den Bruchteil einer Sekunde glitt ein ungehaltener Ausdruck über Singers Gesicht.
»Leider konnte er nicht kommen, aber er hat uns gebeten, Ihnen sein Bedauern zu übermitteln. Das ist meine Tochter …«
»… die schöne Terry Taylor. Bonjour, Madame, wie schön, Sie endlich kennenzulernen.« Singer, der sich offenbar sofort wieder gefangen hatte, nahm ihre Hand und küsste sie mit einer leichten Verbeugung. »Benedict Singer, zu Ihren Diensten.« Seine vergilbten Zähne entblößten sich zu einem Lächeln; sein grauweißer Spitzbart – das einzige Haarbüschel an seinem Kopf – zuckte an den Ecken nach oben.
Terry starrte in dämonische smaragdgrüne Augen, die sich in ihre zu bohren schienen, ohne loslassen zu wollen.
»Sie wundern sich anscheinend über die ungewöhnliche Farbe meiner Augen. Das rührt von einem Arbeitsunfall her, den ich vor ein paar Jahren hatte. Die Kontaktlinsen sind dauerhaft eingesetzt und färben das, was einmal blaue Iris war. Die smaragdgrüne Farbe gefällt mir ganz gut; leider wurden, wie Sie sehen, bei dem Unfall auch meine Wimpern und Brauen so verbrannt, dass sie nie wieder nachwachsen werden.«
Er wandte sich an Masao. »Das Dinner findet erst in einer Stunde statt, und ich dachte mir, wir könnten die Zeit nutzen, uns ein wenig zu unterhalten. Celeste, du hast unseren Gästen noch gar nichts zu trinken angeboten. Ein Gläschen Rotwein vielleicht? Chateauneuf du Pape 1936.«
»Für mich nicht, danke«, sagte Masao.
»Rotwein klingt gut.« Terry beobachtete, wie Celeste zur Bar glitt, und registrierte verärgert, wie sie dabei beiläufig ihren perfekten Körper zur Schau stellte.
»Also, mein Freund, beginnen wir. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir noch alle schockiert von der Tragödie, die der Proteus widerfahren ist. Wir haben vier gute Freunde und geschätzte Mitarbeiter verloren. Einer davon war unser Projektleiter. Wir werden ihn sehr vermissen.«
»Haben Sie irgendeine Ahnung, was da genau passiert ist?«, fragte Masao.
»Das Letzte, was wir hörten, war, wie der Pilot einen Riss im Rumpf meldete. Celeste meint, der Unfall sei eher auf einen Steuerfehler als auf einen Defekt zurückzuführen.«