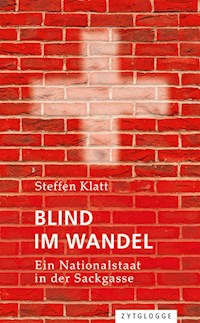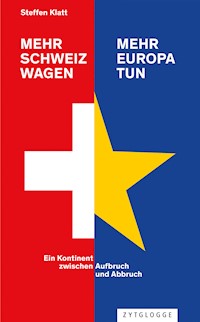
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Schweiz und Europa sind unvorbereitet in die Doppelkrise gegangen, die 2020 mit der Corona-Pandemie begann und sich 2022 mit dem russischen Überfall auf die Ukraine fortgesetzt hat. Europa wird geschwächt durch eine Über-Zentralisierung in Brüssel, die Schweiz durch eine zunehmende Selbstisolierung. Beides, die Zentralisierung der EU und die Selbstisolierung der Schweiz, sind Folgen von Fehlentscheidungen, die bis in die Zeit nach dem Kalten Krieg zurückgehen. Wenn Europa es schafft, seinen Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitbestimmung nach Schweizer Vorbild zu geben, dann hat es gute Karten, im globalen Wettbewerb zu bestehen. Vor einem solchen demokratisierten Europa muss auch die Schweiz keine Angst mehr haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Vorbemerkung: Die schönen Jahre sind vorbei
1. Enttäuschte Erwartungen
1.1. Die Kriege kehren zurück
1.2. Die Wohlstandsmaschine läuft im Leerlauf
1.3. Die Freiheit schrumpft
1.4. Die Grenzen werden wieder sichtbar
2. Der geteilte Westen
2.1. Amerika hat sich verabschiedet
2.2. Die militärische Macht verrottet
2.3. Die Supermachtdividende fließt weiter
2.4. Europa bleibt allein zurück
3. Die entwertete Marktwirtschaft
3.1. Die Finanzmärkte verändern die Hackordnung der Wirtschaft
3.2. Die Monopole sind zurück
3.3. China versucht sich an die Spitze zu kopieren
3.4. Europas Wirtschaft hat ihren Motor verloren
4. Die offene Gesellschaft
4.1. Der Staat verliert sein Fundament
4.2. Die alten gesellschaftlichen Formen lösen sich auf
4.3. Die eine Wahrheit verschwindet
4.4. Der Ich-Kapitalismus drängt in die Marktwirtschaft
5. Experimentierfeld Europa
5.1. Europa testet die Grenzen der repräsentativen Demokratie
5.2. Die Schweiz schafft Stabilität durch Föderalismus und direkte Demokratie
5.3. Das Modell Kleinstaat hat sich bewährt
5.4. Europas Stadtlabor schwächelt
6. Translatio imperii – Die Neuordnung der Welt
6.1. Die Supermacht Amerika droht zu implodieren
6.2. Eine Partei will Supermacht werden
6.3. Die gefallenen Mächte wollen wieder mitspielen
6.4. Das bessere Angebot entscheidet
7. Wende 2.0: Europas zweite Chance
7.1. Die Wende 1.0 ist auf halbem Weg steckengeblieben
7.2. Die Europäische Union hat sich übernommen
7.3. Europa braucht mehr Mitsprache
7.4. Demokratie nach Schweizer Vorbild kann neues Kerneuropa schaffen
7.5. Die Zeit der Nabelschau ist vorbei
Ausblick
Über den Autor
Über das Buch
Steffen Klatt
Mehr Schweiz wagen – mehr Europa tun
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
Kairos-Stiftung, Zürich
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur miteinem Strukturbeitrag für die Jahre 2022–2024 unterstützt.
© 2022 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehalten
Steffen Klatt
Mehr Schweiz wagen – mehr Europa tun
Ein Kontinent zwischenAufbruch und Abbruch
Vorbemerkung: Die schönen Jahre sind vorbei
Zuletzt hat Europa das im August 1914 erlebt: Von einem Tag auf den anderen wurden im März 2020 scheinbar alltägliche Grundfreiheiten aufgehoben und die Grenzen geschlossen – zwischen praktisch allen Ländern und teilweise auch innerhalb von Ländern. Erstmals seit der Liberalisierung des Welthandels und der Einführung des europäischen Binnenmarktes wurden Lieferketten unterbrochen, um die Versorgung einzelner Länder sicherzustellen. Anders als 1914 geschah dies mitten in Friedenszeiten – in dieser Form eine Premiere in Europa. Und kaum schien die Pandemie nachzulassen, da waren auch die Friedenszeiten vorbei: Russland marschierte im Februar 2022 in die Ukraine ein, der erste klassische Überfall auf ein souveränes Land in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Die beiden Krisen hatten nichts miteinander zu tun. Der russische Überfall auf die Ukraine war keine Folge der Pandemie. Die Einschränkung der Grundfreiheiten in der Pandemie wiederum mag richtig und wichtig gewesen sein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen – vielleicht sogar der einzig richtige Weg. Aber diese Doppelkrise markierte eine Zeitenwende. Diejenigen Generationen, welche sie erlebt haben, werden nicht so schnell vergessen, dass Freiheiten von einem Tag auf den anderen aufgehoben, Grenzen geschlossen und die Versorgung infrage gestellt werden können. Und sie werden nicht vergessen, dass Krieg immer noch möglich ist, auch in Europa, und dass ein Staatschef eines mächtigen Landes offen mit dem Einsatz von Kernwaffen gegen seine Nachbarn drohen kann – also mit der nuklearen Vernichtung des Kontinents.
Europa ist schlecht vorbereitet in diese Doppelkrise gegangen, die 2020 begann und 2022 verschärft wurde, und es ist nicht sicher, dass Europa besser aus dieser Krise herauskommt. Auf die Pandemie hat es mit neuen Milliardenausgaben reagiert. Doch die Milliardenausgaben in der einen Krise haben noch nie die nächste Krise verhindert. Auf den russischen Überfall hat Europa ebenfalls mit Milliardenausgaben reagiert, diesmal für die Rüstung. Und es hat der Ukraine Hilfe geschickt, militärische oder humanitäre. Diese Hilfe hat dazu beigetragen, dass die russische Armee die Ukraine nicht in wenigen Tagen oder Wochen überrollen konnte. Aber Europa hat diesen Krieg auf dem eigenen Kontinent nicht verhindern können. Selbst Mitgliedsländer der Europäischen Union und der NATO müssen fürchten, eines Tages in die Schusslinie eines aggressiven Nachbarn zu geraten. Und es ist nicht garantiert, dass die Vereinigten Staaten bis in alle Ewigkeit Europa militärisch zu Hilfe eilen.
Krisen fallen nicht vom Himmel. Sie werden zwar durch irgendein äußeres, scheinbar kaum beeinflussbares Ereignis ausgelöst – in diesem Fall erst durch das Virus und dann durch einen Entschluss des russischen Präsidenten. Aber diese Auslöser können nur deshalb eine solche Wirkung entfalten, weil sie auf eine anfällige Gesellschaft treffen. So auch diesmal: Die Konjunkturindikatoren wiesen schon 2019 auf eine Verlangsamung des Wachstums hin. Die Weltwirtschaft wurde durch einen Handelskrieg zwischen Amerika und China belastet. Gleichzeitig lockerte Amerika seine Bindungen an die früheren Verbündeten in Europa, Großbritannien bereitete sich auf den Austritt aus der Europäischen Union vor. Innerhalb der verbliebenen Europäischen Union hatten autoritäre Bewegungen Zulauf bekommen und in einigen Staaten sogar bereits die Macht gewonnen. Viele Gewissheiten, während Jahrzehnten gepflegt, waren bereits ausgehöhlt, bevor das Virus nach Europa kam und russische Panzer nach Westen rollten.
Im Rückblick wirken die drei Jahrzehnte zwischen dem Ende des Kalten Krieges am Ausgang der 80er-Jahre und dem Ausbruch der Coronakrise wie Europas glückliche Jahre, jedenfalls für den größeren Teil des Kontinents; eine Art historischer Windstille, eine Zeit ohne große äußere Gefahren. Nicht alles im Alltag Europas gefiel, manches ärgerte, und manche ärgerten sich so sehr, dass sie auf die Straße gingen – zuletzt die Klimajugend, davor die Gegner der Einwanderung und lange vorher die der Liberalisierung. Aber die Aufreger des einen Jahres wurden durch die Aufreger des Folgejahres verdrängt.
Das Leben in diesen glücklichen Jahrzehnten wurde allmählich besser, die wirklichen Probleme schienen weit weg zu sein – für die meisten jedenfalls. Die Wirtschaft wuchs, die Beschäftigung auch, die Löhne legten zu, wenn auch nur langsam. Der Konsum wurde nur beschränkt durch den eigenen Kontostand. Die Freiheit schien nicht nur über den Wolken grenzenlos zu sein. Kriege fanden in den Zeitungen statt; Terrorismus war medial präsent, aber selten Teil des eigenen Alltags.
Und doch waren die Zeitgenossen dieser glücklichen Jahrzehnte keine glücklichen Europäerinnen und Europäer. In all den Jahren gab es jenseits einer kleinen Schicht von besonders Mobilen und meist gut Gebildeten kaum Menschen, die laut sagten: «Ich bin ein glücklicher Europäer, ich bin eine glückliche Europäerin.» Am Anfang – gleich nach dem Mauerfall – gab es Optimismus, ja. Aber er war gleichsam ein emotionaler Kredit auf eine glückliche Zukunft, die so nahe schien und dann doch nicht eintreten wollte. Und je länger sich die Jahrzehnte hinzogen, desto mehr verflüchtigte sich dieser Optimismus. Er machte erst Ernüchterung Platz, dann Ärger, dann Gleichgültigkeit. Mit einer Beimischung Angst.
Europa geht es wie dem spanischen Kronprinzen Don Carlos im gleichnamigen Drama von Friedrich Schiller: «Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer», sagt Domingo, der Beichtvater seines Vaters, zu Beginn des Stücks. Er fügt hinzu: «Wir sind vergebens hier gewesen.» Am Ende des Stücks ist Don Carlos tot – aber das muss in einem Drama so sein.
Europas schöne Jahre sind zu Ende. Der Optimismus der späten 80er- und frühen 90er-Jahre ist Geschichte. Von der «Freude, schöner Götterfunken», von der Schiller in der «Ode an die Freude» schreibt, ist im real existierenden Europa nicht viel zu spüren. Die von Ludwig van Beethoven vertonte Europahymne begeistert im Konzertsaal, aber diese Begeisterung findet keinen aufnahmewilligen Nährboden in der europapolitischen Wirklichkeit. Auf die schönen Jahre dürften rauere folgen.
Anders als in Schillers «Don Carlos» muss die Geschichte Europas nicht mit dem gewaltsamen Tod des Titelhelden enden. Doch wenn die Rezepte der schönen Jahre schon unter den vergleichsweise günstigen Umständen der drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges kaum gewirkt haben, dann dürften sie künftig noch weniger bewirken – oder schlicht unbrauchbar sein.
Vielleicht ist es daher an der Zeit zu fragen, was in den drei glücklichen Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Vielleicht lassen sich aus diesen Jahrzehnten Lehren ziehen, wie Europa einer langen Stagnation, einem langsamen Verfall oder gar einem plötzlichen Ende entgehen kann. Denn immerhin bildeten diese drei Jahrzehnte die einzige Zeit in der Geschichte Europas, in der die meisten Länder des Kontinents einander weder feindlich und hochbewaffnet gegenüberstanden noch gar bekriegten. Diese glücklichen Jahrzehnte bildeten die einzige Zeit, in der die meisten europäischen Staaten gemeinsam die Herausforderungen ihrer Gegenwart zu bewältigen versuchten. Sie waren damit nicht immer erfolgreich, aber sie haben es versucht: eine starke Antwort auf die sonst so blutige Geschichte des Kontinents.
Bevor Sie weiterlesen, möchte ich Sie warnen: Dies ist keine akademische Abhandlung über den Zustand Europas. Dies ist nicht einmal eine objektive Darstellung politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Entwicklungen, wie man sie von einem Journalisten erwarten dürfte. Dieses Buch ist subjektiv und gibt nur die Gedanken des Autors wieder.
Dieses Buch ist geprägt von dem, was ich erlebt habe, erst in den 80er-Jahren in der Endzeit der DDR, dann ab den 90er-Jahren als Journalist in der Schweiz, darunter einige Jahre in Brüssel als Korrespondent bei der Europäischen Union. Es ist geprägt von Kindheit und Jugend in einer alternden Diktatur, vom Rausch des plötzlichen Wandels und dann vom Leben in einem Land, das in vielerlei Hinsicht wie das perfekte Kontrastprogramm zur rigiden, autoritären und ziemlich heruntergekommenen DDR wirkt.
Dieses Buch ist auch geprägt – ein Privileg des Journalisten – vom Blick in die Innenräume der Politik, von der kleinen Gemeinde über regionale Machtzentren bis in das politische Zentrum Europas rund um den Schuman-Kreisel in Brüssel. Die wichtigste Erfahrung in Brüssel war nicht die Nähe zur Macht und zu den Mächtigen, sondern die tägliche Erfahrung der Vielfalt dessen, was Europa ausmacht. Alle, die in das Europäische Viertel in Brüssel kamen, schienen einen anderen Blick auf Europa zu haben und andere Wünsche, Erwartungen oder Ängste mitzubringen. Es gibt nicht das eine Europa, dieses ändert sich vielmehr mit den Sichtweisen der Betrachter. Europa gibt es nur im Plural.
Das bedeutet auch, dass Europa nicht mit wohlmeinenden Appellen beizukommen ist. Die verschiedenen Akteure in Europa handeln nicht aus gutem Willen oder böser Absicht so, wie sie handeln. Was sie tun, ergibt aus ihrer Interessenlage heraus Sinn. Das gilt gleichermaßen für Euroskeptiker wie Euroturbos und alle dazwischen, für hochgebildete Eurokraten in Brüssel und überzeugte Europäer in Aachen ebenso wie für Wutbürger in Ostdeutschland und Beitrittsgegner in der Schweiz. Alle diese Akteure, alle Europäerinnen und Europäer sind geprägt von ihrem Herkommen und von den Umständen ihres Lebens.
Ich selbst mache da keine Ausnahme: Aus der Endzeit der DDR trage ich vermutlich noch heute jene Erwartungen mit, die ich – und mit mir viele andere – an die Wende gehabt habe. Es ist wahrscheinlich ungerecht, Europa heute an diesen Erwartungen von damals zu messen. Dabei waren sie ganz simpel: Frieden, Wohlstand, Freiheit. Das offizielle Europa würde vermutlich für sich in Anspruch nehmen, genau das gebracht zu haben. Und doch fühlten sich bereits die Jahre vor dem Coronaschock wieder ganz ähnlich an wie die späten 80er-Jahre – als ginge es nicht mehr lange so weiter, als stände wieder eine Zeitenwende bevor. Diese Zeitenwende hat begonnen. Die Welt wird neu geordnet, nicht zwingend zum Besseren.
Auch meine Jahre in der Schweiz prägen meinen Blick auf Europa. Direkte Demokratie ist hier Alltag; die Bürgerinnen und Bürger gehen mit ihr verantwortungsbewusst um; das Wissen um die politischen Abläufe und die Inhalte dessen, worüber sie abstimmen, ist groß. Die Schweiz ist längst jene multikulturelle Gesellschaft, von der Europa noch nicht weiß, ob es sie je werden will; zwischen Bodensee und Genfersee werden fast alle Sprachen der Welt gesprochen, Mehrsprachigkeit ist Alltag bis in viele Familien hinein. Gesellschaftlich ist die Schweiz eine Welt im Kleinen, geradezu ein Multikultimusterland. Umso überraschender ist auf den ersten Blick die stete und starre Ablehnung der Europäischen Union durch die politische Schweiz, der Hang zur Selbstisolierung des Landes.
Vielleicht werde ich vom eigenen biografischen Zufall getäuscht, jenem Ausgangspunkt in der DDR und der langen Ankunft in der Schweiz: Aber in der Rückblende wirkt die Wende von 1989 wie eine halbe Wende, ausgebremst und steckengeblieben; viele der heutigen Schwierigkeiten Europas erscheinen als Folgen der Fehlentscheidungen von damals. Die vermutlich zentrale Entscheidung jener Jahre war die Gründung der Europäischen Union als derjenigen politischen Form, in welcher die Wiedervereinigung des Kontinents stattzufinden hatte.
Von der Schweiz aus gesehen wirken viele Fehler in Europa vermeidbar: Wenn die Entscheidungen so nahe wie möglich bei denen gefällt werden, die von ihnen betroffen sind, und die Bürgerinnen und Bürger selbst diese Entscheidungen fällen, dann wird es Europa schnell besser gehen. Und wenn Europa dann noch die Selbstisolierung vermeidet, aus welcher die Schweiz scheinbar nicht herausfinden kann, dann sollte dem Glück des Kontinents nichts mehr im Wege stehen – außer natürlich, dass jedes Glück nur flüchtig ist.
Der Titel des Buches ist nicht besonders originell. Der eine Teil – «Mehr Schweiz wagen» – ist eine Anspielung an jenen Satz aus der Regierungserklärung von Willy Brandt: «Wir wollen mehr Demokratie wagen.» Dieser Satz wurde schon von anderen mit der Schweiz in Verbindung gebracht. So warb die deutsche Linke 2013 mit dem Spruch «Mehr Schweiz wagen» für sich, nachdem eine Schweizer Volksabstimmung überrissene Managergehälter eingeschränkt hatte. Auch rechte Populisten bedienten sich der Schweiz für ihre politischen Botschaften: 2014 schwenkte ein Abgeordneter der rechtspopulistischen italienischen Lega die Schweizerfahne im Europaparlament; er begrüßte die Beschränkung der Einwanderung durch eine weitere Schweizer Volksabstimmung.
Die Schweiz hält als Projektionsfläche durchaus unterschiedlicher Ansichten her. Sie hat auch ein paar Einsichten zu bieten, die über den Nutzen und die Gefahren von Volksabstimmungen hinausgehen. Wenn ein Land mit einer derartigen inneren Vielfalt seit fast zwei Jahrhunderten ohne Krieg und Bürgerkrieg durch turbulente Zeiten gekommen ist und dabei stets zu den wohlhabenderen Volkswirtschaften der Welt gehört hat, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
Der andere Teil des Titels – «mehr Europa tun» – ist eine Plattitüde, wie sie sich für gewöhnlich in Sonntagsreden von Politikern findet. Es geht mir dabei nicht um das Europa der Institutionen in Brüssel. Wie aus dem Buch deutlich werden dürfte, sehe ich in ihnen einen der wichtigsten Gründe dafür, warum dieser Kontinent seine schönen Jahre so ergebnisarm verschleudert hat und so unvorbereitet in diese Doppelkrise geschlittert ist.
Europa ist mehr als die Institutionen in Brüssel. Es ist der gemeinsame Raum vieler Länder – ob sie sich als Willensnation verstehen wie die Schweiz oder als Mutterland der Menschenrechte wie Frankreich oder als sprachlich und konfessionell geprägte Nation wie Polen oder ob sie Mühe haben mit sich selbst als Nation wie Deutschland. Die Grenzen zwischen den Lebenswelten der Europäerinnen und Europäer sind längst fließend geworden, nur noch sehr wenige von ihnen leben einen Alltag ganz ohne Europa. Europa ist der Echoraum unseres Lebens.
Es geht in diesem Buch nicht darum, ob die Brüsseler Institutionen versagt haben. Das heutige politische Europa ist nicht die beste aller möglichen Welten, aber es ist die beste Welt, in der dieser Kontinent je gelebt hat. Es geht darum, dass bereits der Bauplan dieser Institutionen verfehlt war. Und es geht um die Frage, ob Europa eine Zukunft hat, und zwar eine selbstbestimmte. Dafür muss sich dieses Europa von dem Wahn befreien, dass nur wenige Erwählte in Brüssel und einigen nationalen Hauptstädten den Kontinent gestalten und führen können. Europas Wahlspruch «In Vielfalt geeint» hat zwei Bestandteile – Vielfalt und Einheit. Mehr Europa tun, das heißt auch, der Vielfalt Europas mehr Platz einräumen.
Mehr Schweiz und mehr Europa, das ist kein Widerspruch. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Mehr Schweiz im Sinne der direkten Demokratie und des Föderalismus stärkt Europa. Mehr Mitbestimmung für die Europäerinnen und Europäer macht ein geeintes Europa politisch erst möglich.
«Mehr Schweiz»: Das hat auch die Schweiz nötig – mehr Europa ohnehin. Die Zentralisierung der Schweizer Politik auf der Ebene des Bundes in den vergangenen drei Jahrzehnten hat die tatsächliche Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt und die Macht kleiner Gruppen gut vernetzter Politiker gestärkt. Die Schweiz hat sich durch diese Zentralisierung im Namen eines moderaten Nationalismus Schritt für Schritt selbst geschwächt. Sie muss aufpassen, dass ihre Selbstisolierung ihr nicht eines Tages die Luft zum Atmen nimmt. In die Doppelkrise von Pandemie und Rückkehr der Kriege ist das Land ebenso unvorbereitet geschlittert wie der Rest Europas.
1914 sind in Europa die Lichter für viele Jahrzehnte ausgegangen. Sie gingen nicht wieder an, nur weil der eine oder andere Krieg beendet wurde. Sie gingen erst wieder an, als die Menschen in Europa gelernt hatten, miteinander zu leben, statt gegeneinander zu kämpfen.
Auch die Folgen der Doppelkrise von Coronapandemie und russischem Einmarsch in die Ukraine werden nicht dann beseitigt sein, wenn der eine oder andere Krieg beendet sein wird. Im Gegenteil: Kriege können unabhängig von ihrem Ausgang den Ruf nach starken Männern lauter werden lassen und damit die bereits kräftigen autoritären Tendenzen verstärken.
Die Folgen der Doppelkrise werden vielmehr dann bewältigt sein, wenn Europa gelernt haben wird, alle seine Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen über ihre Angelegenheiten zu beteiligen, statt diese Entscheidungen einigen wenigen zu überlassen. Europa hat die Wahl zwischen diesem demokratischen Aufbruch und einem autoritären Abbruch.
Es ist im Interesse aller Europäerinnen und Europäer, ein zweites dunkles Jahrhundert zu vermeiden.
1.Enttäuschte Erwartungen
Die Euphorie der Wendezeit war groß. Der «Wind of Change» blies von Osteuropa aus über den Rest der Welt, scheinbar jedenfalls. Die Zukunft würde besser sein als die Vergangenheit. Sie wäre auch gestaltbar: Hatten nicht gerade Millionen Osteuropäer gezeigt, dass sie mit friedlichen Mitteln hochbewaffnete Sicherheitskräfte, Mauern und Stacheldraht überwinden konnten? Es gab nicht viele, die sich dieser Euphorie entziehen konnten, in Osteuropa ohnehin nicht, aber auch nicht anderswo. Und es gab nicht viel, was nicht machbar schien mit dieser Energie der Millionen. Die Welt schien im Aufbruch.
Die Wende war ein osteuropäisches Ereignis. Der Zusammenbruch des Sowjetblocks mit dem Mauerfall 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion 1991 als den Höhepunkten war hausgemacht. Der real existierende Sozialismus hatte versagt, seine Bürgerinnen und Bürger – von den Mächtigen eher wie Untertanen behandelt – hatten das gemerkt und die Verantwortlichen in Rente geschickt. Der Westen war in diesem Umbruch nur Zuschauer, überrascht und zugleich verunsichert, denn auch seine Welt wurde infrage gestellt.
Der Westen hatte durchaus Erwartungen geweckt, direkt und indirekt. Diese Erwartungen hatten dazu beigetragen, dass die Osteuropäerinnen und Osteuropäer ihre Regierenden herauszufordern wagten. Die direkt geweckte Erwartung: Westen ist gleich Freiheit.
Die vielleicht wirkungsvollste Erwartung: Wohlstand. Diese Erwartung wurde geweckt durch die Bilder im Westfernsehen, durch die Touristen aus dem Westen, durch die staatlich betriebenen Geschäfte, in denen Ostbürger für Westgeld Waren kaufen konnten, die es im Osten nicht oder nicht genug gab. Der Wohlstand des Westens war das Prinzip Hoffnung, ausgepreist in D-Mark.
Nicht unmittelbar mit dem Westen, aber mit dem Ende des Kalten Krieges war die Erwartung verbunden, dass nun der Frieden ausbräche, ohne Hochrüstung, Atomraketen, Angst vor dem nächsten Weltkrieg. Denn das alles bräuchte es nicht mehr, wenn sich die beiden Supermächte nicht mehr feindlich gegenüberständen. Ende des Kalten Krieges gleich Beginn des ewigen Friedens, so die einfache Formel.
Es ist ungerecht, den Westen an den einstigen Erwartungen zu messen: Jeder Mensch ist für seine Erwartungen selbst verantwortlich, jeder hofft auf eigenes Risiko. Und doch prägt es unser Bild von den anderen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen, die wir an sie gerichtet haben.
1.1.Die Kriege kehren zurück
Diese Ungerechtigkeit beginnt bei der Frage nach Krieg und Frieden: Der Westen hat nie den ewigen Frieden versprochen. Genauer betrachtet, hat er während des Kalten Krieges – der ja nur in Europa kalt war – ähnlich viele oder mehr heiße Kriege geführt, die ähnlich viele oder mehr Menschenleben gekostet haben als die heißen Kriege, welche die Sowjetunion und ihre Verbündeten angezettelt haben. Der Westen hat in diesen Jahrzehnten ebenso blutige oder blutigere Diktaturen unterstützt als der Osten. Und der Westen hat ähnlich viele Massenvernichtungswaffen angesammelt wie der Osten, jede Seite hätte die andere im Ernstfall sehr effizient pulverisieren können. Wir leben nur, weil dieser Ernstfall nicht eingetreten ist. Einen überbordenden Pazifismus kann man dem Westen nicht vorwerfen.
Der Westen hatte aber das Glück, dass nach dem Ende des Kalten Krieges dennoch so etwas wie der Anschein des Ewigen Friedens ausbrach. Die Jugoslawienkriege mit zehntausenden Toten und hunderttausenden Vertriebenen ebenso wie die Kriege, die auf den Zerfall der Sowjetunion folgten, in Abchasien, Bergkarabach, Südossetien, Transnistrien, Tschetschenien, konnten noch auf das «kommunistische Konto» schlechtgeschrieben werden – Folgeerscheinungen des Zerfalls eines überholten Systems. Im Rest Europas musste während eines Vierteljahrhunderts niemand damit rechnen, wieder einen Krieg zu erleben.
Außerhalb Europas galt das nicht. Sofort nach dem Mauerfall begann der erste Irakkrieg Amerikas, provoziert vom irakischen Diktator Saddam Hussein mit seinem Einmarsch in Kuwait. Später folgte der zweite Irakkrieg, nicht provoziert von Saddam Hussein – Russlands Präsident Wladimir Putin ließ sich vom zweiten Irakkrieg Amerikas für seinen Überfall 2022 auf die Ukraine inspirieren. Dazu kamen Kriege in Afghanistan – mit der Beteiligung praktisch aller westlichen Staaten –, Eritrea, Osttimor, Somalia, Südsudan. Dazu Ruanda mit dem versuchten Völkermord an den Tutsis, der unter den Augen von westlichen UN-Truppen stattfand. Dazu die Fortsetzung in Ostkongo, wo niemand mehr zuschaute. Außerdem die vielen kleinen und größeren Bürgerkriege etwa in Jemen und Syrien oder gegen Minderheiten in Myanmar oder Drogenkriege in Kolumbien oder Mexiko.
Über die ganze Welt gesehen war das Vierteljahrhundert des Ewigen Friedens nicht gewaltärmer als die meisten Zeiten zuvor, die beiden Weltkriege ausgenommen. Doch selbst der Anschein des Ewigen Friedens endete 2014. Beendet wurde er durch ein Ereignis, das zumindest in seiner ersten Etappe keinen hohen Blutzoll verlangte: Die Besetzung der Krim durch russische Truppen traf die neue ukrainische Regierung unvorbereitet, den Westen, der diese Regierung unterstützte, ebenfalls. Der nachfolgende russische Einmarsch in der Ostukraine, als Aktion lokaler Freischärler ausgegeben, kostete bereits tausende Menschenleben, zerstörte eines der einstigen industriellen Zentren der Sowjetunion und schuf einen weiteren jener eingefrorenen Konflikte, mit denen Russland seine Nachbarn im Zaum hält und die es nach Belieben auflodern lassen kann.
Russlands Präsident Wladimir Putin konnte sich nach dem Anschluss der Krim 2014 als Sieger feiern lassen. Doch der äußere Erfolg verdeckte einen strategischen Fehler: Putin hatte ein paar Quadratkilometer Land gewonnen, aber die Ukraine verloren. Seit dem Zerfall der Sowjetunion war das große Land hin- und hergependelt zwischen der Hinwendung nach Europa und der Rückwendung zu Russland. Mit dem Anschluss der Krim an Russland war die Entscheidung gefallen – zugunsten des Westens. Wollte Putin die Ukraine doch noch in sein Reich holen, musste er nun in den Krieg ziehen – was er 2022 dann auch tat.
Aber auch für den Westen war es dumm gelaufen. In den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges hatte es lange so ausgesehen, als sei Russland ein Partner des Westens, ein Land auf dem Weg in die Demokratie und die Marktwirtschaft. Selbst als sich der Ende 1999 an die Macht gekommene neue Präsident Wladimir Putin langsam vom Westen löste, tat er dies auf weltpolitischer Ebene zunächst gemeinsam mit Frankreich und Deutschland: Putin führte im Schulterschluss mit Jacques Chirac und Gerhard Schröder den Widerstand gegen den amerikanischen Einmarsch in den Irak 2003 an.
Nun, mit dem Anschluss der Krim an Russland, hatte der Westen einen geopolitischen Partner verloren. Politisch hat er in dieser Neuauflage des Kalten Krieges die Oberhand. Die Ostgrenze der NATO liegt nicht mehr an der Elbe und der Adria, sondern kurz vor Petersburg und an der Mündung der Donau in das Schwarze Meer. Moskaus Reich dagegen war auf Russland geschrumpft, eine der 15 Teilrepubliken der einstigen Sowjetunion – wenn auch die größte und diejenige, die das sowjetische Kernwaffenarsenal geerbt hatte.
Militärisch waren die Kräfteverhältnisse bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 nicht so eindeutig. Die Osterweiterung der NATO war nicht mit einer Ostverschiebung ihrer militärischen Kapazitäten einhergegangen. Wenn Russland die baltischen Republiken in einem Blitzkrieg hätte besetzen wollen, hätte der Westen kaum Chancen gehabt, Verstärkung zu bringen. Warschau liegt in Reichweite eines russischen Vorstoßes aus seiner Exklave Kaliningrad, dem ehemaligen nördlichen Ostpreußen um Königsberg.
Der Ukrainekrieg hat das militärische Kräfteverhältnis in Europa zu Ungunsten Russlands verändert: Die russische Armee erwies sich als unfähig, einen deutlich schwächeren Nachbarn zu besiegen, während die NATO ihre Ostflanke aufzurüsten begann. Damit ähnelt der zweite Kalte Krieg zunehmend auch militärisch dem ersten: Zwei nuklear aufgerüstete Machtblöcke stehen sich misstrauisch gegenüber und bekämpfen einander in Stellvertreterkriegen. Anders als im ersten Kalten Krieg finden diese Stellvertreterkriege auch in Europa statt.
Die wichtigste Folge des strategischen Fehlers von Putin 2014 liegt allerdings außerhalb Europas: Der russische Präsident hat sein Land in eine strategische Abhängigkeit von China geführt. Er konnte sich eine Konfrontation selbst mit einer damals schwächelnden NATO nur leisten, weil er Russlands Achillesferse geschützt wusste: die dünn besiedelten Gebiete in Sibirien und im Fernen Osten. Putin scheint sich dessen von Anfang an bewusst gewesen zu sein: Die Hinwendung Russlands zu China ab 2013 und die Annexion der Krim gingen Hand in Hand.
Russland und China haben freilich in dieser Hinsicht komplementäre Interessen. Die Großmacht im Fernen Osten will zur neuen Weltmacht aufsteigen. Dazu braucht es ebenfalls einen freien Rücken, also ein wohlgesinntes Russland in seinem Norden.
Die beiden Mächte ergänzen sich, zumindest vorerst. Beide sehen sich durch Amerika und seine Verbündeten eingeengt, Russland durch die Osterweiterung der NATO, China durch die Präsenz Amerikas an seinen Grenzen: Amerikanische Truppen stehen auf Okinawa wenige hundert Kilometer vor der chinesischen Küste und in Südkorea. Amerika rüstet Taiwan auf, aus chinesischer Sicht eine abtrünnige Provinz. Chinas Aufstieg zur Weltmacht führt über eine Konfrontation mit Amerika.