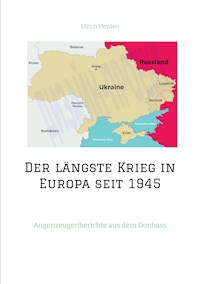19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Seit 30 Jahren lebt und arbeitet Ulrich Heyden in Russland, einem Land, das sein Vater als Wehrmachtsoffizier überfallen hat. Die gänzlich unterschiedliche Wahrnehmung Russlands, dargestellt in der Familiengeschichte des Autors, zieht sich als roter Faden durch das Buch. Dazu kommt die Frage, wie es passieren konnte, dass ein großer Teil der systemoppositionellen 68er sowie die ehemals pazifistische Partei "Die Grünen" zu den stärksten Befürwortern eines Kriegsgangs gegen Russland wurden. Nach jugendlichen Ausbruchsversuchen aus einer konservativen Familie dockt Heyden in einer linken "K-Gruppe" an, arbeitet in Hamburger Metallbetrieben, erlebt den Abgesang der 68er und entscheidet sich, Deutschland zu verlassen und als Journalist in der Ukraine und Russland zu arbeiten. Bereits seine erste Reise in die Sowjetunion Anfang der 1980er-Jahre fasziniert Heyden. Trotz Schocktherapie unter Boris Jelzin und dem Tschetschenienkrieg bleibt er in Russland … und bewundert, wie die einfachen Menschen ihr Überleben im Alltag selbst organisieren. Seit 1992 ist Heyden als Journalist in Moskau tätig. 2001 wird er Moskau-Korrespondent der Sächsischen Zeitung, die ihn aber nach zwölf Jahren Zusammenarbeit in der Hochphase des Kiewer Maidan, über den der Autor skeptisch berichtet, kündigt. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, die nach Meinung des Autors durch eine falsche Politik des Westens provoziert wurde, beendet auch der Freitag, für den er 30 Jahre lang tätig war, die Zusammenarbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Ähnliche
Ulrich HeydenMein Weg nach Russland
Erinnerungen eines Reporters
© 2024 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-915-2(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-528-4)
Lektorat: Katrin McClean
Coverfoto : Swetlana Heyden
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Ulrich Heyden, geboren 1954 in Hamburg, wurde von 1974 bis 1980 als Metallflugzeugbauer ausgebildet und arbeitete in Hamburger Metallbetrieben. Von 1981 bis 1991 Studium der Volkswirtwirtschaft und der Mittleren und Neueren Geschichte in Hamburg. Seit 1992 freier Korrespondent in Moskau, u.a. für der Freitag, Die Presse, Sächsische Zeitung und Deutschlandfunk.
»Wenn Armageddon donnert,wenn so viele Pfeile des Hasses, der Trennung,der Zerstörung, der Zersetzung den Raum durchdringen,sollten wir dann nicht jedenFunken der Freundlichkeit schützen?Wenn die höchsten Begriffein Unwissenheit verunglimpft werden,sollten wir nicht alle heiligen Lampenan den Herd des Geistes bringen?Wenn Lügen und Aberglaube versuchen,alles Reinste zu verschmutzen,nur um das Feld des Chaos zu vergrößern,sollten wir nicht in den besten Chronikennach Beweisen für wirkliche Zusammenarbeit suchen?«
Nikolai Rerich, Himavat, 1946Nikolai Rerich (1874−1947) war ein berühmter russischer Maler und Philosoph, der viele Jahre in Indien lebte.
Vorwort
Die grüne Spitzenpolitikerin und spätere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock machte im Mai 2021 eine bemerkenswerte Äußerung zur deutschen Geschichte. Auf dem EU–US Future Forum des Thinktanks Atlantic Council erinnerte1 sie an ihren Opa Waldemar, der im Winter 1945 als Wehrmachtsoffizier östlich der Oder gegen die Rote Armee gekämpft hatte. Weiter erklärte Baerbock, die Generation ihres Opas habe später dazu beigetragen, dass einst verfeindete Länder – wie Polen und Deutschland – nun in Frieden und Freundschaft leben können.
Dass ihr Opa, Waldemar Baerbock, als Offizier an einem deutschen Angriffskrieg beteiligt gewesen war, bei dem 27 Millionen Bürger der Sowjetunion getötet wurden, erwähnte die grüne Politikerin in ihrem Auftritt vor dem Atlantic Council mit keinem Wort. Baerbock zog mit der Äußerung über ihren Opa einen Schlussstrich unter die Verbrechen, welche die deutsche Wehrmacht und die SS in der Sowjetunion verübten. Leider folgten auf Baerbocks Rühr-Geschichte über ihren Opa keine kritischen Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit, von einigen linken Kommentatoren abgesehen.
Dass in den großen deutschen Medien ab Februar 2022 die Erinnerung an den von Deutschland am 22. Juni 1941 begonnenen Angriffskrieg gegen Russland komplett beiseitegeschoben wurde, brachte mich auf den Gedanken, am Beispiel der eigenen Familie nachzuzeichnen, wie mit diesem Ereignis in der deutschen Nachkriegszeit umgegangen worden war. Ich stöberte in Tagebüchern, Briefen und privaten Dokumenten und begann mich an fast Vergessenes zu erinnern.
Je tiefer ich grub, desto komplizierter wurde es. Bei meinem Vater, der als Offizier einer Aufklärungseinheit im Winter 1941 bis auf 147 Kilometer an Moskau herangekommen war, stieß ich auf ein verworrenes Gemisch aus Dämonisierung und »Russland-Liebe«. Er verehrte nicht nur die russischen Zaren. Er hatte auch einen Kupferstich vom Kreml im Wohnzimmer hängen und er idealisierte das bäuerliche russische Leben mit großen, fruchtbaren Feldern.
Beim Durchforsten von Dokumenten und Erinnerungen wurde mir klar: Die Rotarmisten, gegen die mein Vater kämpfte – viele von ihnen einfache Bauernsöhne –, nahm er nicht als Menschen, sondern nur als graue Masse wahr. Er interessierte sich nicht dafür, was das für Menschen waren, wo ihre Angehörigen lebten und was diese Angehörigen an Ängsten durchstanden. Nur durch diese Anonymisierung gelang es ihm, das Gefühl, Menschen gegenüberzustehen, wie er selbst einer war, abzutöten.
Die Anonymisierung war möglich geworden durch Nazi-Propaganda, die sowjetische Soldaten als unberechenbar, wild und dem deutschen Volk feindlich gesonnen dämonisierte. So kam es, dass mein Vater in der Lage war, auf gleichaltrige Rotarmisten zu schießen, ohne danach in Gewissensqualen zu zergehen.
Eine Dämonisierung der russischen Soldaten erleben wir auch heutzutage im deutschen Fernsehen. In der ZDF-Sendung »Markus Lanz«2 erklärte die Politikwissenschaftlerin und stellvertretende Direktorin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien, Florence Gaub, im April 2022: »Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind – im kulturellen Sinne.« Russen hätten einen anderen Bezug zu Gewalt und Tod. »Es gibt (bei Russen) nicht diesen liberalen und postmodernen Zugang zum Leben. Das Leben als ein Projekt, das jeder für sich individuell gestaltet. Sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem Tod recht früh enden.« Starker Tobak, aber sowas darf eine »Expertin« heute in einer Talkshow sagen, ohne dass der Moderator ihr ins Wort fällt.
Und wie ging es bei uns zuhause zu, als ich klein war? Zum sonntäglichen Frühstück – im Hintergrund spielte meist Musik von Johann Sebastian Bach – schilderte mein Vater uns Kindern in ergreifenden Geschichten, wie heldenhaft er furchtbare Schlachten in Weißrussland und Russland durchgestanden hatte. Wir fieberten mit ihm. Aber Kriegsbegeisterung lösten seine Erzählungen bei uns Kindern nicht aus, eher im Gegenteil. Erst als ich erwachsen wurde, fiel mir auf, dass die Vernichtung der Juden in der Sowjetunion und das Schicksal der sowjetischen Zivilbevölkerung in den Erzählungen meines Vaters nicht vorkamen. Alle Fragen in diese Richtung übertünchte er mit der Parole, man habe Russland »vom Bolschewismus befreien« wollen. Den Angriffskrieg gegen die Sowjetunion verurteilte er nie. Er gestand nur ein, dass Hitler und seine Generäle beim »Unternehmen Barbarossa« taktische Fehler gemacht hatten.
Die Kriegszeit war im Leben meines Vaters das stärkste emotionale Erlebnis. Diese Zeit als Zwanzigjähriger galt für ihn als Maßstab, an dem er alles maß: Mut, Ausdauer, Kälte, Schmerz, Kameradschaft, Todesangst.
Die Erinnerungen waren so stark, dass er mich 1995 überredete, ihn auf eine »Vergebungsfahrt« deutscher Christen in die Ukraine zu begleiten. Nachdem die Reisegruppe ein jüdisches Massengrab bei Berditschew besucht hatte, war mein Vater sichtlich verunsichert. Aber von einer Beteiligung von Wehrmachtssoldaten an Massakern gegen die Zivilbevölkerung und Juden wollte er nichts wissen.
1997 besuchten wir gemeinsam jenes Dorf vor Moskau, in dem er im Winter 1941 mit seiner Einheit Stellung bezogen hatte. Der Besuch in dem Dorf endete mit einem Fiasko, denn Bewohner berichteten uns, dass während der Besatzung drei Zivilisten, die der Kappung einer Telefonleitung verdächtigt wurden, von deutschen Soldaten erschossen worden waren. Davon hatte mein Vater mir nie erzählt. An eine beschauliche Begehung seiner ehemaligen Stellung vor Moskau war nicht mehr zu denken. Er wollte das Dorf so schnell wie möglich verlassen.
Als in Westdeutschland 1968 eine Protestbewegung gegen den Vietnam-Krieg, die Notstandsgesetze und eine reaktionäre Politik in vielen Lebensbereichen losbrach, fassten ich und vieler meiner Altersgenossen Mut. Wir begannen unsere Eltern zu fragen, was sie in der Nazizeit und an der Ostfront erlebt hatten, bekamen aber meist nur ausweichende und bruchstückhafte Antworten. Niemand wollte am Pranger stehen. Und so schwieg man lieber. Von staatlicher Seite gab es zunächst keinerlei Unterstützung bei der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit.
Was die Aufarbeitung der Nazizeit betrifft, wurde seit den späten 1960er Jahren von einer linken und demokratischen Öffentlichkeit viel erreicht, doch wie sich jetzt zeigt, zu wenig. Denn die deutschen Medien sind der Erzählung Annalena Baerbocks über ihren unschuldigen Opa Waldemar blind gefolgt und haben alle Schuld am Ukraine-Krieg auf Russland abgewälzt.
Das Geschichtsbewusstsein vor allem in Westdeutschland ist heute auf das Niveau der 1950er Jahre zurückgefallen, als viele Westdeutsche meinten, die wahren Übeltäter im Zweiten Weltkrieg seien die Sowjetsoldaten und nicht die Wehrmacht gewesen, welche die Sowjetunion überfiel.
Das Thema »Deutsche im Krieg gegen Russland« ist von beklemmender Aktualität. Mit meinem Buch möchte ich zum Nachdenken über die deutsche Kriegsbeteiligung in der Ukraine anregen.
Ulrich HeydenMoskau, im November 2023
1https://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/annalena-baerbock-on-a-transatlantic-green-deal-and-german-strategies-in-facing-russia-and-china/
2https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-12-april-2022-100.html, Minute 45:29
1. Im Schatten des Krieges
Ich kam im September 1954 zur Welt. Es war im Jahr, als die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland und die Aufnahme in die NATO beschlossen und die Visapflicht im Grenzverkehr zwischen Deutschland und Frankreich abgeschafft wurden.
Faschismus und Krieg waren erst neun Jahre vorüber. Meine Mutter Christa – geboren 1930 in Ostpreußen – war von der Flucht vor der Roten Armee geschwächt, weshalb sie mehrere Fehlgeburten erlitt.
Meine Eltern hatten 1952 geheiratet. Ihre Hochzeitsreise machten sie ausgerechnet nach Spanien. Es war außer Portugal das einzige Land in Westeuropa, wo damals noch eine Diktatur herrschte.
Erst zwei Jahre später begann sich die Hoffnung auf ein Kind zu erfüllen. Doch die Schwangerschaft war nicht einfach. Meine Mutter hatte extra für mich ein handtellergroßes, grünes Tagebuch angelegt, in dem sie alles Wichtige vor und nach der Geburt notierte. »18. 12. 53 letzte Regel. Vom 8. 2. bis 15. 5. fest gelegen.« Ich sollte sicher in ihr wachsen, weshalb ihr vom Arzt Bettruhe verordnet worden war. Die Ruhe zahlte sich aus. Sie notierte: »14. 5. ganz schwache Bewegungen.« Die Geburt zog sich über drei Tage hin. »Der Geburtskanal war zu eng«, erzählte mein Vater. So kam ich mit Kaiserschnitt auf die Welt. Ein Wunder, wie meine Mutter das durchgestanden hat.
Nach der Geburt schrieb sie in das Tagebuch, »vom ersten Tag an dunkle Locken. Er trank sofort gut und die Milch kam auch schnell und reichlich.« Als ich zwei Jahre alt war, notierte sie: »Er ist sehr empfindsam auf fröhliche und traurige Stimmung bei mir. Ist sehr hilfsbereit.«
Und es gab neue Freude. Nur wenig nach mir wurde meine Schwester geboren.
Der letzte Eintrag meiner Mutter in dem Büchlein ist vom September 1957. Danach führte eine Gouvernante das Tagebuch weiter. Meine Mutter war im April 1959 bei einem Autounfall in Münster gestorben. In ihrem Bauch trug sie ihr drittes Kind. Der Unfall ereignete sich auf dem Rückweg von einem Skiurlaub. Christa saß auf dem Beifahrersitz, mein Vater am Steuer. Das Auto wurde an der Beifahrerseite von einem Laster gerammt, der die Ampel nicht beachtet hatte.
Dass meine Mutter gestorben war, wurde mir nur verklausuliert von meiner Gouvernante mitgeteilt. Ich war damals fünf Jahre alt. »Sie ist nach oben gegangen«, sagte die Frau und zeigte dabei in den Himmel. Ich guckte angestrengt in den Himmel, sah die Mutter aber nicht.
Zur Beerdigung wurde ich nicht mitgenommen. Dass ich geweint oder getrauert habe, daran kann ich mich nicht erinnern. Dass ich Journalist wurde, hat aber vielleicht etwas mit dem Tod meiner Mutter zu tun. Ich hasse es, wenn etwas verschwiegen oder vertuscht wird.
Im ersten Jahr nach dem Tode meiner Mutter bekamen ich und meine Schwester jeweils eine Gouvernante, die sich um uns kümmerten. Meine Betreuerin mochte ich sehr gerne. Sehr bald schon erklärte ich ihr, dass ich sie heiraten wollte. Irgendwann verschwand sie dann.
Über seine verstorbene Frau sprach mein Vater immer wie von einem Engel. Ein Anlass, sich an die Verstorbene zu erinnern, war der Geburtstag meiner Mutter im Juni. Dann fuhr er mit dem Auto zu ihrem Grab südlich der Elbe, wo Christa neben dem Familiengrab einer Schwester ihre Ruhestätte hatte.
Als ich größer war, fuhr ich oft mit. Für mich waren diese Fahrten in die Marsch mit dem Geruch von Äpfeln verbunden. Sobald wir eine der vielen Apfel-Plantagen dort erreicht hatten, kaufte Wilhelm eine Kiste von diesem Obst, das im Auto einen starken Duft verbreitete. Der Duft hatte für uns beide etwas Beruhigendes. Er gab uns die Hoffnung, dass das Leben weitergeht.
Ein Jahr nach dem Tod von Christa heiratete Wilhelm erneut. Seine neue Frau brachte drei Kinder mit in die Ehe. Gemeinsame Kinder hatte Wilhelm mit seiner zweiten Frau nicht.
Es war wohl eine Vernunftehe. Verliebtheit habe ich zwischen Wilhelm und seiner zweiten Frau nicht bemerkt. Ich hatte eher den Eindruck, dass es eine gute Freundschaft war.
Mein Vater stand nach dem Tod meiner Mutter mit seinen zwei Kindern, mir und meiner Schwester, alleine da. Der zweiten Frau meines Vaters ging es ähnlich. Sie war nach dem Tod ihres Ehemanns mit ihren drei Kindern – einem Sohn und zwei Töchtern – alleinstehend. In unserer neuen Familie wurde alles pragmatisch geregelt. Lange Trauerphasen passten nicht zum soldatischen Wesen meines Vaters.
2. Das Geschäft
Bohnerwachs und schummrige Beleuchtung
Es fühlte sich merkwürdig an, wenn ich als Kind in Hamburg in die Firma meines Vaters ging. Alles war so streng. Wilhelm saß an einem großen Besprechungstisch, meist beschäftigt mit Schriftstücken, die ihm von seiner Sekretärin zur Unterschrift vorgelegt wurden. Dem Tisch gegenüber stand eine mit grünem Leder bezogene Bank, auf der ich Platz nehmen durfte.
Der Raum mit seinen weißen Wänden, den Schränken aus dunklem Mahagoniholz und den Kupferstichen aus dem 19. Jahrhundert hatte etwas bedrückend Strenges. Auf den Stichen waren französische Soldaten mit großen Mützen und Gewehren zu sehen, die 1814 – am Ende der Besatzungszeit – über eine hölzerne Elbbrücke aus Hamburg abzogen.
Wilhelm freute sich, wenn ich kam. Er war stolz auf mich, hatte aber kaum Zeit, mit mir zu sprechen.
Die Firma befand sich im Neuen Wall, im ersten Stock eines der Kontorhäuser, die mit flexibler Raumaufteilung Anfang des 20. Jahrhunderts für Handelsunternehmen gebaut worden waren. Wer zur Firma wollte, musste durch einen nur schwach beleuchteten, aber pompösen Eingang. Über eine Treppe aus schwarzem Marmor, der mit weißen Adern durchzogen war, ging es hinauf in den ersten Stock. Die Treppenstufen waren immer blank gewischt. Kein Staubkorn weit und breit. Die mattschwarzen Gitterstäbe im Treppengeländer, in die meine Kinderfinger griffen, gaben Halt, waren aber kantig-viereckig und kalt. Nur der leuchtende Messing-Handlauf des Geländers brachte etwas Warmes in diese kühle Vorhalle.
Im ersten Stock angekommen, ging es links durch eine unscheinbare Holztür zum Empfangszimmer. Dort roch es nach Bohnerwachs. Weil die Leuchter an den Wänden des Empfangszimmers wenig Licht gaben, war es im Empfangszimmer immer ein bisschen schummrig. Hell war nur der Raum mit der Empfangsdame und Telefonistin Frau S., deren Arbeitsplatz vom Empfangszimmer durch eine große Glasscheibe getrennt war. Frau S. hatte schön gemachte Haare und eine modische Brille. Sie begrüßte mich immer mit einem Lächeln, das so herzlich war, als ob sie auf mich gewartet hätte.
Außer dem Zimmer der Telefonistin lagen die Zimmer der Angestellten alle zur Fensterseite des Bürogebäudes. Man erreichte die Zimmer der Mitarbeiter über einen Korridor, der sich in der Form eines großen »L« parallel zur Gebäudeaußenwand hinzog. Vom Korridor waren die Zimmer der Angestellten nur durch eine Glasscheibe getrennt, also für die beiden Chefs und die Mitarbeiter beim Vorbeigehen einsehbar. Nur das Zimmer von Wilhelm war nicht einsehbar. Was es bedeutet, immer unter Kontrolle zu stehen, wurde mir erst später im Berufsleben bewusst.
Da mein Vater meist noch in einer Besprechung saß, holte die Telefonistin mich in ihren Raum und sprach ein bisschen mit mir, damit es mir nicht langweilig wurde. Zwischendurch nahm sie Anrufe an und stellte sie an Mitarbeiter durch.
Irgendwann ging dann die Doppeltür auf – das war eine spezielle Konstruktion zur Schalldämpfung – und heraus kam Wilhelms Sekretärin, Frau B., eine untersetzte Frau. Sie hatte einen dunklen Lockenkopf und trug immer ein enges schwarzes Kleid, das bis zum Knie reichte. Ihre Lippen waren dunkelrot geschminkt.
Ich schlüpfte hinein zu meinem Vater, der irgendwelche Papiere durchlas. Er sagte mir, er habe noch keine Zeit, ich könne mich aber mit Herrn O. unterhalten, das war sein Teilhaber in der Firma. Er saß im Nebenzimmer.
Von Wilhelm wusste ich, dass Herr O. im Zweiten Weltkrieg in Russland Stuka-Flieger gewesen war. Diese Kampfflugzeuge stürzten mit einem furchterregenden Heulton aus dem Himmel auf ihre Ziele am Boden. Mir schien, dass das eine gefährliche Sache sei, Herr O. also ein mutiger Mann sein musste. Dabei sah er mit seinem Kinnbart aus wie ein gemütlicher Großvater, der seinen Kindern gerne Märchen vorliest. Auf wen er da in Russland genau hinabstürzte, darüber verlor Herr O. kein Wort.
Als ich etwas älter war, kam Herr O. einmal auf das Thema Hamburger Werften zu sprechen. Die machten ab den 1960er Jahren der Reihe nach dicht. Schiffe wurden von nun an in Südostasien gebaut. Dort war die Produktion billiger. Herr O. fand an dieser Entwicklung nichts Bedenkliches. Deutschland werde sich jetzt auf Spitzentechnologie konzentrieren. Die einfachen und groben Arbeiten würden in die »Dritte Welt« ausgelagert, meinte er.
Irgendwann stand dann Wilhelm in der Tür und sagte: »Lass uns essen gehen.« Wir gingen durch den Neuen Wall vorbei an den Geschäften, in denen die Hamburger Oberschicht kaufte. Hier gab es teures Porzellan, Juweliere, edle Lampen und Decken. Nirgendwo sonst in Hamburg fanden konservative Zeitgenossen ihre standesgemäße Kleidung, graue Flanellhosen, blaue Jacketts mit Goldknöpfen, Lodenmäntel, Jägerhüte, steife Lederschuhe aus England, Trachtenjoppen aus Bayern, Bunthosen, Pullover mit V-Ausschnitt und Krawatten in dezenten Tönen. In einem dieser Geschäfte wurde wohl auch meine grüne, lederne Bundhose gekauft, die ich als Kind trug.
Nach zehn Minuten erreichten wir auf der rechten Seite des Neuen Walls ein vegetarisches Restaurant. Wilhelm bemühte sich um einen gesunden Lebensstil, nach dem alten Wehrmachtsmotto: »In einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist.« Das ständige Sitzen im Büro war für ihn, der Aktion und Bewegung liebte, eine Herausforderung.
Mein Vater rauchte nicht und trank Alkohol in Maßen. Er arbeitete sehr viel und war häufig auf Messen und Geschäftsreisen. Um auf andere Gedanken zu kommen und sich zu entspannen, schwamm er, ging in die Sauna, ritt auf seinem Pferd oder ging zur Jagd.
Sein Lebensstil war fast asketisch. Die einzige Beschäftigung, die keine Anstrengung erforderte, die er sich aber regelmäßig gönnte, war gut Essen. Zum Frühstück gab es Porridge mit braunem Zucker und Sahne. Er liebte Leberwurst mit schwarzer Johannisbeermarmelade. Zu besonderen Anlässen aß er Hase oder Reh aus dem Ofen mit Preiselbeersauce. Das höchste der Gefühle waren für ihn österreichische Gerichte wie Marillenknödel und Kaiserschmarren. Alle diese Gerichte mag ich auch sehr.
Ein kleines rotes Buch aus Peking
Mein Vater war Inhaber einer Im- und Export-Firma, die er von seinem Vater – der ebenfalls Wilhelm hieß – übernommen hatte. Die Firma handelte mit Ölen und Fetten und machte im wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg gute Gewinne. So konnte sich mein Großvater väterlicherseits Anfang der 1950er Jahre zwei große Häuser mit Grundstücken in grüner Lage kaufen.
In den 1960er Jahren stellte mein Vater das Geschäft auf andere Handelswaren um, darunter Sicherheitsgurte aus Schweden, Saunas aus Finnland, Teppiche aus der Volksrepublik China sowie Abwasserpumpen und Vibrationswalzen aus Deutschland.
Von einer Reise in die Volksrepublik China brachte Wilhelm mir Ende der 1960er Jahre ein kleines, in rotes Plastik eingebundenes Büchlein mit. Es trug den Titel: »Die Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung«. Für ihn war das Geschenk wohl ein Spaß. Noch ahnte er nicht, dass ich mich politisch gerade in die maoistische Richtung entwickelte.
Auf den Handel mit Sicherheitsgurten für Autos war Wilhelm sehr stolz. Er behauptete, er sei der erste in Deutschland gewesen, der Sicherheitsgurte aus Schweden importierte. Zu diesen Gurten hatte er einen ganz persönlichen Bezug. Er sagte häufig, seine erste Frau, meine Mutter, »würde noch leben, wenn sie einen Gurt gehabt hätte.«
Hitler-Fahne am Haus, weil alle es so machten
Wilhelm hatte eine strenge Erziehung durchgemacht. 1936 – da war er fünfzehn – hatte ihn sein Vater in das Jungeninternat Roßleben in Thüringen geschickt, eine Elite-Schule mit militärischem Drill. Anlass für die Verschickung ins Internat war nach der Schilderung meines Vaters, dass er als Junge die Hitler-Fahne aus dem Fenster des elterlichen Hauses hängte. Er habe sich vor den anderen Jungens in jener Straße in Hannover, wo die Familie damals wohnte, nicht blamieren wollen, erzählte mir Wilhelm.
Mein Großvater war kein Nazi-Anhänger, aber rechtsnational. Er kam mit einer schweren Beinverletzung aus dem Ersten Weltkrieg, wo er im Artillerieregiment Magdeburg Nr. 4 in Frankreich kämpfte. Weil er an einem vorgeschobenen Außenposten mittels einer noch funktionierenden Telefonleitung das Feuer von zwei deutschen Divisionen auf die angreifenden Engländer lenkte, bekam er einen Verdienstorden. Er studierte dann Jura in Kiel und gehörte einer »weißen« Burschenschaft an. Ich erinnere mich, dass er auf einer Backe eine lange Narbe, einen sogenannten »Schmiss«, hatte – die Folge eines Fechtkampfes, wie sie in den »weißen« Burschenschaften üblich waren. Sie sollten zur Tapferkeit erziehen.
Was mein Vater im Internat Roßleben erlebte, muss für ihn wie ein Schock gewesen sein. »Sie sind neu?«, wurde er von einem älteren Internatsschüler gefragt. Worauf Wilhelm sofort eine solche Ohrfeige bekam, dass er hinflog. Nachts sei er als Neuer von älteren Zöglingen mehrere Male »ausgehoben«, das heißt, aus dem Bette geschmissen und mit kaltem Wasser übergossen worden. Mein Vater schrieb viele Briefe an seine Mutter, in denen er schilderte, wie schlimm das Internat sei. Er habe im Internat auch viel geweint, erzählte er mir.
In einem Brief meines Großvaters an seinen Sohn in Roßleben – ich fand ihn im Nachlass meines Vaters – schrieb dieser, die Deutschen seien »kein Naturvolk«. Die deutsche Jugend sei in Gefahr zu »verweichlichen«. Die Erziehung »mit dem Rohrstock« mache einen jungen Menschen zu einem Erwachsenen, der »überall durchkommt«.
Als mein Großvater seinen Sohn das erste Mal nach drei Monaten im Internat besuchte, saß mein Vater gerade im Deutschunterricht. Als er die Hupe eines Studebaker hörte, rannte er wie in Trance aus dem Unterricht. Im Hof war sein Vater mit dem Auto vorgefahren. Der Internatszögling warf sich seinem Vater in die Arme und sagte: »Hol mich hier weg.« So erzählte es mir Wilhelm.
Mein Vater wurde im Internat umgepolt. Aus einem weichen Jungen wurde ein harter Mann. Er lernte, wie man sich Respekt verschafft. Weil er »Patriot« war, habe er sich im Dezember 1939 als Kriegsfreiwilliger bei der Kavallerie-Ersatz-Abteilung 13 in Lüneburg gemeldet, schrieb mein Vater in einer selbstverfassten Chronologie über seine militärische Laufbahn.3
Ein halbes Jahr später – im Juni 1940 – wurde er in die Aufklärungsabteilung 152 der 52. Infanterie-Division nach Frankreich versetzt. Der Feldzug gegen Frankreich war jedoch bereits zu Ende. An Gefechten nahm Wilhelm dort nicht mehr teil.
Im Juli 1940 verpflichtete er sich zur unbegrenzten Dienstzeit in der Deutschen Wehrmacht. Weil er erst 19 Jahre alt war, musste mein Großvater unterschreiben. Der habe gesagt, »das kann ich ruhig unterschreiben, der (Hitler) macht sowieso Pleite.«
Anfang 1941 begann Wilhelm an der Kavallerieschule in Krampnitz in Brandenburg eine Ausbildung zum Zugführer einer Radfahr-Schwadron. Mit dieser Schwadron war er am 22. Juni 1941 am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt.
3 Militärische Laufbahn, selbst verfasst von Wilhelm Heyden, vier maschinenschriftliche Seiten, 1999, S. 1
3. Als 20-jähriger Soldat vor Moskau
Wilhelm zog mit seiner Einheit von Brest-Litowsk über Minsk, Rogatschew und Kaluga bis zum Dorf Kuschmistschewo. Das Dorf liegt an der Oka, 147 Kilometer südwestlich von Moskau. Dort lagerte seine Einheit ab Mitte November 1941. Es habe nur eine »primitive Schneeloch-Verteidigungsstellung« gegeben, schreibt Wilhelm in seinen Erinnerungen. Eingraben sei wegen einer Temperatur »von 30 Grad Minus« nicht möglich gewesen.
Wilhelm kämpfte in der Sowjetunion in den Reihen der 52. Infanterie-Division. Er hatte das Kommando über eine Schwadron von 40 Radfahrern, die wiederum zu einer Vorausabteilung, der »Aufklärungs-Abteilung 152« gehörte, dem »Auge der Division«.
Die 52. Infanterie-Division wurde nach Schilderungen deutscher Soldaten auch zur Partisanenbekämpfung eingesetzt, wobei auch Frauen und Kinder getötet wurden. Über Derartiges hat mein Vater aber nie berichtet.
Das Einzige, was er mir gegenüber erwähnte, waren »furchtbare Partisanen«, welche »entgegen der soldatischen Regeln von hinten angriffen«. Ob er an Erschießungen von Partisanen und Vergeltungsaktionen gegen Zivilisten beteiligt war, wagte ich ihn als Jugendlicher nicht zu fragen.
Am 17. Dezember 1941 musste die Einheit von Wilhelm den Rückzug antreten, weil »die Russen« in Überzahl angriffen. »Schlitzäugige kamen in Massen über die Oka«, erzählte mir mein Vater von den dramatischen Tagen, in denen sich der Traum, mit der Wehrmacht Moskau zu erobern und über den Roten Platz zu marschieren, zerschlug.
Mit »Schlitzäugigen« waren offenbar Burjaten, Tadschiken und Usbeken gemeint, die aus dem südöstlichen Teil der Sowjetunion mobilisiert worden waren, um den deutschen Vorstoß auf Moskau zu stoppen.
Ob Wilhelm selbst »Schlitzäugige« gesehen hat, scheint mir zweifelhaft. Vermutlich hat er seine Erzählungen mit den Kernelementen der Nazi-Propaganda von den »Wilden«, die aus Asien vorstießen, angereichert. Mit Stolz erzählte mir Wilhelm, er habe den Rückzug seiner Fahrrad-Schwadron geleitet, da der Kommandeur seiner Einheit beim »russischen Angriff« umgekommen war. Die Fahrräder, welche die Schwadron mitführte, mussten im Dorf zurückgelassen werden.
Johann Sebastian Bach im Schlachtenlärm
Jeden Sonntag am festlich gedeckten Frühstückstisch unserer Familie mit Grapefruit, Marmelade, Toast und Hoppelpoppel-Zuckerei kam irgendwann der Punkt, an dem Wilhelm eine Geschichte aus dem Krieg erzählte. Das passierte mit derselben Regelmäßigkeit wie die Bach-Musik, die beim Frühstück im Hintergrund spielte.
Wir Kinder ertrugen die Erzählungen vom Krieg, so wie man ein Gewitter erträgt. Aber es war jedes Mal wie eine Fahrt durch die Hölle. Harte Schlachten, grausam, unerbittlich und ständige Lebensgefahr.
Die Kriegserinnerungen meines Vaters, die ich in diesem Buch an verschiedenen Stellen wiedergebe, stammen aus den Erinnerungen an Erzählungen meines Vaters sowie verschiedenen Dokumenten, die ich in seinem Nachlass fand, darunter auch maschinenschriftliche Bemerkungen von einem Kriegskameraden meines Vaters.
Vom Krieg erzählen war Wilhelms liebste Beschäftigung. Damit stand er nicht allein. Viele meiner Lehrer füllten ihre Unterrichtsstunden mit Geschichten aus dem Krieg. Von Gräueln an der sowjetischen Zivilbevölkerung und den Juden wurde kein Wort erzählt. Es ging immer nur um den tapferen deutschen Soldaten, die nicht siegten, aber Unbeschreibliches durchgestanden hatten.
Ganz Westdeutschland schien auf diese Weise den Krieg zu »bewältigen«. Es ist wohl nur dem Wiederaufbau des Landes zu verdanken, der alle Kräfte in Anspruch nahm, dass die Leute bei so viel massiver Verdrängung nicht verrückt wurden. Immerhin wurden sie mit dem »Wirtschaftswunder« und einer modernen Konsumgesellschaft belohnt. Und die Großindustrie, die schon am Krieg verdient hatte, machte nun mit Konsumgütern gute Gewinne.
Immer, wenn ich meinen Vater fragte, was die deutschen Soldaten in der Sowjetunion zu suchen hatten, sagte er, man habe Russland vom Bolschewismus befreien wollen. Das hörte sich so an, als ob hinter dem gewaltsamen Tod von 27 Millionen Sowjetbürgern eine »gute Absicht« gestanden hätte.
Die Verbrechen der Wehrmacht gegen die sowjetische Zivilbevölkerung, die in Westdeutschland erstmals seit der »Wehrmachtsausstellung« 1995 zum öffentlichen Thema wurden, schalt Wilhelm als »Beleidigung der deutschen Soldaten«. In der Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht« wurde anhand von Fotos, die deutsche Frontsoldaten machten und Briefen, die sie schrieben, nachgewiesen, dass die »einfachen Soldaten« vom Holocaust in der Sowjetunion wussten und zum Teil daran beteiligt waren. Bis dahin lautete die Meinung, die man überall hörte und las, Verbrechen an der sowjetischen Zivilbevölkerung hätte nur die SS begangen.
Er erinnerte noch weißrussische Wörter für Eier und Milch
Russen als Menschen tauchten in den Erzählungen von Wilhelm nicht auf. Nur zwei russische Jungens aus dem Dorf Kusmistschewo vor Moskau erwähnte Wilhelm positiv. Sie holten Feuerholz für den deutschen Offizier. Zwei weißrussische Wörter, »Jaika« und »Malako« – Eier und Milch –, erinnerte Wilhelm noch. Die baute er gerne in seine Kriegserzählungen ein.
Auf einem Foto sieht man Wilhelm vor einem Holzhaus stehen. In diesem Haus im Dorf Kusmistschewo wohnte er von November bis Dezember 1941. Auf dem Foto neben ihm stehen zwei sowjetische Jungs. Sie tragen Mützen mit Ohrenklappen und Stiefel aus Filz. Einer der Burschen grinst. Wilhelm scheint auf dem Foto zu lächeln, aber völlig entspannt wirkt er nicht.
Der Rückzug nach Westen endete für Wilhelm am 2. August 1942 mit einer schweren Verletzung. Nahe der Stadt Brjansk bekam er den Befehl, zusammen mit der Bataillonsinfanterie einen feindlichen Frontbogen im dichten Waldgelände »auszumisten«,4 so die Worte von Wilhelm. Als er einen »minenverseuchten Holzbunker« angriff, wurde er im Nahkampf »mit Russen« schwer am Bein und an einem Arm verletzt. Nach diesen Verletzungen war die Beteiligung meines Vaters am Feldzug gegen die Sowjetunion nach 13 Monaten zu Ende.
Er kam in ein Lazarett in Lüneburg, wo ihm fast das rechte Bein amputiert worden wäre. Aber er habe den Arzt überredet, es nicht zu tun, erzählte mir Wilhelm später mit einem Gefühl des Triumphs. Er war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Aus heutiger Sicht scheint es mir unvorstellbar, was mein Vater durchgemacht hat. Und ich kann mir kaum erklären, dass ihm als jungen Menschen mit schwersten Verletzungen keine Zweifel am Feldzug gegen die Sowjetunion kamen. Nie hat er mir über seine Gefühle als Schwerverletzter berichtet. Ich vermute, er hat die Schmerzen und die Angst, als Schwerbehinderter heimzukehren, mit dem Gefühl kompensiert, es sei alles im Dienst für das Vaterland geschehen.
Über den Lazarettaufenthalt erzählte Wilhelm meist in fröhlichem Ton. Er lag dort zusammen mit dem Aristokraten und Landgut-Besitzer A. B., mit dem Wilhelm seitdem eine enge Freundschaft verband und der später einer meiner Patenonkel wurde.
Der dritte Mann im Krankenzimmer war jemand von der SS. Den habe man »umgepolt«, meinte Wilhelm, ohne näher darauf einzugehen, was er meinte.
Nach der Genesung im Lazarett in Lüneburg wurde Wilhelm im Februar 1943 für sieben Monate nach Norwegen verlegt. Die Einheiten der Wehrmacht hatten dort die Aufgabe, einen möglichen Angriff der Engländer abzuwehren. Aber »die Engländer« kamen nicht. In dieser Zeit wurde Wilhelm zum Oberstleutnant befördert.
Der Schinder
Der nächste Einsatzort meines Vaters war ab Oktober 1943 die Kavallerieschule in Bydgoszcz (Bromberg), gelegen im nördlichen Zentralpolen. Dort war Wilhelm ein gefürchteter Ausbilder. Darüber berichtet in seinen Erinnerungen der Kavallerist Heinrich Orsini-Rosenberg. Er schreibt, er habe sich damals entschlossen, sich in der Kavallerieschule bei »einem Offizier zu melden, der den Ruf als ganz besonders brutaler und harter Ausbilder hatte.«5
Weiter schreibt der Kavallerist, »Josef Haiden6 war angeblich7 ein sehr tapferer Offizier und mit seinen Untergebenen an der Front sehr fürsorglich. Er hatte allerdings eine sehr raue Schale und ließ uns dies am Anfang deutlich merken. Es gab, obwohl die äußeren Umstände wenig einladend waren, ständiges Strafexerzieren bei Schnee und Kälte und nächtelange Stalldienste.«
Wie wurde mein Vater zum Schinder? Vermutlich spielte das Internat eine Schlüsselrolle. Dort herrschten strengste Regeln und wer sich behaupten wollte, musste hart werden. Erst nach einer Zeit voller Schikanen wurden die Schüler in einem Ritual in die Gemeinschaft aufgenommen. Man musste ein Stück Rinde von einer Eiche beißen. In dieses Stück wurde dann Siegellack geträufelt und in diesen Siegellack wurde mit dem Siegelring des Schülers das Familienwappen eingepresst.
Dass Wilhelm als »Bürgerlicher« unter lauter Aristokraten Zugführer wurde, war für ihn wohl ein großer Erfolg. Er fühlte sich als wichtiger Teil der nationalen deutschen Elite.
Die sowjetische Artillerie trieb die Wehrmacht vor sich her
Ab Januar 1945 wurde die militärische Lage für das deutsche Heer im Norden von Polen kritisch. Wilhelms Kriegskamerad, Orsini-Rosenberg, schreibt, »wir hörten das immer näherkommende Donnern vor allem der russischen Artillerie und schließlich kam es so weit: Ich glaube, es war in der Nacht vom 21.−22. Januar, dass der Alarm ertönte und wir in voller Ausrüstung antreten mussten.«8
Wilhelm schreibt in seinen Erinnerungen, aus Berlin sei der Befehl gekommen, dass die Kavallerieschule »den Abschnitt Bromberg ›bis zum letzten Mann‹ verteidigen« sollte. »Nur die wertvollen Pferde mussten im Landmarsch (Bahnkapazität nicht vorhanden) gerettet werden. (…) Wir ritten wie befohlen in ca. 2 1/2 Wochen durch Pommern und Mecklenburg in die Wehrmacht-Ausbildungsstätte Munster.«9
Eine wesentlich drastischere Beschreibung des Marsches der Kavalleristen nach Westen liefert Orsini-Rosenberg. Auf dem Weg zur Oder habe man viel Leid unter den Menschen gesehen, die auf der Flucht nach Westen waren. Überall waren die Straßen verstopft. Vielen Erwachsenen und Kindern fehlte die nötige Winterkleidung. Es herrschte Mangel an Nahrungsmitteln. »Wir fanden tatsächlich eine noch freie Brücke und es gelang unseren Offizieren, insbesondere Josef Haiden, trotz dem gewaltigen Andrang und des unvorstellbaren Durcheinanders, uns, zum Teil mit gezogener Pistole, über diese Brücke auf das andere Ufer zu manövrieren.«10
Die höchst problematische Episode des Durchbruchs über die Brücke mit Hilfe einer Pistole hat mir mein Vater auch einmal mündlich erzählt, ohne dass in seiner Erzählung so etwas wie Mitleid für die Flüchtlinge auftauchte. Für ihn galt nur der militärische Befehl, den er erfolgreich ausführte und den er auch später nicht in Frage stellte.
Über das Schicksal der in der Kavallerieschule in Bromberg zurückgebliebenen 300 Kavalleristen hat mein Vater nie etwas erzählt. Orsini-Rosenberg schreibt in seinen Erinnerungen, dass wahrscheinlich viele gefallen oder in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten seien.
Nachdem der Zug mit den Kavalleristen aus Bromberg mit den geretteten »wertvollen« Pferden in Munster angekommen war, wurden die 21 Soldaten und auch Wilhelm wenig später weiter nach Naestved, gelegen auf der dänischen Insel Seeland, abkommandiert.
Doch auch dieser Ort war nur eine Zwischenstation. Die Kavalleristen aus Bromberg – inzwischen alle zu Leutnants befördert – wurden Mitte März 1945 zum Kavalleriecorps südlich von Graz in Österreich verlegt.
Wilhelm, der nicht nach Österreich abkommandiert worden war, setzte sich im dänischen Naestved selbst mit auf die Liste der nach Österreich verschickten Leutnants. Er sei faktisch »desertiert«, erzählte er mir, aber nicht, um die Armee zu verlassen, sondern um mit seinen Kameraden zusammenzubleiben. Um nach Österreich zu gelangen, mussten sich die Kavalleristen über verschiedene Verkehrsmittel zu ihrem Ziel durchschlagen.
Südlich von Graz wurde Wilhelm Chef der zweiten Reiterschwadron. Das Ziel der zwei deutschen Kavallerie-Divisionen, die Anfang April 1945 »von den Russen verfolgt« wurden, war es, in die Gefangenschaft der Engländer zu kommen.
Und so kam es auch. Die Gefangennahme lief sehr freundlich ab, erzählte Wilhelm. »German cavalry, come in«, hätten die Engländer gesagt. Diese Worte klangen in Wilhelms Ohren wie Musik. Er empfand von Seiten der Engländer Anerkennung für die deutsche Kavallerie. Trotz der militärischen Niederlage verhielt sich das Schicksal gegenüber den beiden deutschen Divisionen gnädig.
Die freundliche Aufnahme durch die Engländer kam nicht von ungefähr. England und Deutschland verband ideologisch der Antikommunismus. Und wie 1998 bekannt wurde, gab es Überlegungen der Engländer, die Sowjetunion mit Hilfe deutscher Divisionen anzugreifen, um ein befürchtetes sowjetisches Übergewicht in Europa zu verhindern. Premierminister Winston Churchill hatte im Frühjahr 1945 beim Generalstab der britischen Streitkräfte eine Studie unter dem Arbeitstitel »Operation Unthinkable« in Auftrag gegeben. Es sollte geprüft werden, welchen Verlauf ein Feldzug gegen die Sowjetunion unter Beteiligung von Divisionen der deutschen Wehrmacht gehabt hätte.11
Wilhelm kam nach der Gefangennahme durch die Engländer in das Entlassungslager Aalen in Württemberg. Ob er dort verhört wurde, hat er nie erzählt. Im Juli 1945 wurde er aus dem Lager entlassen und war ein freier Mann. So eine kurze Gefangennahme sei »sehr selten« gewesen, schrieb er später in einer Aktennotiz.12
4 Militärische Laufbahn, W. Heyden, S. 2
5 Meine Erlebnisse als Soldat, Heinrich Orsini-Rosenberg, S. 79, Maschinenschrift 99 Seiten, Oktober 2008
6»Josef« war ein Spitzname von Wilhelm Heyden, die falsche Schreibweise des Nachnamens habe ich nicht korrigiert.
7 Das Wort »angeblich« wurde in der Maschinenschrift handschriftlich durchgestrichen.
8 Meine Erlebnisse als Soldat, Heinrich Orsini-Rosenberg, S. 80
9 Militärische Laufbahn, Wilhelm Heyden, S. 3
10 Meine Erlebnisse als Soldat, Heinrich Orsini-Rosenberg, S. 82
11 Vgl. Knut Mellenthin, Churchills dritter Weltkrieg, http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Kriegsgeschichte1/churchill.html
12 Handschriftliche Notiz auf dem Dokument »Meldeorte ab dem 17. Lebensjahr«, Maschinenschrift, eingereicht bei der Abteilung Führungszeugnisse/Polizeipräsidium Hamburg, 5. Januar 1951
4. Soldatenlieder und Kotztüten
Schwerbehindert vom Krieg
Im Nachlass meines Vaters fand ich ein Schreiben des Versorgungsamtes Hamburg aus dem Jahre 1956. Aus dem Dokument geht hervor, dass Wilhelm im Rücken und im linken Arm zahlreiche Stecksplitter hatte. Der linke Unterarm war verformt, die Folge eines Durchschusses der beiden Unterarmknochen.
Die Erwerbstätigkeit sei zu 30 Prozent eingeschränkt, stand in dem Bescheid. Wegen fortschreitender Beschwerden durch die Kriegsverletzungen wurde Wilhelm im Jahr 1980 eine Erwerbsminderung von 70 Prozent bescheinigt. Dass er einen Schwerbehindertenausweis besaß, darüber hat Wilhelm nie gesprochen. Er klagte auch nicht über seine Verletzungen. Er wollte auf keinen Fall ein »Invalide«, sondern »vollwertig« sein.
Wie Wilhelm seine Schicksalsschläge – schwere Verwundung und Tod seiner ersten Frau – verarbeitete, weiß ich nicht. Aber irgendetwas rumorte in ihm. Er litt häufig unter Migräneanfällen und konnte dann kaum noch den starken Mann markieren. Er musste Tabletten nehmen, obwohl Tabletten gegen sein Prinzip waren, dass ein echter Mann ohne künstliche Hilfsmittel durchkommen muss.
Wilhelm war jähzornig. Einmal – als Kleinkind – schrie ich in meinem Gitterbett. Da kam er mit einer Kutscherpeitsche angerannt und baute sich vor mir auf. Meine Mutter Christa stand mit ausgebreiteten Armen vor meinem Bettchen. Das ist das Einzige, was ich von ihr erinnere.
Mit 14 Jahren aus Ostpreußen geflüchtet
Christa von Negenborn, meine Mutter, habe ich im Gegensatz zu meinem Vater als gütigen Menschen in Erinnerung.
Auch in ihrem Leben hatte der Krieg Spuren hinterlassen. Ende Oktober 1944 flüchtete sie im Alter von 14 Jahren mit ihrer Mutter und ihren vier Schwestern im Zug von Königsberg nach Heiligengrabe in Mecklenburg und später weiter nach Medingen in Niedersachsen.
Wie die Familie es schaffte, zu fliehen, obwohl die Gauleitung von Ostpreußen eine Flucht unter Androhung der Todesstrafe verboten hatte, ist nicht überliefert. Für finanziell bessergestellte Deutsche war die Hürde offenbar überwindbar.
Erst als Ostpreußen im Januar 1945 von der Roten Armee umzingelt war und der NSDAP-Gauleiter Erich Koch die von der Roten Armee geforderte Kapitulation ablehnte, begann die überstürzte Flucht der deutschen Zivilbevölkerung. Es flüchteten überwiegend alte Menschen, Frauen und Kinder.
Die Umstellung auf das Leben als Flüchtlinge hätte für die Familie meiner Mutter nicht radikaler sein können. Die Negenborns lebten bis 1944 auf dem herrschaftlichen Landgut Loyden bei Bartenstein (Bartoszyce). Das Landgut, das 1945 durch das Potsdamer Abkommen an Polen fiel, besaß ein großes, im spätklassizistischen Stil gebautes, Herrenhaus. Zu dem Gut gehörten 850 Hektar Land und Wald.
Als Flüchtlinge musste die Familie von Negenborn im Februar 1945 in einem kleinen roten Backsteinhäuschen unterkommen. Es stand auf dem Gelände eines evangelischen Klosters im niedersächsischen Medingen. Die Familie war im Grund dorthin zurückgekehrt, von wo einst die Vorfahren nach Osten aufgebrochen waren. Die Vorfahren meiner Mutter waren im 18. Jahrhundert aus Niedersachsen nach Ostpreußen übergesiedelt. Ende des 19. Jahrhunderts war Christas Großvater väterlicherseits – wegen gutem Wirtschaften in Loyden – der Adelstitel verliehen worden.
Das Schicksal meiner Mutter war im Nachkriegsdeutschland nicht außergewöhnlich. Zwölf Millionen Deutsche flüchteten zwischen 1945 bis 1948 aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, aus Polen und dem Sudetenland. In Westdeutschland waren 15 Prozent der Bevölkerung Flüchtlinge. In der Sowjetischen Besatzungszone waren es 24 Prozent.
Auf dem Dach die Schlagwaffe der Kreuzritter
Auf dem Dach des Herrenhauses des Landgutes Loyden hatten die Negenborns das Zeichen der deutschen Kreuzritter, einen Morgenstern, angebracht. Er erinnerte an den Deutschen Orden, der im 13. Jahrhundert große Teile des späteren Ostpreußens und des Baltikums erobert und die heidnischen Prußen christianisiert hatte. Bei dem Morgenstern handelte es sich um die symbolische Nachbildung einer Schlagwaffe der Kreuzritter. Wie sah die Waffe aus? Am Ende eines Knüppels befand sich ein Kopf, der mit fünf Zentimeter langen Dornen besetzt war. Dieser Kopf gab der Waffe ein sternförmiges Aussehen.
Mein Vater, der Loyden 1964 zusammen mit einem Schwager besuchte, erwähnte mit Begeisterung den Morgenstern auf dem Dach. Doch ich bezweifle, dass Wilhelm den Morgenstern selbst gesehen hat. Vermutlich kannte er das Symbol nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Für meinen Vater war der Morgenstern das Symbol, dass die Osterweiterung des Deutschen Reiches »etwas Gutem« diente.
»Das Attentat auf den Führer war ja toll«
Meine Mutter wuchs behütet auf dem Landgut auf. In ihrem Tagebuch, das Verwandte 2010 als kleines Büchlein13 drucken ließen, schrieb Christa über die Hasen, Lämmer und Pferde, die sie auf dem Gut betreute und auch gesund pflegte.
Der Krieg taucht in ihrem Tagebuch nur am Rande auf. Am 10. Juli 1944 – die Rote Armee war nur noch 400 Kilometer von Loyden entfernt – schreibt sie, »nun sind Sommerferien 1944 ganz herrlich. Heißes Wetter und alles wies sein muß. (…) Ich bin von der Schule abgegangen. Bernd [Christas Bruder] ist Leutnant geworden. (…) In Russlands geht’s ja jetzt hoch her wer da noch wüsste wies mal ausgehen wird.«
Am 7. August 1944 notiert sie dann doch etwas über den Krieg, aber sehr kurz. »Wir wollten gerne Panzer haben.« Und: »Das Attentat auf den Führer war ja toll.«
Dass Christa das Attentat auf Hitler begrüßte, hängt wohl mit der Stimmung in Teilen des ostdeutschen Landadels zusammen, die nach Stalingrad verstanden, dass der Krieg gegen die Sowjetunion nicht zu gewinnen war und der komplette Untergang Deutschlands drohte.
Sehr merkwürdig ist, dass sich über das wichtigste Ereignis im August 1944 in Christas Tagebuch kein Wort findet. Die britische Luftwaffe hatte Ende August auf Königsberg mit hunderten von Bombern in zwei Wellen Luftangriffe ausgeführt, durch welche die Innenstadt in Schutt und Asche gelegt und 130.000 Einwohner obdachlos wurden. Königsberg lag nur 60 Kilometer nördlich vom Landgut Loyden. Christa hatte die Stadt oft zusammen mit ihrer Mutter besucht. Dass sie den britischen Angriff in ihrem Tagebuch nicht erwähnt, kann damit zusammenhängen, dass die Eltern ihr nichts von dem Angriff erzählten, um die 14-Jährige nicht zu ängstigen.
Ende Oktober 1944 war das vom Krieg fast unberührte Landleben von Christa zu Ende. Sie schreibt in ihr Tagebuch: »Flucht! Ja das ist ein Wort, dessen Bedeutung man nicht gleich so voll und ganz erfasst. Wenn man eine mitmacht. Obgleich die Russen noch 100 Kilometer von Loyden entfernt waren. (…) Am 22. 10. um vier Uhr fuhren wir ab. Wir hatten die ganze Nacht durch gepackt. Vati war rührend und Mutti auch. Wir aßen noch schnell die Klopse und das schönste Kompott auf.«
Als Andenken an das Landgut nahm meine Mutter ein paar Roggenähren mit, die sie mit einem roten Band zusammenschnürte. Ich habe das Andenken später in einer Kiste aufbewahrt. Aber als ich mich politisierte, schien es mir nicht mehr wichtig und zudem politisch fragwürdig. Es ging verloren.
»Ist der Führer gestorben?«
Am 4. Mai 1945 – Christa war bereits in Niedersachsen – schrieb sie ungläubig in ihr Tagebuch: »Am 2. Mai ist der Führer gestorben?! Am 3. Mai Berlin gefallen. Heute kommen große Lastautos mit deutschen Soldaten durch. (…) Frieden! Komisch was haben wir uns sonst unter ›dem großen Frieden‹ vorgestellt. Und nun – Hier waren Amerikaner (…). Seit heute sind Engländer hier.« Am 19. Mai 1946 schreibt sie: »Die Tommys sind alle weg. Hoffentlich ist unsere ›Sicherheit‹ nicht dadurch beeinträchtigt.«
Im Februar 1945 erhielt Christa die Nachricht, dass ihr Bruder – Bernd – Ende Januar in der Gegend von Allenstein (Olsztyn) gefallen war. Der Tod des einzigen Sohnes muss für die Familie schrecklich gewesen sein.
Bei meiner Geburt 1954 bekam ich in Andenken an den gefallenen Bruder und zu Ehren von Christas Vater die Zunamen »Bernd« und »Hans-Werner«. Als Vornamen entschied man sich für »Ulrich-Wilhelm«. Damit wollten meine Eltern meinem Großonkel Ulrich-Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld eine Ehre erweisen. Er gehörte zu den deutschen Offizieren, welche das Attentat auf Hitler organisiert hatten.