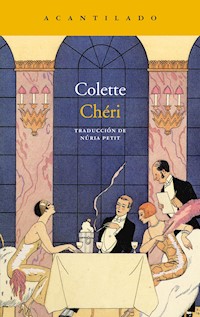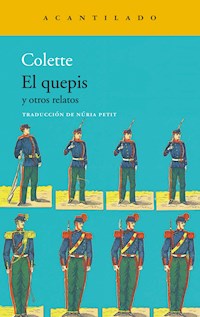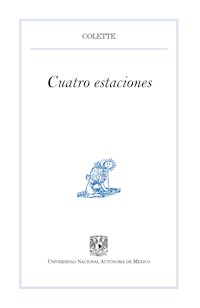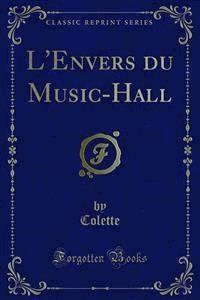4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Colette schreibt hier die wahre Geschichte einer beispiellosen Ausbeutung: dreizehn Jahre lang veröffentlichte Willy, ihr erster Ehemann, unter seinem Namen und mit «würzenden» Zutaten jene Romane, die ihren Weltruhm begründeten. In ihr Arbeitszimmer eingesperrt, mit einem Taschengeld abgespeist, verfaßte sie Bücher, mit denen er sich zum erfolgreichsten Literaten seiner Zeit aufschwang. Ihre frühen Pariser Jahre im Schatten von Willy schildert Colette hier so, wie die Erinnerungen in ihr aufsprudeln – nicht in zeitlicher Ordnung, sondern in enthüllenden Szenen voller farbiger Gestalten. Doch im Mittelpunkt steht die Abrechnung mit ihm – dem Anreger und schließlich besiegten Ausbeuter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Colette
Meine Lehrjahre
Aus dem Französischen von Uli Aumüller
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Colette schreibt hier die wahre Geschichte einer beispiellosen Ausbeutung: dreizehn Jahre lang veröffentlichte Willy, ihr erster Ehemann, unter seinem Namen und mit «würzenden» Zutaten jene Romane, die ihren Weltruhm begründeten. In ihr Arbeitszimmer eingesperrt, mit einem Taschengeld abgespeist, verfaßte sie Bücher, mit denen er sich zum erfolgreichsten Literaten seiner Zeit aufschwang.
Über Colette
Sidonie-Gabrielle Colette, 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye (Burgund) geboren und 1954 in Paris gestorben, war eine französische Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin.
Inhaltsübersicht
Ich bin in meinem Leben selten jenen Menschen nahegekommen, die von den anderen groß genannt werden. Sie haben meine Gesellschaft nicht gesucht. Ich für mein Teil mied sie, betrübt darüber, daß sie neben ihrem Ruhm nur blaß wirken konnten, daß sie schon bemüht waren, ihre Gußform auszufüllen, sich selbst zu gleichen; ein wenig steif, ein wenig erschöpft, insgeheim um Nachsicht bittend und entschlossen, mit Hilfe ihrer Schwächen «zu bezaubern», wenn sie nicht, um zu betören, ihren sinkenden Stern hervorkehrten.
Wenn sie in diesen Erinnerungen nicht vorkommen, so bin ich schuld daran, weil ich ihnen – ohne viel Ansehen des Geschlechts – unbekannte Menschen vorgezogen habe, Menschen mit einer Besonderheit, die sie verteidigten, die sich banalen Werbungen verweigerten. Jene, die meine Neugier, ja sogar eine Art Leidenschaft weckten, waren sich manchmal nur unschlüssig, auf welche Art und Weise sie ihre kostbare Essenz verströmen sollten. Sie verhielten sich wie Schlemmer, die den Hummer à l’américaine verschmähen, weil sie nicht sicher sind, wie man ihn richtig verzehrt. Aber wahrscheinlich lag mir die reinigende Geste – mit einer Handvoll Wasser weckt der italienische Führer im Vorbeigehen das schlummernde Gold der unterirdischen Mosaike … Eine Träne – oder ein Spritzer Wasser – und meine Lieblinge eröffneten sich.
Auf nichts bin ich stolz, außer darauf, im Vorbeigehen auf diese ergiebigen, unbekannten Menschen gestoßen zu sein. Manchmal wollen ihre Namen, ihre unwesentlichen Namen verlöschen, aber ich zwinge sie herbei, und sie prägen sich aufs neue unter Gesichter, die nur langsam verblassen. Die Einprägsamsten haben keine schicksalhafte Rolle in meinem Leben gespielt. Es ist meine Art, den Vorübergehenden in der Erinnerung genauso zu hegen wie den Verwandten oder den Ehemann und Überraschendes genauso wie Alltägliches. Deshalb konnte ich zum Beispiel – ohne Liebe – jenem jungen Mann einen Vorzugsplatz einräumen, den ich dabei beobachtete, wie er so tat, als trinke er und rauche Opium. Nun ist es aber leichter, wirklich zu rauchen und zu trinken, als nur so zu tun, und die Enthaltsamkeit – auf allen Gebieten eine Seltenheit – verrät eine Neigung zum Herausfordern und zur Virtuosität. Was also suchte mein zwischen Raucherei und Sauferei hin- und hergerissener junger Asket, der dabei nüchtern blieb? Mir mußte er es einfach sagen, mir, die ich weder rauchte noch mich berauschte. Er wollte nichts weiter, als sich von allen Seiten von echten Säufern und leidenschaftlichen Rauchern umdrängt, umwärmt, gestützt zu fühlen. Zwar drückte er sich schlecht und bruchstückhaft aus, aber an dem Tag, als er statt «ihre Sauferei» versehentlich «ihr Vertrauen» sagte, verstand ich alles.
Die Trunkenheit umging er leicht, indem er den Champagner geschickt mit Sprudel mischte. Das Opium verursachte ihm mehr Schwierigkeiten und manchmal leichte Übelkeit – was sein muß, muß sein. Was er brauchte war die flüchtige Freundschaft, die Bekenntnisse, eine Blütenlese von arglos gestorbenen jungen Leuten und die triste Glückseligkeit, seine Stirn an eine mitfühlende Schulter oder Brust zu lehnen, im Halbschlaf unerreichbare Verbündete zu finden …
Ich habe auch die kleine Achtjährige gekannt, die ihre Mutter lange rufen ließ, weit weg im Park. In ihrem Versteck hörte sie die Stimme der Mutter näher kommen, sich entfernen, herumirren, den Tonfall ändern, am Brunnen und am Teich heiser und unkenntlich werden. Es war ein sehr sanftes kleines Mädchen, das aber, wie Sie sehen, schon zuviel über die verschiedenen Arten wußte, sich furchtbar zu amüsieren. Schließlich kroch es aus seinem Versteck, tat ganz atemlos und lief in die Arme seiner Mutter: «Ich komme vom Bauernhof … Ich war … ich war mit Anna im Gemüsegarten … Ich war … ich war …» entschuldigte es sich.
«Was wirst du erst Schlimmes anstellen, wenn du zwanzig bist?» warf ich ihm eines Tages vor.
Es machte seine süßen blauen Augen halb zu, schaute in die Ferne:
«Oh, ich werde schon etwas finden», sagte es.
Ich glaube aber, daß es prahlte. Ich wunderte mich, daß es sein Spiel zweimal vor meinen Augen spielte. Es verlangte keinerlei Komplicenschaft, kein Versprechen von mir, schien meiner sicher zu sein, wie es nach ihm andere Schuldige waren, die der Wollust erlagen, ein Geständnis abzulegen, und dem Bedürfnis, unter einem menschlichen Blick heranzureifen.
Ich habe eine wackere Person gekannt, eine jener Frauen, die aus Berufung und gesundem Menschenverstand die fette Weide und die Vorratskammer des Mannes sind. Sie diente einem meiner Freunde, A., als Freundin und Geliebte. Er fand bei ihr Zerstreuung, warme und zärtliche Fürsorge, eine anständige Küche, die abendliche Orangeade, das Aspirin bei gewittrigem Wetter und eine vollkommen gutartige Sinnlichkeit. Er verließ die gute Zaza, kehrte zurück, ging und vergaß sie, besuchte sie wieder, fand sie zwischen dem langhaarigen Hund, einem Holzfeuer und irgendeinem Unbekannten, den sie wahrscheinlich ebenfalls mit der Tasse Eisenkrauttee und der heimeligen gemeinsamen Nacht verwöhnte. War B., der Freund von A., etwa ein wenig neidisch auf eine so stillvergnügte Liaison?
«Hüte dich», sagte er zu A.
«Wovor denn?»
«Vor dieser Frau. Sehr gefährlich. Ihre vampirhafte Blässe, ihre teuflisch rote Mähne …»
«Daß ich nicht lache. Sie ist gefärbt.»
«Gefärbt oder nicht, altes Haus, du hast keine Ahnung von der erschreckenden Veränderung, die man seit einiger Zeit in deiner Gemütsverfassung, deiner Arbeit, ja sogar an deinem Äußeren feststellen kann. Ein derart schneller Verfall ist immer das Werk einer femme fatale. Zaza hat alle Eigenschaften der femme fatale. Du steuerst auf einen Abgrund zu.»
A. mokierte sich über B., besuchte Zaza weiterhin, vergaß sie, traf sie je nach Laune wieder, lud sie zu üppigen, köstlichen Abendessen bei den Hallen ein. Eines Abends nahm er auch B. mit und brach nach dem Dessert unerwartet auf:
«Meine Lieben, ich habe um zehn Uhr eine Gewerkschaftsversammlung. Trinkt den Armagnac auf mein Wohl. Alter Freund, bringst du Zaza nach Hause, falls sie ein Gläschen zuviel getrunken hat?»
Im Tête-à-tête mit Zaza gab B. ihr zu verstehen, welchen Verdacht, welche erschreckenden Gedanken sie ihm einflößte:
«Eine Frau wie sie … männermordend … Ja, ja, so ist es … Dieser Trottel von A., charmant, aber beschränkt, hat nichts begriffen … Wie? Es gibt andere! … Gott sei Dank bin ich noch in der Lage, Geheimes ans Licht zu bringen …» usw.
Gegen Mitternacht tropften B.s Tränen auf Zazas weiße Hände, die ihn von oben herab anschaute und ihren großen, gutmütigen Mund zusammenkniff. Unserem Freund A. erzählte sie nichts davon. Aber sie begann, bei B.s Besuchen die großartige und aus der Mode gekommene Toilette einer femme fatale anzulegen.
Sie lockte ihn, verstieß ihn, rief ihn zurück, kratzte mit einer Glasscherbe die vier Buchstaben ihres Vornamens in das Handgelenk des armen Mannes, bestellte ihn zu Rendezvous in einem Taxi, krönte ihre roten Haare mit Jettschmuck, trug Hemden aus schwarzer Spitze, und – noch skandalöser – verweigerte sich ihm. So kam es, daß B., der ganz außer sich war, wohl oder übel an den Vamp glauben mußte, den er erfunden hatte, und A. sorgte sich um B.:
«Was hast du, alter Freund? Ist es die Leber? Die Blase? Mach eine Kur, geh zum Arzt, tu etwas! Aber laß es nicht einfach so laufen, ich habe den Eindruck, daß es schlecht um dich steht!»
Er wußte gar nicht, wie recht er hatte, denn B., der schlecht aß, kaum schlief, sich beim geringsten Luftzug erkältete, holte sich eine Schwindsucht und starb ganz überraschend. Zazas Fotografien unter seinem Kopfkissen und – zwischen Geschäftsbüchern versteckt – in seinen privaten Unterlagen trugen nicht wenig dazu bei, den Kummer der Witwe B. zu lindern …
Zaza selbst, einen himmelblauen kleinen Pullover strickend, erzählte mir die Geschichte, die ich hier wiedergebe. Wir waren ganz allein, und sie machte viele Pausen, sagte immer wieder genüßlich: «… das Schönste an der Geschichte war … Jetzt war mein B. ganz aus dem Häuschen … Nicht, daß ich für schwarze Spitze schwärme, aber das wirkt romantisch …» Und so plauderte sie dahin, ihr liebenswertes, reifes Gesicht in boshafte Falten gelegt, als würde sie mir einen etwas übertriebenen Schwank erzählen. Und mit einer unbeschwerten Geste, die jedem zartbesaiteteren Zuhörer eine Gänsehaut verursacht hätte, schloß sie weise:
«Man darf den Teufel eben nicht in Versuchung führen, nicht einmal aus Dummheit. Dieser Dummkopf B. hat den Teufel in Versuchung geführt …»
Daß keiner meiner schattenhafte Freunde mich eine herausragende Tugend oder ein herausragendes Laster gelehrt hat, daß keiner eine Osmose oder einfach eine Ansteckung bewirkt hat, darüber kann ich mich heute nur freuen. In der Zeit meiner reiferen Jugend ist es vorgekommen, daß ich hoffte, «jemand» zu werden. Wenn ich den Mut gehabt hätte, meine Hoffnung ganz deutlich auszudrücken, hätte ich gesagt «jemand anderes». Aber das habe ich schnell aufgegeben. Ich habe nie jemand anderes werden können. Teure zügellose Vorbilder, teure unheilvolle Ratgeber, demnach hätte ich euch nur eine Liebe und ein Entsetzen entgegengebracht, die beide gleich unbeteiligt waren? Entscheidende Personen sind keineswegs vergeblich an mir vorbeigezogen, vorbeistolziert und haben ihr Licht leuchten lassen, denn ich bewahre ja eine angenehme und leuchtende Erinnerung an sie. Aber ich habe sie entmutigt. Immer entmutigt man jene, denen man nicht nacheifert. Aufmerksamkeit, die nur von Neugier gespeist wird, gilt als Impertinenz. Nun habe ich aber weder die Guten noch die anderen imitiert. Ich habe ihnen zugehört, ihnen zugesehen. Ein sicheres Mittel, den Guten die Melancholie von Engeln einzuflößen und mir die Verachtung der Verdammten zuzuziehen – der Verdammten im katholischen Sinn des Wortes. Die Stimme des Verdammten tönt selbstsicher und lebhaft und zögert nie – das gilt zum Beispiel auch für die klangreine Dur-Stimme von Madame Caroline Otéro, die mir einst, völlig wirkungslos und ohne Nachdruck, große Wahrheiten übermittelte.
Ich habe sie nicht gut gekannt. Man wird sich wundern, ihren Namen gleich auf den ersten Seiten meiner Erinnerungen zu lesen. Er kommt mir ganz gelegen unter die Feder, um diesen Seiten ihren Ton zu geben. Zwanzig Seiten über das bunte, klang- und geheimnisvolle Vergängliche; zwanzig Zeilen über das Bekannte und Verehrungswürdige, das andere besungen haben und besingen werden; Erstaunen vor dem Abgedroschenen, hin und wieder die Neigung, beim Ton der lauten Ahs und Ohs, die die Welt angesichts eines Wunders, eines Messias oder einer Katastrophe gerade ausstößt, vor Langeweile einzuschlafen – das ist, glaube ich, mein Rhythmus.
Es trifft sich gut, daß ich mich mit Vergnügen an Madame Otéro erinnere. Ich hätte aus erhabeneren Mündern als ihrem Worte aufnehmen können, die mir, vielfältig widerhallend, Belehrung und Nutzen gebracht hätten? Ja, aber die erhabenen Münder sind nicht so freigebig. Ich habe mich vom Zufall und von Unbekannten entschädigen lassen, die ihre Worte manchmal fallen ließen, wie die Kokospalme ihre Nüsse, bumms, mitten auf den Kopf. Madame Otéro, die mitten in einer Phase meines Lebens steht, in der ich nach Möglichkeiten suchte, selbst meinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat nichts von einer Kokospalme. Sie ist reine Verzierung. Und wie alles, was reiner Luxus ist, gibt sie mannigfache Lehren von sich. Schon beim Zuhören freute ich mich, daß eine meiner Karrieren, die ich versucht hatte, sie auf meine Fährte führte:
«Kleines», sagte sie, «du siehst mir nicht gerade gewitzt aus. Denk daran, daß es im Leben eines jeden Mannes, selbst eines geizigen, immer einen Moment gibt, in dem er die Hand ganz weit aufmacht.»
«Der Moment der Leidenschaft?»
«Nein. Der Moment, in dem du ihm das Handgelenk umdrehst. So …» fügte sie hinzu und machte eine schraubende Bewegung mit beiden Händen; man vermeinte, den Fruchtsaft, das Gold, das Blut oder sonst etwas herausfließen zu sehen und die Knochen krachen zu hören. Können Sie sich mich vorstellen, wie ich einem Geizigen das Handgelenk umdrehe? Ich lachte. Ich bewunderte, da ich nichts Besseres zu tun wußte. Herrliches Geschöpf … Ich habe sie erst kennengelernt, als sie das Alter erreichte, in dem die Frauen von heute meinen, sie müßten auf traurige Mittel zurückgreifen, auf Gymnastik und Einschränkungen, um ihre kostbaren 45 Jahre zu übertünchen und zu konservieren. Madame Otéro dachte nicht an Entbehrungen. Wenn ich aus ihren raren Worten auch keinen Nutzen gezogen habe – sie war nicht sehr gesprächig, zumindest nicht in unserer Sprache –, so hatte ich doch den Vorteil, ihr hinter den Kulissen zu begegnen, fern von den öffentlichen Zeremonien, Soupers, Generalproben in den Music-Halls, die sie in ein Paradekorsett einzwängten und ihren Bug mit ihrem großen Brustschild aus Schmuck behängten. Der unbewegten Ikone, die – wie ein von Rauhreif überzogener Baum – nur von ihrem eigenen Glitzern erschüttert wurde, zog ich eine andere Lina vor, eine genauso herablassende Lina, die mich ziemlich von oben herab duzte:
«Kommst du am Chamchtag puchero essen? Komm möglichst früh, dann chpiele ich vor dem Essen Bésigue mit dir.»
Ich ahmte ihr distanziertes Duzen nach, und schon auf der Schwelle ihres Palais fühlte ich mich wohl. Der Palast, den es sich im voraus ausgemalt hat, entzückt das Kind nur selten. Madame Otéros Palais hat mich nie enttäuscht. Seine Bewohnerin ist eine Art Karyatide, im Stil einer Epoche geformt, die ich in schwankender Unschlüssigkeit durchlebte. In die Intimität einer Karyatide dringt man nicht ein, man betrachtet sie. In Madame Otéro betrachte ich die Zeit, in der ich um die dreißig war. An den Rahmen ihres Privatlebens erinnere ich mich mehr als deutlich, eine verschwommene, auf das Wesentliche beschränkte Erinnerung an bestimmte schöne, antike Möbel, vertäut in einer Flut von vielleicht mit japanischen Schwänen besticktem Satin, unter «Applikation» genannten, schäumenden Spitzen. Was ist aus jenem blassen und heiteren Blau, aus jenem Erdbeerrosa, aus den gewirkten Stoffen in der Farbe der Morgenröte geworden, mit denen die Wände bespannt waren, die von Baldachinen fielen, Fensternischen wie Blumengewinde drapierten, was aus jenen steifen Damaststoffen, die, wie man sagt, von selbst standen?
Die Wohnungen der Damen, ob sie nun Liane, Lina, Maud, Yovonne oder Suzie hießen, waren von «überwältigendem» Luxus, denn es ging ja für jede darum, irgendeine andere zu überwältigen. Zwei Salons waren besser als einer, und drei besser als zwei, mochte die Würde der Vielzahl weichen. Der schwülstige Stil hatte noch nicht abgedankt, und man erstickte in Möbeln. Die Einweihungsfeiern fanden in bedrängender Enge statt. Bedenken Sie, daß ich hier von einer Epoche spreche, in der der Luxus die Wohnungshygiene und den Sport zu Nebensächlichkeiten degradierte. So manches «arabische» Boudoir hatte kein Fenster. Die Automobilkarosserie richtete sich unterwürfig nach dem Diktat des großen Modeschöpfers und paßte sich der Höhe der Hüte an. Ich sehe noch Madame Otéros blauen Mercedes vor mir, eine Schmuck- und Straußenfedernschachtel, eine Limousine, die so schmal und so hoch war, daß sie sich in den Kurven sanft zur Seite neigte.
Selbst das Theater hatte es schwer mit der Mode, in dieser Zeit der großen Korsetts, die die Brust nach oben, das Hinterteil nach unten, den Bauch nach innen zwängten. Germaine Gallois, diese unbeugsame, gepanzerte Schönheit nahm keine «sitzenden» Rollen an. In ein Korsett geschnürt, das unter der Achsel anfing und kurz über den Knien endete, mit zwei flachen Eisenfedern im Rücken, zwei weiteren längs der Hüften, mit einem Aufschürzer zwischen den Beinen (ich benutze die zeitgenössischen Ausdrücke), die das Gebäude zusammenhielten, das zu schnüren übrigens eine sieben Meter lange Schnur erforderlich machte – in diesem Korsett stand sie, die Pausen eingeschlossen, von 20 Uhr 30 bis Mitternacht.
Gerechterweise muß hinzugefügt werden, daß die Wohnungen, waren sie einmal eingeweiht, während der Benutzung verbessert und ausgestaltet wurden. Die kläffenden Hündchen eroberten sie zusammen mit dem Affen, den am Neujahrstag verschenkten Vasen, den Grünpflanzen, den Porträts von Ferdinand Humbert, Prinet, Roybet, Antonio de la Gandara … Schlummerrollen, um die Schultern des Flügels drapierte Manilaschals, Statuetten, Kaminaufsätze, Dosen mit Schokolade und Zuckerwerk, Chinoiserien, Löwenfelle … Manchmal setzte sich ein heftiger, unbezwingbarer persönlicher Geschmack wie mit Dynamit durch. Bei Madame Otéro war das durchaus nicht der Fall, aber damit in meinen Augen alles vollkommen war, genügte es mir, daß die Hausherrin es sich vor dem Abendessen in Seidenstrümpfen und ausgetretenen Pantoffeln bequem machte; unter ihrem tea-gown, den sie gelegentlich gegen einen Bademantel vertauschte, trug sie Hemd und Unterrock. 192 Karten und die «Masken» aus Palisander vor sich, zur Rechten einen Aschenbecher, zur Linken ein Glas Anislikör, so herrschte sie.
Das Spiel und die Schweigsamkeit entblößten ihr Gesicht von jeglichem Ausdruck, aber es konnte gut darauf verzichten. Lange Jahre hindurch hat es gewissermaßen verschmäht zu altern. Madame Otéro, die mit ihrem griechischen Blut prahlte, was nicht unglaubwürdig war, hatte den festsitzenden Hals, das eigensinnige Profil mancher griechischer Statuen, und ihre Hände und Füße waren nicht so herumflatternd klein wie die der Spanierinnen. Zwischen den Trauben ihres üppigen Haars blieb ihre kleine Lämmerstirn glatt. Linas Nase und ihr Mund waren beispielhaft in ihrem einfachen Schnitt, in ihrer orientalischen Heiterkeit – Reutlingers Fotografien beweisen es hundertfach. Von den gewölbten Lidern bis zum Leckermäulchen-Kinn, von der samtigen Nasenspitze bis zur berühmten, leicht fülligen Wange möchte ich Madame Otéros Gesicht als ein Meisterwerk des Konvexen bezeichnen.
«Chetch dich», sagte sie zu mir. «Heb ab. Maria, bring ihr ein Glach Anichlikör.»
Ihre Gesellschafterin, Maria Mendoza, eine arme Spanierin aus gutem Hause, die Ähnlichkeit mit einem ganz knochigen englischen Rotfuchs hatte, gehorchte mit etwas verschreckter Hast, und der Bésigue, dieser Feind des Gesprächs, begann. Unter ihren kaum gealterten Lidern überwachten Linas Blicke meine Hände …
«Chweihundertfünchig … chweihundertfünfchig … Wer chagt an … Wer chagt an … Ich chage an. Tausendfünfhundert.»
Sie konnte das S und Z einwandfrei aussprechen. Aber diese kleine Anstrengung beim Artikulieren behielt sie der Bühne und ausgesuchten Bekannten vor.
Das Spiel wurde hitziger. Gleichmütig ließ sie den Bademantel sich öffnen, das Hemd sich verschieben. Bis in die schattige Mulde zwischen zwei festen, mit der Spitze nach oben weisenden Brüsten von einzigartiger Form, die an längliche Zitronen erinnerten, hing ein wie zufällig angelegtes Schmuckstück, heute echt, morgen falsch, mal sieben Reihen strahlende und rosige Perlen, mal gläserne Requisitenketten, mal ein schwerer Diamant. Allein ihr gebieterischer Hunger und der Duft des puchero entrissen Lina der Bésigue. Groß und straff aufgerichtet, die noch schlanke Taille über einem Hinterteil, das ihr Stolz war, gähnte sie laut, klopfte mit der Faust auf ihren verlangenden Magen und ging, die Schatten ihres Festmahls hinter sich her ziehend, zum Essen, wobei sie mit metallischer und reiner Stimme sang:
Tengo dos lunares,
Tengo dos lunares,
Una junta la bocca,
El otro donde tu sabe …
Bei Tisch kein einziger Mann, keine Rivalin. Der amtierende Liebhaber war irgendwo dabei, sein verdrehtes Handgelenk zu pflegen. Eine oder zwei alternde Freundinnen und ich – nicht alt, aber glanzlos – nahmen an Linas Seite Platz.
Das wirkliche Gaumenfest ist niemals das Diner mit Hors-d’œuvre, Entrée und Braten. Darin waren wir uns völlig einig, Madame Otéro und ich. Ein puchero mit seinem Rindfleisch, seiner Haxe und seinem fetten Speck, seinem gekochten Huhn, seinen longanizas, seinen chorizos, allen Gemüsesorten des Eintopfs, einem Berg von garbanzos und Maiskolben – das war ein Gericht für Liebhaber des Essens. Ich habe immer gern gegessen, aber was war mein Appetit verglichen mit dem Linas? Ihre Erhabenheit schmolz dahin, wich einem Ausdruck sanfter Wollust und Unschuld. Zähne, Augen und der glatte Mund glänzten wie bei einem jungen Mädchen. Selten sind die Schönheiten, die sich vollfressen können, ohne daß es sie entwürdigt. Wenn Lina endlich ihren Teller zurückschob, hatte sie ihn viermal, fünfmal geleert … Dann noch ein bißchen Erdbeer-Sorbett, eine Tasse Kaffee, und sie sprang auf, die Kastagnetten zwischen den Fingern.
«Maria, ans Klavier! Ihr anderen, schiebt mir den Tisch in die Ecke.»