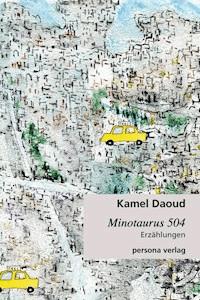16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Kamel Daoud, Picasso und der Dschihadist – ein Kulturclash der besonderen Art. In seinem neuen Buch »Meine Nacht im Picasso-Museum« beschäftigt sich Kamel Daoud mit den Themen Erotik, Religion und Radikalismus. Er hat dafür eine Nacht im Pariser Picasso-Museum verbracht. Herausgekommen sind hochinteressante Betrachtungen aus verschiedenen Perspektiven: der des Westens und der eines erfundenen Islamisten namens Abdellah. Kamel Daoud, Autor des Bestsellers »Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung«, lässt sich für eine Nacht im Picasso-Museum einschließen und riskiert einen Blick auf das Verhältnis des großen Malers zur Erotik, zur Kunst und zur Philosophie des Westens. Mit dabei ist Abdellah, ein junger islamistisch geprägter Mann, den Daoud sich ausdenkt und dessen Gefühlswelt angesichts der westlichen Zurschaustellung von Nacktheit und Diesseitsbezogenheit er ebenso beschreibt wie seine eigene. Ausgehend vom Begriff der Nacktheit entwickelt Daoud einen faszinierenden Text über das Kunst- und Selbstverständnis des Westens, aber auch über den Gedanken der »Reinigung der Geschichte« und der kulturellen Konkurrenz in der sogenannten arabischen Welt. Er erklärt, warum das westliche Kulturverständnis ebenso wie das Frauenbild einem fundamentalistisch geprägten Menschen wie dem prototypischen Abdellah als Provokation erscheinen muss. In der Gegenüberstellung dieser Gedankenwelten von Orient und Okzident, eines Orients, der verschleiert und maskiert, und eines Westens, der enthüllt und die Nacktheit feiert, liegt die Stärke dieses literarischen Essays, in dem Daoud aber zugleich auch immer die eigene schöpferische Tätigkeit reflektiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Ähnliche
Kamel Daoud
Meine Nacht im Picasso-Museum
Über Erotik und Tabus in der Kunst, in der Religion und in der Wirklichkeit
Aus dem Französischen von Barbara Heber-Schärer
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Kamel Daoud
> Über dieses Buch
> Impressum
> Klimaneutraler Verlag
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Den Frauen, die in der »arabisch« genannten Welt oder anderswo kein Recht auf ihren eigenen Körper haben
Adel Abdessemed,
dem Seiltänzer über dem Abgrund
»Paris ist heiliger, weißer Stein«
Erotik ist ein Jagdritual. Diese Riesenstadt ist im Winter kalter Stein. Eine Anordnung der Welt, in der das gelbe Licht die Rolle von Stoff übernimmt, die Brücken Schultern oder Hüften spielen und die Gebäude lauter dir zugekehrte Rücken sind. In den schönen Vierteln zeigen die Schaufenster traumhafte Brüste und Körper. Die gigantischen Plakate schüren das Begehren. Der Winter kündigt sich an, aber auf den Bildern ist die Haut in der Kälte nackt, die Reklametafeln bieten Frauen dar, die unaufhörlich lächeln und Sie erwarten. Paris ist für den, der aus dem Süden der Welt kommt, das Paradies, el Firdaous: Aber wegen seines Argwohns oder seines Andersseins oder seiner Armut verliert er darin seinen Körper, sein Recht auf Genuss, sein Geschlecht und seine Wärme. Stellen Sie sich vor, voller Unruhe und der göttlichen Belohnung ungewiss durch den Garten Eden zu gehen. Das Urteil ergeht nicht am Ende, sondern ständig. Die Huris – diese Frauen, die Verzweiflung und Wunschvorstellung des Korans Ihnen nach dem Tod verheißen und die, in ewiger Jugend erstarrt, geschminkt und müßig, im Paradies allein sind – weisen Sie ab und senken ihre großen Lider über ihrem Pfauenleben, wenn Sie ihnen begegnen. Die Schaufenster sind Gebete, aber nicht die Ihren, nicht für Sie. Man kniet hier nieder, aber um durch Métro-Münder hinabzusteigen. Münder, die niemanden küssen oder zu viele auf einmal! Man betet, die Hände an den Zug geklammert. Meine Sorge, als ich in Paris ankomme, ist mein Blick, ich weiß nicht, wohin damit. Am liebsten würde ich ihn in die Tasche oder unter die Achsel stecken, ihn wegräumen, blind und höflich werden, aber er fliegt davon. Kaum an die Welt der Bilder gewöhnt, schaue ich unwillkürlich alles an. Bilder, Küsse, Elend, Gerüche, Plakate und Reflexe. Ich möchte den Okzident besitzen, aber ich kann es nicht. Im Oktober schmückt sich Paris und wird beinahe ein Leid, das sich Ihnen jedoch nicht eingesteht. Als betrachteten Sie eine weinende Frau, die Ihnen den Rücken kehrt. Im Fallen findet sie einen Weg, nicht auf Ihrer Höhe zu sein. Ich bin dieser Stadt nicht böse. Ich gehöre nicht zu den Klagenden, die dem Abendland böse sind. Nein, ich komme hierher als mittelalterlicher Schreiber, als Dieb von Perspektiven und Möglichkeiten. Nachts ist diese Stadt Neonlicht und Geschichte, Taxis und Kathedralen, eine Frau und ein Mann, die dasselbe Geschlecht haben und nicht wissen, was tun. Paris ist ein Paradies, in dem man begreift, dass man den heiligen Krieg umsonst geführt hat, die Huris Illustrationen sind und die Flüsse nicht aus Wein bestehen, Sie aber vielleicht dazu drängen, ihn in den Bistros zu trinken.
Es ist die Nacht, die ich für meine Nacht im Picasso-Museum ausgesucht habe. Ich komme mit einem Rucksack, im Taxi und zehn Minuten zu früh dort an. Der ganze Schrecken des »arabischen« Spaziergängers im Abendland ist: Was tun mit dem Zuviel an Zeit? Ziellos herumzulaufen, ist in der Zeit der Attentate nicht mehr so einfach. Herumlaufen ist fast schon töten, zumindest bedrohen oder Aufmerksamkeit erregen. So tun als ob, ist eine aussichtslose oder schwierige Kunst für den Fremden. Ich habe beschlossen, einen Rundgang durch das Viertel zu machen. Auf die alte Art. Daher lief ich zehn Minuten lang im nächtlichen Gelb der Straßenlaternen weiter. Die Rue de Thorigny rauf und runter. Was tut ein Prophet, wenn er zehn Minuten vor einer Vision ankommt? Zehn Minuten zu spät, in dieser Zeit kann man noch ein Gebet oder das Buch Hiob fabrizieren. Aber zehn Minuten zu früh? Ich weiß nicht. Keine Antwort. Meine Frau, in den letzten Tagen der Schwangerschaft, wartet in der Wohnung, die wir im XIV. Arrondissement gemietet haben. Sie weiß, dass ich spät nach Hause komme. Sie mit tausend Frauen betrüge. Aufschneidereien und Vereinigungen. Fürchte ich mich? Nein. Ich liebe diese Momente, wo ich mit der Fußspitze die Gebiete anderer erkunde, das Feld der Künste und der Sinne. Seit meiner Geburt in einem algerischen Dorf habe ich das getan, als ich im stummen Umkreis einer heimlichen Sprache las. Ich spaziere so gern auf dem Mond herum und ordne die Welt neu. Ich weiß, ich bin Träger einer Weltanschauung, die im schlimmsten Fall an meiner Stelle schwatzen wird, wenn ich den Bericht über meine heilige Nacht werde schreiben müssen. Die »Araber« sind eine alternde, geschwätzige Aristokratie. Sie kann nicht zugeben, dass sie das Glück der Welt verloren hat. Und so zieht sich die Erzählung von den vergangenen Tagen, vom Goldenen Zeitalter, in die Länge, frisst unsere Überreste und unsere Körper und verleiht uns da, wo wir keine Schuhe an den Füßen haben, den Anschein von Stolz. Ein alter Aristokrat erzählt die Geschichte der Welt besser, denn seine Sprache hat eine Milliarde Nuancen, und er hat nichts anderes zu tun, als zu kommentieren. Er kann Ihnen sein verlorenes Land in allen Einzelheiten beschreiben wie einen vollkommenen Apfel. Oder umgekehrt. Der wahre Prophet der »arabisch« genannten Länder ist Jeremias, nicht Mohammed. Lassen wir das. Meine heilige Nacht findet also hier statt, unter meinen Schuhsohlen, ich läute und man lässt mich eintreten. Die Dame, die mir öffnet, ist argwöhnisch. Sie arbeitet im Museum und ist nicht informiert worden über meinen optischen Raub der Werke ihres Meisters. Sie fragt nach, telefoniert, und alles klärt sich. Ich war nur zu früh. Man bittet mich, in der Eingangshalle zu warten, und diese Halle ist kalt und nackt und wirkt wie ein verlassener Ort, mit einer großen Treppe, die wegführt und sich nicht um Sie kümmert. Das Schlimmste für einen Genius ist sein Tempel. Das heißt, sein Monument. Als ich den Hof überquere, fällt mir ein, dass ich Reliquien nicht mag. Ob in Gestalt von Steinen oder Gesichtern, von Folklore. Zu sehr imitieren sie Gebete oder wissendes Schweigen. Vor ihnen fühlt man sich zu einer bestimmten Haltung oder einem bestimmten Gedanken gedrängt. Das alles ist dem Gebet zu nah, als dass es für mich erträglich wäre.
In der Tradition wird erzählt, dass der Prophet eine »heilige Nacht« erlebt hat und in Lichtgeschwindigkeit von Mekka nach Jerusalem gereist ist (die nächtliche Reise), bevor er die sieben Himmel, in Stockwerke aufgeteilt wie Wolkenkratzer, durchquerte (die Himmelfahrt). Immer noch der Tradition zufolge hört er im siebten Himmel die Griffel, die das Schicksal schreiben. Ich liebe diese Metapher, die in der Begegnung mit einem Schreiber oder einer fleißigen Hand kulminiert und die das Manuskript als Ziel und Zweck jeder Reise erleben lässt. Eine weitere heilige Nacht ist die, in der ihm der Koran offenbart wurde. Diese Nächte sind ein sonderbares Detail, sie entsprechen tausend Jahren unseres irdischen Lebens, erklärt der Koran. Als Mohammed die Himmelsgewölbe auf dem Rücken eines fliehenden Tieres durchquerte, begegnete er Propheten und Gesandten. Und jeder hat ihm von seiner Erfahrung, seinem Leben, seiner Ewigkeit, seiner Botschaft erzählt. Ich stelle mir vor, in Picassos Himmel zu sein, aber nur in Paris. Vielleicht im ersten oder zweiten Himmel dem Maler mit dem hochmütigen Blick zu begegnen, inmitten der Gestirnkonstellationen, die er mit seinen Bronzebildhauerzehen, seinen Artefakten und Erektionen reizt. Dem Mann mit der breiten Stirn und der Eitelkeit, durch sein Genie reingewaschenen Eitelkeit, der mir ein wenig erklären wird, warum er die Huris vor dem Jüngsten Gericht gegessen und wie er die Schöpfung Gottes, den Körper des Menschen, auseinandergenommen hat, um noch einmal von vorn anzufangen; wie er vom Sündenfall zur biblischen Frucht, von der Frucht zum Genuss und dann zum Zerkauen und Verschlingen zurückgegangen ist. Ach, wenn er nur einen Blick auf den Sinn seines Werks im Universum meiner Geburt hätte werfen können! Ein Picasso des syrischen Guernica, ein Maler, dem die Angst die Hände abgeschnitten hätte. Ein »Entschleierer« gegen den Schleier. Ein Mann, der die Geschichte der Frau mit seinem Gaumen wieder aufgerollt hätte. Ein heiliger Spötter und Perverser. Jetzt ist das Wesentliche, dass ich in dieses Museum geschickt worden bin, um das erotische Tagebuch eines fünfzigjährigen Mannes zu betrachten, der eine halb so alte Frau getroffen und ein heiliges Mahl und pornografisches Martyrium aus ihr gemacht hat.
In der Halle befindet sich eine Art Hahn unter Glas. Die Wärter sind entgegenkommend und erklären mir, wie ich mich in diesem Palast bewegen kann, wen ich rufen soll und zu welcher Zeit die Runden des »arabischen« Ästheten stattfinden können. Neben der zentralen Treppe steht ein Feldbett, ein Korb mit Essen, und ich habe die ganze Nacht, um zu beten oder zuzuhören. Man lässt mich zuerst die Räumlichkeiten besichtigen, die erotische Ausstellung. Der Titel ist verführerisch: Picasso 1932, année érotique. Die Nacht wird lang sein, sie wird tausend Stunden in der Zeit meines Heimatlandes entsprechen. Es ist kalt in der Galerie, die Wände sind weiß wie die Sackgasse ins Jenseits, und die Gemälde sind gekritzelte, zerkaute Sterne. Ich habe aus einem einzigen Grund zugesagt: Die Erotik ist ein Schlüssel in meiner Sicht auf die Welt und auf meine Kultur. Die Religionen sind Autodafés der Körper, und was ich an dieser dunklen Bewegung des erotischen Verschlingens liebe, ist der absolute Beweis, dass man auf Himmel, Bücher und Tempel verzichten kann. Die Erotik ist die Permanenz des Menschen, der Beweis, dass das Jenseits ein Körper ist, den man in der Hand und im Bauch hat, hier und nicht »danach«, dass der Sinn der Welt im Sinn meiner Begegnungen liegt und dass alle Kunst die Erinnerung an einen Moment ist, die Gespanntheit auf einen Mund, einen Spalt oder ein Anderswo. Die Erotik ist in meinem Leben seit Langem ein Schlüssel, um mein Universum, meine Hemmungen, die mörderischen Sackgassen in meiner Weltgegend und die Aggressionen zu verstehen, die mich zum Ziel haben oder die ich endlos weitertrage. Wenn die Monotheismen mir mein Geschlecht so heftig übel nehmen, dann weil es das Werkzeug meiner Rettung ist, ohne sie, ja ihren Wünschen und Gesetzen zuwider. Es ist mein Glück und mein schuldbewusstes Mysterium. Ich grabe mich immer tiefer hinein, es höhlt mir den Bauch aus. Picasso ist ein Halt auf dieser Reise durch die Himmel der Sinne. Ich will ihn befragen, mich in seiner Haut bewegen, die im Wind ausgebreitet ist wie ein Stück Wäsche, seine farbigen Ängste durchstöbern. Es ist ein unter Glas erstarrter Sturm, ein mittendrin angehaltenes Liebesspiel. Deshalb habe ich der Stille Raum gegeben, meine Tafeln gelöscht, meine Befürchtungen beiseitegeschoben und diese Bilder betrachtet, eins nach dem anderen, als handelte es sich um Koranverse.
»Ein Satyr, der gerade eine Frau getötet hätte«
Die Erotik ist ein Jägerritual. Nur dass dieser Jäger seine Beute nicht tötet. Er verführt sie, spricht mit ihr, spielt Flöte in einer Welt von Skizzen und absichtlichen Amnesien, zieht sie ins Vertrauen, nähert sich ihr mit exhumierten Traditionen, umkreist sie argwöhnisch und angespannt, errichtet das Königreich der Umwege, um sie nicht zu ängstigen. Fürchtet und hofft. Bei diesen verführerischen Annäherungen werden die immer gleichen jahrtausendealten Gesten vollzogen, es gibt nächtliche Augenblicke und taghelle Augenblicke, Augenblicke des Geduldens und solche der Kontemplation, und seitens des Liebenden dann eine letzte verrückte Kadenz, nahe am Schmerz, wenn er die in ihrem Schweiß fliehende Trophäe ergreift. Das ist seit jeher der unausweichliche Verlauf. Aber hier endet der Vergleich mit der Jagd.
In der Erotik, anders als beim Hunger, lässt sich der Jäger gern von seiner Beute verschlingen, er liebt es, sich in ihr zu verlieren, in ihr zu vergraben, in ihr die Spuren seines Namens, seiner Grenzen, seiner Zeit auszulöschen. Das klingt wirr, wenn man es sagt, aber wenn man es erlebt, ist es sehr klar, für jeden von uns, im Alltag. Es genügt, den Hunger der Liebe und den Durst des Körpers zu erleben. Dieses Verlangen ist dem Dichter und dem Schalterbeamten gemein. Die Erotik ist eine Kunst zu zweit, die Begegnung zweier Körper, aber immer träumt der eine, sich den anderen einzuverleiben. Ihn seinem Hunger, seiner panischen Vorstellung, nicht ganz und nicht vollständig zu sein, zu unterwerfen. Es ist ein selbstmörderischer Kannibalismus, man verkündet, den anderen verschlingen zu wollen, um satt zu werden, aber sobald man umarmt, bei der ersten Geste des Eindringens oder des Knetens des Fleisches, gibt man dem verworrenen Verlangen nach, sich im tiefsten Inneren des geliebten Wesens zu vergraben, zum äußersten Punkt seines Geschlechts zu gelangen und im Nichts aufzutauchen, zum Inneren des anderen zu werden, dieses Innere zu sein. Man will zugrunde gehen – sofern dieses Verb seinen strikten Sinn behält und nicht zerbrechen oder untergehen bedeutet. Bei der Jagd will man einen Hunger mit dem Fleisch des anderen stillen, in der Erotik will man einen Hunger stillen, indem man zum Fleisch des anderen wird. Das ist ein tyrannischeres Verschlingen, eine Vermischung von Säften, ein Kauen nicht nur des Mundes, sondern des ganzen Körpers, der zum Gaumen wird.
Es ist das Gegenteil des Geborenwerdens, und doch ist es wiederum eine Geburt. Denn man kommt unter Schreien zur Welt, man hat Mühe zu atmen, gestikuliert wild mit allen Gliedern und ist mit Unendlichem und Säften benetzt. Genau wie beim erotischen Verschlingen. Man spielt dieselbe Szene noch einmal: Man will in den geliebten Bauch zurück, man verwandelt die Sprachen, die man gelernt hat, in Gurgeln und Seufzen, man verlernt das Laufen und kriecht, man tauscht seine Haut gegen köstliche Feuchtigkeiten, man zieht sich zusammen und will vor die Zeit des Körpers zurück zum Ei. Ist Liebemachen also gleich Sterben? Nein, es heißt von Neuem geboren werden, aber auch das Nichts und den Akt der Geburt noch einmal durchleben. Man spielt die älteste aller Szenen nach. Den Null-Moment. Jeder von uns erliegt dem, sucht danach in Riten, Schriften, Annäherungen, Verführungen oder verzweifelten Fantasmen. Es ist das Gesetz unserer Gattung, unseres uralten Hungers. Mit jemandem schlafen heißt auch, von eigener Hand und der Hand des begehrten Wesens wiedergeboren werden. Für den Erotomanen spielt sich das Leben, mit kurzen Unterbrechungen, zwischen den Beinen ab. Liest man die Schriften der großen Traditionen wieder, ohne sich über sie lustig zu machen, wird man im Mund des Geliebten, der Geliebten, des religiösen Ekstatikers und des Schürzenjägers dieselben Seufzer finden. Die Schreie der Mystiker gleichen manchmal geradezu lächerlich denen der Schauspieler in Sexfilmen, werden die Zyniker nicht müde zu sagen. In jedem vollkommenen Orgasmus wird man neu geboren.
Der Anwärter auf den köstlichen Tod durch das Geschlecht zerreißt, entbeint, verrenkt sich, von außen gesehen, bis zur Lächerlichkeit, wenn er Liebe macht, wenn sein Blut, seine Haut sich verliert, wenn er in den Eingeweiden eines anderen ächzt wie ein Drache und kaum zu Atem kommt. Dieselben Gesten, von jedem Paar wiederholt, das sich liebt. Es gibt Routine in der Ewigkeit, aber ist das nicht gerade die Definition der Ewigkeit? Das Begehren ist ein ins Gegenteil verkehrter Hunger, ein Hunger nach Tod, nach dem Nichts vielleicht, nach dem Verschlungenwerden von einem anderen, man nennt den Orgasmus oder andere Momente der Erfüllung ja auch den kleinen Tod. Ein in tausenderlei Gestalt erneuertes Ritual: in Schriften, Tänzen, Gemälden, Ekstasen und Gesängen, und immer ist da dieselbe komische Leichtigkeit der Verführung mit Witz und Lockungen. Jedes Mal handelt es sich um dieselbe Bewegung: Man tauscht den Körper, man trennt sich von seinem Fleisch, das heißt, man verliert seinen Körper, um wieder Fleisch zu werden beziehungsweise ein anderes zu gewinnen, es zu besitzen, ja für ein paar Zehntelsekunden darin aufgehoben zu sein. Beim Ertasten des geliebten Wesens bist du ein Gott, genau in dem Moment, wenn er in seiner Töpferwerkstatt geistesabwesend zögert.
Während des Liebesakts, im Eindringen des Geschlechts, schließt man paradoxerweise die Augen, obwohl lieben heißt, ständig das Gesicht des anderen anzuschauen. Man schließt die Augen aber nur, weil es für den Jäger wesentlich ist, wieder Dunkelheit zu schaffen, sich zum Nachtwandler zu machen, um besser zuzupacken. Denn was man ergreifen will, ist nicht der äußere Körper, sondern die laue Dunkelheit des Inneren. Ich schließe die Augen, und deshalb erlebe ich deinen Körper in deiner eigenen Dunkelheit, ich schließe mich an dein Adernetz an. Ich teile deinen blinden Fleck, der dich beschwert. Ich verschmelze mit dir, und das gelingt mir aufgrund meines Getrenntseins nur dank der Nacht, die meine geschlossenen Lider schaffen.
Das ist unermesslich, von außen betrachtet jedoch sieht der Akt der Vereinigung, die Liebe, dieser große Gesang, wie eine armselige Muskelmechanik aus, ein routinemäßiges Hin und Zurück. Eine Eindringlichkeit.
Besessen also teilt man das Los aller lebenden Beute seit der bestirnten Nacht der Zeit, den Zeiten der Jagd: zerstückelt, der Kopf vom Herzen getrennt, die Eingeweide ausgebreitet, bei klarem Bewusstsein, aber ohne Einfluss auf den Lauf der Dinge (daher die Blindheit der Liebe, wie es ja auch heißt), enthäutet im ursprünglichen Sinn des Wortes, in Energie für jemand anderen verwandelt, in stumme Spannungen und erregendes Gerede. Jede Liebe ist Verschlingen, ein Kapitel des Rohen und des Gekochten.
Die Riten der Welt beweisen es. Vielleicht besteht ein unerwartetes Band zwischen Kochen und Verführen. Man spricht in beiden Fällen von Opfergaben und Geschenken, während es lediglich um Köder geht. Mit Küssen erwärmt man. Übrigens ist Wärme ein altes Maß für Gefühle, aber ursprünglich handelte es sich mit Sicherheit um Holzfeuer. Alle Metaphern der Leidenschaft sind aus der Verbrennung geschöpft. Beim erotischen Opfer vertauscht man die Rollen: Man verbrennt nicht die Beute, sondern man brennt für sie! Es ist das Gekochte, das das Rohe verschlingt. Das Rohe ist da in seiner Reglosigkeit, es vervielfacht seine Gesichter in seinen Spiegelungen, spaziert nackt oder bekleidet umher, bietet eine Schulter oder eine Lippe, die Hinterbacken oder eine Reise dar, und der Verbrannte geht darauf zu, in den Händen seine eigenen Überreste und Stücke von seinem Körper.
Allerdings ist ein grober Rhythmus einzuhalten. Die erste Bewegung ist, die Beute im Gras, im Wald, in einem Salon vom Anfang des Jahrhunderts, einer Straße, an einem Fenster oder in einem Zug zu stellen. Auf den ersten Bildern dieses »sinnlichen Jahres« 1932 fesselt Picasso die Frau, hält die Bewegungen in ihrer Umgebung an, zwingt sie, still zu sitzen, durch ein Fenster zu schauen, sich hinzulegen, die Kreisbahnen zu verlassen und zum Zentrum zu werden. Das ist die erste Feststellung bei der Erkundung dieses Ritus in den riesigen Sälen des Museums.
»Malen wie ein Blinder, der tastend ein Gesäß formt«
Wenn ich male, ist meine Haut ein Auge, all meine Hände sind eine Netzhaut, ein Mund rundet sich zur Pupille. Wie setzt sich die begehrte Frau wieder zusammen? Vor allem befindet sie sich nicht mehr in der alten Pose als Trägerin von Moden und Stoffen einer Epoche oder nackt, um die Zeit zum Moment des Begehrens zurückzudrehen. Bei Picasso ist die Frau in einem scheinbaren Wirrwarr von Nackt und Bekleidet festgehalten, mit Recht. Es ist das Porträt der Verführung in ihrer Augenfälligkeit: Die Frau ist nicht nur Körper, auch nicht nur Kleid. Sie setzt sich aus ausholenden Gesten und Volumen und Haltungen zusammen, ob sie nun liegt, schläft oder an einem Fenster sinniert, aus den Farben ihrer Kleider und den Flächen nackter Haut, die diese Kleider unter den Mustern hervorblitzen lassen.
Man muss wissen, dass die Qual des Kannibalen zutiefst mit dem unmöglichen Körper zusammenhängt. Dem, den er verschlingen und von dem er zugleich verschlungen werden will, wie schon gesagt. Er malt ihn also wie ein Jäger, den Körper in seiner Bewegung, wenn er auf die Stoffe und Materialien der Welt und ihre Gegenstände trifft, und in seiner scheinbaren Reglosigkeit, wenn die Zeit der Treibjagd still steht, in seiner Vergötterung.