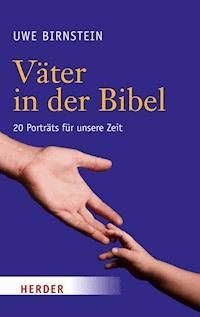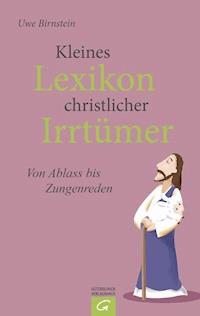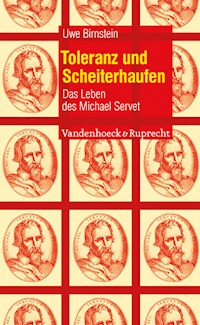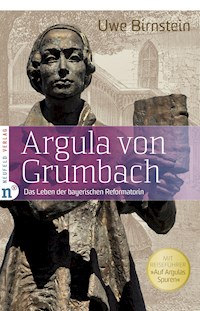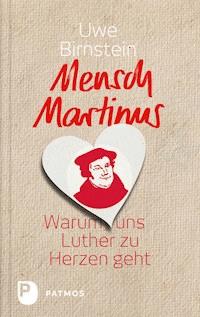
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Er war ein Sturkopf und sensibler Seelsorger, ein sorgender Familienvater und treuer Freund, ein Mann, der zu seinen Ängsten wie zu seinem Glauben stand. Uwe Birnstein stellt die menschlichen Seiten Luthers vor, das, was uns anrührt, nicht kitschig, aber menschelnd. Mit vielen Anekdoten und Alltagsgeschichten schildert er den Menschen Martin Luther, jenseits der kirchenpolitischen und theologischen Bedeutung. Keine Kurzbiografie, sondern ein Buch, das Luther sympathisch nahebringt und seine für uns heute tröstlichen Impulse aufzeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Leseempfehlung
Uwe Birnstein
Mensch Martinus
Warum uns Luther zu Herzen geht
Patmos Verlag
INHALT
Vorwort
Erstes Kapitel
Das Kind
»In Kindern erlebst du Gott auf frischer Tat.«
Zweites Kapitel
Der junge Mann
»Jugend ist wie Most. Der lässt sich nicht halten.«
Drittes Kapitel
Der Angstgeplagte
»Anfechtungen sind Umarmungen Gottes.«
Viertes Kapitel
Der Fromme
»Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.«
Fünftes Kapitel
Der Mutige
»Warum soll ich mich fürchten und erschrecken?«
Sechstes Kapitel
Der Freund
»Eure Traurigkeit ist für mich das größte Übel, Eure Freude ist auch die meine.«
Siebentes Kapitel
Der Ehemann
»Martinus Luther, dein Herzliebchen«
Achtes Kapitel
Der Vater
»Je mehr Kinder, umso größeres Glück.«
Neuntes Kapitel
Der Sprachverliebte
»Viel mit wenig Worten fein, kurz anzeigen können, das ist Kunst.«
Zehntes Kapitel
Der Seelsorger
»Blumen sind Medizin für die Seele.«
Elftes Kapitel
Der Kranke
»Ich esse, was mir schmeckt, und leide darnach, was ich kann.«
Zwölftes Kapitel
Der Sterbende
»Mitten im Tode sind wir von Leben umfangen.«
Zeittafel
Literatur
Martin Luther? Der steigt zu Kopf. 80 000 Seiten hat er hinterlassen, Respekt. Was für ein großer Denker und Theologe! Ein Professor, der die Bibel und so ziemlich alle Gedanken kannte, die sich die Menschen bis dahin über Gott und die Welt gemacht hatten. Einer, der sein Wissen und seine Kirchenkritik so formulierte, dass neue kühne theologische Gebilde entstanden. Da wird das Denken angeregt, Kirchenhistoriker und Theologen frohlocken und beißen sich die Zähne an manchen Lutherschriften aus.
Doch wie kommt es eigentlich, dass so viele Nichtstudierte von Martin Luther fasziniert sind? Menschen, die sich weder für die Theologie der »Zwei-Reiche-Lehre« noch das »vierfache Schriftprinzip« interessieren? Die nicht jedes Zitat daraufhin überprüfen, ob er es wirklich und genau so gesagt hat?
Meine Vermutung: Sie spüren, dass Martin Luthers Lebenserfahrungen zu Herzen gehen. Wer sich mit dem Lebenslauf des Reformators beschäftigt, erkennt rasch: Martin Luther, der große Reformator, erlebte dieselben Freuden und Ängste wie wir heute. Er kannte Liebe und Leid, Alltagsfrust und Liebeslust, Vaterfreuden und Zipperlein. Er war mal launisch und mal überschwänglich, haute rau auf den Tisch und liebkoste seine Kinder. Mal war er von Angst und Zweifeln geplagt, mal zeigte er Rückgrat und beträchtliche Courage. Er liebte seine Freunde und pflegte seine Feindschaften, schaute dem Volk aufs Maul, redete ihm aber nicht nach dem Mund. Ja sogar eine gesunde Portion Aberglaube hat sich Martin Luther genehmigt. Er glaubte an Christus, aber auch an den Teufel und an Hexen. Leider, leider, entwickelte er grobe Gewaltfantasien gegenüber aufständischen Bauern, schwärmerischen Christen und Juden, die sich nicht missionieren lassen wollten. Und im Alter stimmte ihn traurig, dass seine Idee nicht Wirklichkeit geworden war: Die Gesamtkirche war nicht rundumerneuert, sondern nun gab es zwei Kirchen.
Ja, all das geht zu Herzen. Wie er Abgründe durchschritt und wie naiv fromm er sich an Christus klammerte und die Hoffnung auf Gottes Liebe nicht aufgab – darin ist Martinus uns erstaunlich nah.
Lutherstadt Wittenberg, August 2016
Uwe Birnstein
»In Kindern erlebst duGott auf frischer Tat.«
Erstes Kapitel
in dem wir mit ansehen müssen, wie der kleine Martinus von Eltern und Lehrern geschlagen und geschunden wird. Gleichzeitig erkennen wir seine Wissbegierde und ahnen, dass Vater Hans Luder der eigentliche Auslöser für die Reformation gewesen sein könnte.
Die Wurzeln des Lebens liegen in der Kindheit. Das ahnt Martinus auch, als er am Ende seines Lebens zurückblickt: »Im Jahre 1483 bin ich, Martin Luther, geboren von meinem Vater Johannes Luther und meiner Mutter Margaretha. Mein Vaterland war Mansfeld. Ich bin eines Bauern Sohn, mein Vater, Großvater, Ahnherr sind rechte Bauern gewesen. Danach ist mein Vater gen Mansfeld gezogen und daselbst ein Berghauer geworden […] Die Mutter hat all ihr Holz auf dem Rücken zusammengetragen, also haben sie uns erzogen.« Die äußeren Daten mögen stimmen – sein inneres Erleben jedoch spiegelt die spröde Notiz nicht. Denn als Kind hat Martinus vieles erleben und erleiden müssen, was seinen Lebensweg prägte. Aber der Reihe nach.
Am 10. November 1483 wird Martinus geboren; schon am nächsten Tag bringt der Vater seinen Sohn zum Pfarrer Bartholomäus Rennbrecher. Die Kindersterblichkeit ist hoch –deshalb lassen Eltern ihre Säuglinge schnell taufen. Schließlich gilt nur die Taufe als Garant dafür, dass die Kinder im Fall des Todes in den Himmel kommen. Das damalige Ritual ist dramatisch: Noch vor der Kirche nimmt der Priester einen Exorzismus am Täufling vor. Nase und Ohren werden mit einem Gemisch aus Speichel und Erde beschmiert, das soll böse Geister vertreiben. Dann geht es in die Kirche zum Taufstein. Es ist der 11. November, Tag des heiligen Martin. Dessen Namen soll das Baby tragen. Martin. Martin Luder.
Schon bald steht ein Umzug an: Die kleine Familie zieht ins nahe Mansfeld. Der Vater arbeitet als Hüttenmeister, hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Hier, am Ostrand des Harzes, leben viele Menschen vom Bergbau. Seine Eltern hätten »harte Arbeit ausgestanden, dergleichen die Welt jetzt nicht mehr ertrüge«, schreibt Martinus später. Hans Luder ist gut im Geschäft. Zwei Häuser an der Hauptstraße kauft er. Große Erzvorkommen gibt es hier. Aus dem Gestein wird Kupfer gewonnen – ein Metall, das in riesigen Mengen benötigt wird. Kupfer aus Sachsen schimmert auf den Dächern von Kirchen und Palästen. Für den Bau von Kanonen wird es gebraucht. Buchdrucker verwenden es für die Lettern. Ein weiteres, noch edleres Metall verbirgt sich im Erz: Silber. Um in diesem Geschäft mitmischen zu können, braucht Hans Luder Geld. Er leiht es sich von der Familie seiner Frau; damit kann er Hüttenfeuer kaufen, in denen er die kostbaren Metalle aus dem Gestein herausschmilzt. Von der Ausbeute bleibt nicht viel übrig für Hans Luder: Der Pächter, also der Graf von Mansfeld, verlangt seinen Tribut. Die Kredite wollen abgezahlt werden. Doch die Geschäfte florieren. Das hängt auch mit der wachsenden Nachfrage nach Silbermünzen zusammen. Kurfürst Friedrich der Weise freut sich über die neuen Silberreserven. Die Münzen verschaffen ihm Unabhängigkeit vom Kaiser.
Hans Luder wird unentbehrlich für den Mansfelder Grafen, berät ihn auch und wird Mitglied des Magistrates.
Elterliche Strenge
Martinus spürt: Der Vater ist angesehen. Der seinerseits plant seinen Stammhalter fest in das Familienunternehmen ein. Martinus soll Jurist werden. Verträge müssen aufgesetzt, Schürfrechte verhandelt, bisweilen auch Prozesse geführt werden. Hier einen vertrauenswürdigen Compagnon zur Seite zu haben, wäre nützlich.
Vielleicht ist es dieser feste Lebensplan für seinen Sohn, der Hans Luder zu rüden Erziehungsmethoden greifen lässt. Körperliche Züchtigung gehört dazu. Oft muss Martinus vor der Rute seines Vaters fliehen. Bei der Mutter Margarethe findet er keine Sicherheit. »Meine Mutter schlug mich einmal um einer einzigen Nuss willen, dass das Blut hernach floss.« Die Eltern hätten es »herzlich gut« gemeint, redet Martinus sich die erlittene elterliche Gewalt als Erwachsener schön und gewinnt ihr sogar pädagogischen Sinn ab, denn »die Strafe haftet viel fester als die Wohltat«. Auf den Ölporträts, die Lucas Cranach 1527 von den Eltern während ihres Wittenbergbesuches malt, ist ihnen die Strenge anzusehen: Hans Luder blickt bestimmt und unnachgiebig drein, die Stirn ernst und zweifelnd zusammengezogen. Stolz trägt er einen Pelzkragen, Insignie des wohlhabenden bürgerlichen Lebens. Mutter Margarethe hingegen blickt mit zusammengekniffenen Lippen etwas traurig nach unten. Martinus’ Freund Georg Spalatin behauptet später, »Dr. Martin« ähnele seine Mutter »an Körperbau und Gesichtszügen«. »Mir und dir ist niemand hold, das ist unser beider Schuld«, soll Margarethe dem kleinen Martinus oft vorgesungen haben. Das klingt nach Schwermut. Kein Wunder bei den täglichen Strapazen und Sorgen, die sie wohl oft alleine ertragen muss. Denn während Vater Hans sich zum Manager in Sachen Bergbau entwickelt, gebiert Mutter Margarethe viele Kinder. Sieben oder acht Geschwister kommen zur Welt, nur vier überleben ihre Kindheit: Jacob und Margaretha, Elisabeth und Dorothea. Martinus lernt den Tod schon früh aus nächster Nähe kennen.
Stockmeister, fromme Brüder und gute Lehrer
Zu Hause lehrt das Leben – in der Schule stehen Grammatik und Logik auf dem Programm. Direkt neben dem Neubau der St.-Georg-Kirche steht das Schulgebäude, Martinus kann den Fortgang der Bauarbeiten an der Kirche beobachten. Sein »guter alter Freund Nikolaus Oemler« trägt Martinus manchmal Huckepack zur Schule. Die Lehrer verbreiten ein ähnliches Schreckensregiment wie sein Vater. Die Kinder dürfen nur lateinisch reden, spricht einer Deutsch, setzt es Schläge mit der Rute. »Grausam wie die Henker« sind die Lehrer, sie führen sich wie »ungeschickte Tyrannen und Stockmeister« auf. Martinus erlebt den Unterricht als »Hölle und Fegefeuer, darinnen wir gemartert sind«. Die Lehrer installieren ein ausgefeiltes Spitzelsystem: Jeder Schüler muss die Sünden der Kameraden aufschreiben; einmal in der Woche gibt es die Strafe dafür: Schläge mit der Rute. Auch stellen die Lehrer ihre Schüler bloß: Wer nicht pariert, bekommt eine Eselsmaske aufgesetzt und muss isoliert auf der Eselsbank sitzen. Die »strenge Zucht« der Schule, noch mehr die der Eltern, habe ihn in die »Möncherei« getrieben, schreibt Martinus später: »Ihr ernst und gestreng Leben, das sie mit mir führten, verursachte mich, dass ich zuletzt in ein Kloster lief; wiewohl sie es herzlich gut gemeint haben, wurde ich doch allzu erschrockenen Gemüts.«
Mit 13 Jahren kann er den Eltern zum ersten Mal entfliehen. Immer das Berufsziel Jurist vor Augen, schickt Vater Hans seinen Sohn Ostern 1497 auf die Schule nach Magdeburg. Achtzig Kilometer Wegstrecke liegt vor Martinus, Freund Hans Reinicke begleitet ihn. Aus der Ferne sehen die beiden den Dom in den Himmel ragen, mehr als hundert Meter hoch. Den beiden Jungs wird klar: Die Enge und Provinzialität von Mansfeld lassen sie gänzlich hinter sich. Magdeburg ist eine Weltstadt. Am Elbhafen herrscht reges Treiben. So viele neue Eindrücke! Auch hier liegt die Schule neben der Kirche, dem Dom. Die »Brüder vom gemeinsamen Leben« unterrichten hier, eine klosterähnliche Gemeinschaft, die eine tief verinnerlichte Frömmigkeit lebt, jedoch ohne ein Gelübde abzulegen. Mystik ist ihnen wichtiger als die Teilnahme an der Messe oder an Andachten. Der Blick auf das Leiden Christi steht im Mittelpunkt. Zwar sind die Brüder der Kirche treu ergeben, doch eigentlich suchen sie die direkte Beziehung zu Gott ohne den Umweg über Rituale oder kirchlichen Gehorsam. Die Frömmigkeit der sognannten »Nullbrüder« prägt Martinus.
Bald jedoch steht wieder ein Schulwechsel an. Vielleicht ist die Magdeburger Schule Vater Hans zu fromm für seinen Sohn? Er soll schließlich kein Theologe, sondern Jurist werden! Nun hat der Vater die Eisenacher Schule im Blick. Sie hat einen guten Ruf, hier drücken die Söhne der angesehensten Familien die Schulbank. 1498 beendet Martinus also sein Magdeburger Zwischenspiel und zieht nach Eisenach, seine »gute, liebe Stadt«. In der Tat sind die Lehrer hier besser ausgebildet, das Lernniveau ist hoch und nicht auf stupides Auswendiglernen zugeschnitten wie in Mansfeld. Die Lehrer demütigen die Schüler nicht, sondern ziehen zur Begrüßung sogar respektvoll den Hut, »weil Gott manchen von diesen zu einem Bürgermeister, Kanzler, Doktor oder Regenten bestimmt haben könnte«.
Unterkunft findet Martinus bei den Familien angesehener Eisenacher Bürger. Auch der Priester Johannes Braun gehört zu seinem neuen Bekanntenkreis – er entfacht in Martinus die Freude am Musizieren. So große Lust am Singen hat Martinus, dass er bald als Kurrendesänger von Haus zu Haus zieht und die Herzen so mancher Eisenacher erreicht, namentlich das der Bürgersfrau Ursula Cotta. Die Zuneigung ist beiderseitig – oft sitzt Martinus im vornehmen Hause Cotta zu Tisch und lernt Manieren. Von ihr merkt er sich einen Spruch, den er später zitiert: »Es ist kein lieber Ding auf Erden denn Frauenliebe.«
In die Lebensfreude mischt sich aber auch Unheimliches. Zum Beispiel sitzt hinter den Mauern des Dominikanerklosters ein alter Theologe in Haft. Der Franziskaner Johannes Hilten hatte die Kirche scharf kritisiert, ihr Verweltlichung vorgeworfen, Sünde und Verfall. Außerdem hatte Hilten wie ein Prophet seltsame Dinge vorhergesagt. Zum Beispiel, dass im Jahr 1516 ein Mann kommen werde, der die Kirche erneuere. Dafür wurde ihm der Prozess gemacht, nun sitzt der alte Mann hinter Gittern. Erstaunlich, wundert sich Martinus.
Fürs Leben geprägt
Eine überwiegend harte Kinderzeit nähert sich dem Ende. In zwei Aspekten zeitigt sie bei dem erwachsenen Martinus Folgen. Zum einen: Anders als er selbst es erlebte, ist er später seinen Kindern ein liebevoller Vater. Martinus weiß aus eigener, leidvoller Erfahrung, dass Schläge und Demütigungen Narben in den Seelen der Kinder hinterlassen. »Weil die Kinder vor einem jeden Wort des Vaters oder der Mutter erzittern, fürchten sie sich auch später ihr Leben lang selbst vor einem rauschenden Blatt.« Vielleicht ist es auch eine Kritik an der Glaubensferne seines Vaters, wenn er sagt: »Dass Kinder wohl geraten, ist nicht in unserer, sondern Gottes Gewalt und Macht.« Eine entlastende Aussage, die zwischen den Zeilen die Botschaft trägt: Auch mit Strenge lassen sich Kinder letztlich nicht so formen, dass sie alle Wünsche ihrer Eltern erfüllen.
Die zweite Lehre seiner Kindheit: Die Schulen müssen besser werden. Dass die Lehrer der Mansfelder Grundschule so unduldsam und rau waren, lag auch an der schlechten Bezahlung, wird ihm klar. »Kuh- und Sauhirten« bekommen einen größeren Lohn als Schulmeister, moniert ein damaliger Lehrer. Bestandteil der Schulreform, die Martinus später durchführt, ist folgerichtig die bessere Bezahlung der Lehrer. »Einen fleißigen, frommen Schulmeister kann man nimmer genug lohnen und mit Geld bezahlen«, betont er. Die Ratsherren fordert er auf, viel mehr Geld für die »arme Jugend« bereitzustellen.
Eine harte Kindheit hat Martinus hinter sich, als er 1501 die Eisenacher Schule abschließt und sich in Erfurt zum Studium einschreibt. Jura – so wie der Vater es will. Und das, obwohl Martinus das alte Sprichwort, das er später zitiert, wahrscheinlich schon jetzt kennt: »Ein Jurist, ein böser Christ.«
»Jugend ist wie Most.Der lässt sich nicht halten.«
Zweites Kapitel
in dem uns der junge Martinus weltlich befreit begegnet: als trinkender und feiernder Student in der Metropole Erfurt. Wir können uns das Schmunzeln darüber nicht verkneifen, dass Martinus mit Hilfe Gottes und eines Gewitters den väterlichen Berufswunsch umgeht.
»Endlich«, denkt Vater Hans vermutlich: »Mein Sohn läuft in die berufliche Zielgerade ein. Am Ende kehrt er als Jurist zurück. Die Mühen des Studiums wird er schaffen.« Obwohl: Erfurts ehrwürdige Universität, bei der sich Martinus im Frühjahr 1501 zum Grundstudium immatrikuliert, ist anspruchsvoll. Sie genießt einen guten Ruf, auch die juristische Fakultät. Im Vergleich zu ihr seien andere Universitäten nur »kleine Schützenschulen«, meint Martinus.