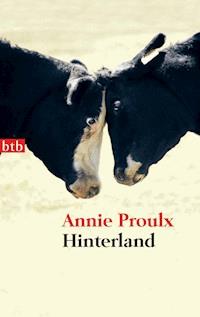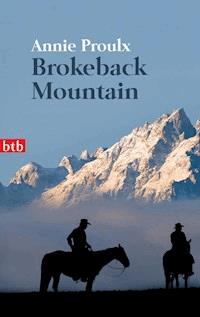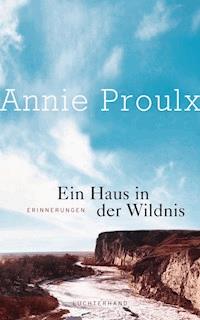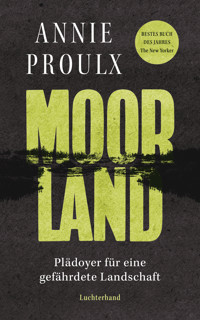
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Pulitzer-Preisträgerin Annie Proulx über die Schönheit und Gefährdung eines einzigartigen Ökosystems. - »Bestes Buch des Jahres.« The New Yorker
Pulitzer-Preisträgerin und passionierte Umweltschützerin Annie Proulx erzählt von der Schönheit und Magie der Moorlandschaften – und von der Gefährdung dieses unterschätzten, aber einzigartigen Ökosystems. Sie begibt sich auf eine faszinierende Reise in die Torfmoore Englands, in die endlos weiten Feuchtgebiete an der kanadischen Hudson Bay, die schwarzen Wasser der sibirischen Wassjuganje und in die heißen Sümpfe Floridas. »Moorland« ist ein mitreißend erzähltes, leidenschaftliches Plädoyer für den Kampf gegen den Klimawandel. »Ein bestechend schönes, kluges Buch, das Ihnen die Augen öffnen wird.«
The Telegraph
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Ähnliche
Zum Buch
Pulitzer-Preisträgerin und passionierte Umweltschützerin Annie Proulx erzählt von der Schönheit und Magie der Moorlandschaften – und von der Gefährdung dieses unterschätzten, aber einzigartigen Ökosystems. Sie begibt sich auf eine faszinierende Reise in die Torfmoore Englands, in die endlos weiten Feuchtgebiete an der kanadischen Hudson Bay, die schwarzen Wasser der sibirischen Wassjuganje und in die heißen Sümpfe Floridas. »Moorland« ist ein mitreißend erzähltes, leidenschaftliches Plädoyer für den Kampf gegen den Klimawandel.
»Ein bestechend schönes, kluges Buch, das Ihnen die Augen öffnen wird.« The Telegraph
Zur Autorin
Annie Proulx wurde für ihre Romane und Erzählungen mit allen wichtigen Literaturpreisen Amerikas ausgezeichnet, dem PEN/Faulkner Award, dem Pulitzer-Preis, dem National Book Award sowie dem Irish Times International Fiction Prize. Außerdem wurde sie in die American Academy of Arts and Letters aufgenommen. Die Verfilmung ihrer legendären Kurzgeschichte »Brokeback Mountain« wurde 2005 mit drei Oscars ausgezeichnet. Annie Proulx lebt in New Hampshire.
Zum Übersetzer
Thomas Gunkel übersetzt Literatur aus dem Englischen, u. a. John Cheever, Stewart O’Nan, William Trevor und Richard Yates.
Annie Proulx
Moorland
Plädoyer für eine gefährdete Landschaft
Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Fen, Bog & Swamp« bei Simon & Schuster, Inc., New York.Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 Dead Line Ltd.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2023 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign I Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © Ruth Botzenhardt
Abbildungen im Text: Abb. 1 © Josiah Wood Whymper / Abb. 2 © Universal History Archive/Contributor / Abb. 3 © Christine Bond @Remco de Fouw / Abb. 4 © courtesy of The History Museum, South Bend, Indiana
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-29911-8V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Dieses schmale Buch ist den Bewohnern von Ecuador gewidmet. Sie erreichten, dass ihr Land als erstes weltweit einen Rechtsanspruch für natürliche Ökosysteme in die Verfassung aufnahm. Das kürzlich gefällte Gerichtsurteil zum Schutz des Anden-Regenwalds Los Cedros vor dem Bergbau ist für die Welt ein bedeutsames Ereignis.
Warum Nieder-, Hoch- und Waldmoore?
Dieser Text war zunächst als persönlicher Essay gedacht. Ich wollte die Feuchtgebiete verstehen, die so eng mit der Klimakrise verknüpft sind. Zu diesem Thema gibt es so viel Literatur, dass ich mich auf torfbildende Feuchtgebiete beschränken musste, die die Treibhausgase CO2 und Methan speichern – auf Nieder-, Hoch- und Waldmoore und den jahrhundertelangen Umgang des Menschen mit ihnen. So wurde aus dem Essay dieses Büchlein. Ich bin keine Wissenschaftlerin und habe mich bemüht, das spezifische Vokabular zu vermeiden, das in dem gefundenen Material vorherrscht, denn ich glaube, dass diese Art von Fachsprache erheblich zur Entfremdung zwischen Wissenschaft und normalem Leser beiträgt.
Es gibt Menschen, die Vorstellungen und ihre Zusammenhänge gern an ungewöhnlichen Orten und in alten Büchern aufspüren. Das gilt auch für mich. Ich bin leicht zu verzaubern, wenn auf einer Buchseite eine seltsame Vorstellung oder Formulierung erscheint und, was oft der Fall ist, eine unsichtbare Verknüpfung herstellt. Das gleicht einem nebligen Sommermorgen: wenn wir mit Wassertropfen verzierte Spinnennetze sehen, die zwischen Stängeln und Stielen, zwischen Bäumen und Boden, zwischen Zweigen und Laub gespannt sind. Sobald die Sonne die Erde erwärmt, verdunsten die Tropfen und der trügerische Eindruck, die ganze Welt werde von feinen Spinnweben zusammengehalten, verdunstet mit ihnen.
Annie Proulx
Niedermoor: Ein Niedermoor ist ein torfbildendes Feuchtgebiet, das zumindest teilweise von Gewässern gespeist wird, die mit mineralischen Böden in Verbindung stehen, wie aus höheren Lagen herabströmenden Flüssen und Bächen. Dieses minerotrophe Wasser kann Schilf und Sumpfgräser begünstigen. Das Wasser ist dort in der Regel tief.
Hochmoor: Ein Hochmoor ist ein torfbildendes Feuchtgebiet mit einer Wasserquelle, die nicht mit mineralischen Böden in Verbindung steht, sondern Niederschlag braucht. Dieses ombrotrophe Wasser begünstigt Torfmoose. Das Wasser ist dort in der Regel flacher als in einem Niedermoor.
Waldmoor: Ein Waldmoor ist ein minerotrophes torfbildendes Feuchtgebiet, das von Bäumen und Sträuchern beherrscht wird. Das Wasser ist dort meist flacher als in einem Niedermoor oder Hochmoor.
Bei den Definitionen und Erklärungen der Abläufe in Feuchtgebieten folge ich William J. Mitsch und James G. Gosselink: Wetlands. 5. Auflage. Wiley 2015.
1. Verschiedene Gedanken über Feuchtgebiete
Abenteuer mit Krauskopfarassarisvon Josiah Wood Whymper
Ich bin davon überzeugt, dass die Zeit, in die man hineingeboren wird, das Verständnis prägt, das der jeweilige Mensch von der Natur hat. Ich wurde 1935 im noch ländlichen Osten Connecticuts geboren. Meine Eltern stammten beide von nordamerikanischen Siedlern aus dem 17. Jahrhundert ab. 1935 lag der Übergang von selbstständiger Landwirtschaft zur Arbeit in einer Textilfabrik schon zwei Generationen zurück, und sie hatten mit dem neuzeitlichen Übergang von der Arbeit in einer Textilfabrik zu einem Mittelschichtleben als Büroangestellte zu kämpfen. Trotzdem hielten beide Familien noch Hühner und eine Kuh. In der Familie meiner Mutter gab es auch Möbeltischler und Künstler. Sie waren alle naturverbunden und kannten die Gewohnheiten und Lebensräume von Vögeln, Insekten und Amphibien ebenso wie die Namen aller Wildblumen und aller Bäume mitsamt den Verwendungsmöglichkeiten des jeweiligen Holzes. Sie hatten ein Camp am Lake Quinebaug, wo meine Cousinen und Cousins und ich schwimmen lernten. Sie liebten die moosigen stillen Wälder und beobachteten voller Begeisterung, wie die Habichte im Frühling nach Norden zogen. Meine früheste Kindheitserinnerung ist, dass ich unter einem Baum schlafen gelegt wurde und Sonnenlicht durchs Laub sickerte. Damals bekam ich erste Eindrücke von der verwirrenden Vielschichtigkeit der Natur. In dieser Kindheit, in der ich beim Erkennen eines Sassafrasbaums an seinen handschuhförmigen Blättern das Gefühl hatte, am Waldrand einen Freund gefunden zu haben, bin ich verwurzelt. Ich dachte, ich wüsste einiges von der Welt.
Als ich älter wurde und las und reiste, erfuhr ich, dass die 1930er Jahre eine Zeit üblen menschlichen Verhaltens waren, in einer Welt, die sich selbstgefällig für »zivilisiert« erachtete – eine Zeit wirtschaftlichen Zusammenbruchs, weltweiter Rezession und Massenarmut, eine Zeit schwerer Dürreperioden, Gulags, autokratischer Herrscher, heftiger nationalistischer Demagogie, ethnischer Gräueltaten, eine Zeit der Waldrodungen, Lynchmorde, Gangster und des illegalen Handels. Stets im Namen des Fortschritts plünderten die westlichen Staaten Mineralien, Holz und Tierwelt ihres eigenen Landes ebenso wie die anderer Länder. Sie bauten Dämme und legten Feuchtgebiete trocken. Es war die Zeit, als der Elfenbeinspecht in den Waldmooren der Südstaaten ausstarb. Regierungen und Unternehmer begradigten und stauten Flussläufe, begruben Küstenlinien unter Steinaufschüttungen, sprengten Berge und trieben tiefe Stollen hinein, verschmutzten die Luft. Doch der Beginn meines Lebens in der Mitte dieses berüchtigten Jahrzehnts, das zu einem größeren, »Psychozoikum« genannten Zeitrahmen gehört, wirkt inzwischen wie eine Zeitkapsel-Anomalie. Heute betrachte ich diese Zeit als Vorboten unserer schlimmen Gegenwart, aber 1938 war ich gerade mal drei Jahre alt und wusste nichts von drohendem Krieg, blutrünstigen Diktatoren, frohlockenden Geschäftemachern, die die Wildnis zerstörten, von Pandemien, Revolten oder schädlicher Drogenpolitik.
Die ländliche Welt meiner Kindheit bescherte immer neue Erfahrungen. Eines Tages führte mich meine Mutter durch ein Blaubeerdickicht zu einem Moor, wo sie von trockenem Land auf ein Grasbüschel und von dort auf das nächste sprang und ich ihr zu folgen versuchte. Ich schaffte es auf ein bebendes Büschel und schaute hinunter ins Wasser. Etwas wirbelte eine blasse Schlammwolke auf. Der Arm meiner Mutter hob und senkte sich in einem ausdrucksvollen Bogen. Das nächste Büschel war weit entfernt, und über die Grashalme spannte sich ein Netz, in dessen Mitte eine Zickzacklinie verlief und eine gelbschwarz getigerte Spinne hockte. Wenn ich sprang, würde ich im bedrohlichen Wasser oder in den Fängen der Spinne landen. Also brach ich in Tränen aus, meine Mutter trug mich wieder auf festen Boden, und wir gingen außen ums Moor herum und, wo es möglich war, auch hinein, vorbei an toten Baumstümpfen, die von wütenden Vögeln bewacht wurden, und an Tümpeln mit Seerosen, deren einschläfernden Geruch kein Parfümeur je nachgeahmt hat. Tausende von Spinnenfäden zierten Halme und Schilfrohr, hingen an halb versunkenen Baumstämmen. Überall waren Frösche, deren aufgeklappte Augen über die Ränder von Seerosenblättern hinwegstarrten. Unsichtbare Wesen platschten in ihr Versteck. Es war aufregend und zugleich beängstigend. An diesem Ort, so fremd und unvertraut, machte ich meine erste Erfahrung mit geografischer Andersartigkeit, erlebte meinen ersten Nervenkitzel beim Betreten einer Terra incognita. Sehr treffend beschreibt der polnische Künstler und Schriftsteller Bruno Schulz diesen Moment: »… wir [gelangen] in der Kindheit zu bestimmten Bildern mit entscheidender Bedeutung für uns […]. Sie spielen die Rolle der Fäden in chemischen Lösungen, um die herum sich für uns der Sinn der Welt kristallisiert.« Für mich ist diese Aussage wahr. Hoffentlich war sie es auch für Schulz, hoffentlich galt sein letzter Gedanke einem goldenen Kindheitsbild – vielleicht der leuchtenden Nacht, die der kindliche Erzähler in »Die Krokodilgasse« schildert, als er mondsüchtig durch die Stadt wandert, doch wahrscheinlich war es eher das Bild »einer Droschke mit aufgesetztem Kasten und brennenden Lichtern, die aus einem nächtlichen Wald herausfuhr«, das ihn ein Leben lang verfolgte.
Die Erinnerung an die Moorspinne hat mich nie verlassen. Jahre später erfuhr ich, dass die Zickzacklinie, oder das Stabilimentum, von Radnetzspinnen dazu dienen kann, das Netz für den Fall zu verstärken, dass ein Vogel versehentlich dagegenfliegt. Manche Wissenschaftler glauben, das Stabilimentum ziehe Beutetiere an, da es aus strahlend weißer, nicht klebender Seide besteht, die für Vögel und Insekten sichtbare UV-Wellen reflektiert. Eine andere, in Behavioral Ecology erwähnte Studie hingegen ergab, dass Stabilimenta die Beute der Versuchsspinnen um fast dreißig Prozent reduzierten. Wiederum andere Wissenschaftler hingen der Vorstellung nach, es könnte der Tarnung dienen und die große farbenprächtige Spinne vor Raubtieren schützen. Manche nehmen an, dass die Spinnen Seidenreste verarbeiten, weil ihre Spinndrüsen leer sein müssen, bevor neue Seide erzeugt werden kann. Und dann ist da noch die Theorie, weibliche Spinnen würden Stabilimenta erzeugen, um Männchen anzulocken, was durchaus denkbar ist. Die einzige Vorstellung, die keinerlei Akzeptanz findet, ist der originelle Gedanke, ein Stabilimentum könnte dem Netz Stabilität verleihen. Mit anderen Worten: Wir kennen den Zweck dieser Zickzacklinien genauso wenig, wie wir wissen, wann uns die nächste Katastrophe bevorsteht.
Fortan teilte ich die Freude meiner Mutter an diesem kostbaren Ort, brauchte aber Jahre, um zu verstehen, dass das Glück beim Betrachten von Landschaften und unberührter Natur zunehmend mit Schmerz verknüpft ist. In unserem Jahrhundert verspüren viele Menschen Trauer, wenn sie von Waldrodungen, dem Verschwinden von Hummeln und Eschen, dem Verlust von Korallenriffen und Tangwäldern erfahren. Wir sehen Eisbären bei der hoffnungslosen Suche nach dem festen Eis vergangener Zeiten, sehen, dass die Beifuß- und Präriehühner in ihren Nistgebieten Schweinefarmen, Windturbinen und Highways weichen müssen.
Die Verbundenheit mit dem Ort der eigenen Herkunft kann bei Menschen ähnlich stark sein wie bei Tieren. Diese Symbiose begann in prähistorischen Zeiten, bevor unser Blick sich schärfte, und dauerte zeitlebens an, weil die Menschen bewegliche Teile der Landschaft waren. Die enge Beziehung zu ihrer Umgebung zeigt sich in der beschreibenden Sprache von Apache-Ortsnamen wie Grüne-Felsen-ragen-nebeneinander-ins-Wasser-hinunter, Grauweiden-winden-sich-um-eine-Biegung oder Pfad-erstreckt-sich-über-versengte-Felsen.
Bei Migrationen mussten unsere Vorfahren die Treue zu den alten Landschaften aufgeben, doch es blieben die Erinnerungen, emotionale Verankerungen, die sie an die Geografie ihrer Vorfahren banden – Birken im Frühjahrsregen, eine Felsbucht. Heute kann sich kaum noch jemand mit der alten Frau in Frank O’Connors Erzählung »Die lange Straße nach Ummera« identifizieren, die wie ein stromaufwärts schwimmender Lachs darum kämpft, zum Sterben heimkehren zu können. Ihr Sehnen ist von Erfolg gekrönt: »Der See glich einem Strahlentanz von lauter Mücken; die Sonnenspeichen, die wie ein großes Mühlrad kreisten, träuften ihre Kaskaden milchigen Sonnenlichts über die Berge (…) und die kleinen schwarzen Bergrinder zwischen den Vogelscheuchenfeldern.«
Ich habe im Lauf meines Lebens tausendfache Schäden gesehen, die Menschen Ökosystemen und den Lebensräumen von Wildtieren zugefügt haben: Mehr als sechzig Prozent der Flüsse weltweit wurden gestaut und die Wälder abgeholzt, was die alte Vorstellung vom Gewebe des Lebens zertrümmert hat. Wir haben uns gefährlicherweise einer weltweiten Gier hingegeben, die Biodiversität und Natur zerstört. Seit 1950 ist die Weltbevölkerung um fast zweihundert Prozent gewachsen. Unsere anschwellende, hungrige Bevölkerung quillt über wie im Titel von David Quammens Buch Spillover. Quammen vergleicht die Bevölkerungsexplosion mit einem massenhaften Auftreten von Ringelspinner-Raupen. Wenn wir dichte Wälder roden und die Wildnis in Weideland und trockengelegte Moore in Ackerflächen umwandeln, treffen wir auf andere Spezies – Vögel, Säugetiere, Reptilien, Bakterien und Viren, unbekannte Viren, deren Wirte und Lebensräume wir verdrängt oder vernichtet haben, sodass SARS, Ebola, MERS, die verschiedenen »Schweinegrippen« und Covid-19 gezwungen sind, andere Orte und andere Wirte zu finden, einschließlich des Menschen.
Asiatische Länder sind durch Bevölkerungsanstieg und intensive Waldrodung Gefahrenherde für neu auftretende Viren, doch die Grundlage all dieser Annahmen ist eine jahrtausendelange agroökologische Vermischung in dieser Region. Die Zerstörung alter Wälder, die von unbekannten Mikroorganismen bevölkert sind, bringt Menschen in Kontakt mit Viren, die man besser in Ruhe ließe. Fledermäuse bestäuben viele Pflanzen und fressen große Mengen schädlicher Insekten, sie tragen aber auch viele Viren in sich. Wenn wir sie aus ihrer evolutionären Heimat vertreiben, finden sie in Schuppen und auf Dachböden, in den verborgenen Winkeln städtischer Gebäude einen Ersatz für ihre Höhlen. Diese Tiere geben die Viren nicht direkt an den Menschen weiter. In der Regel gibt es einen Zwischenwirt, den die Menschen anfassen oder essen. Für SARS in China war das die Zibetkatze, MERS brach im Nahen Osten durch Kamele aus. Obwohl Fledermäuse und Schuppentiere auf der Verdächtigenliste der Covid-19-Zwischenwirte weit oben standen, wurde das Schuppentier inzwischen entlastet. In der Elsevier-Zeitschrift Infection, Genetics and Evolution gelangen die Autoren einer Studie über den Ursprung von Covid-19 zu folgendem Schluss: »Die wahren Auslöser für Epidemien und Pandemien sind die gesellschaftlichen Organisationsformen, das gesellschaftlich beeinflusste Verhältnis zwischen Mensch und Tier und die Verstärkungsschleifen der modernen menschlichen Gesellschaft, d. h. Kontakte, Flächenumwandlung, Märkte, internationaler Handel, Mobilität etc.« In diesem »etc.« liegt unsere Zukunft.
Die Waldrodung zur Gewinnung von Ackerflächen öffnet eine weitere Tür, hinter der wir die pulsierende Masse von Tierhaltungsanlagen, besonders für Geflügel und Schweine, finden. Rob Wallace’ Sammlung von Blog-Essays – Big Farms Make Big Flu – ist eine aggressive Untersuchung jener großflächigen Monokulturen, die Feuchtgebiete, Graslandschaften und Wälder verdrängt haben.
Unsere Spezies ist unfähig, einen sich langsam vollziehenden, subtilen Wandel zu erkennen. Wir leben im Augenblick. (Der Erfolg des Internetunternehmens Amazon basiert auf dieser Eigenschaft.) Da steht ein Baum, wir fällen ihn – und erkennen unverzüglich, dass sich etwas verändert hat. Doch wenn wir einen Baum sehen und ihn ein Jahr später wieder sehen, registrieren wir nicht die Neuaustriebe (selbstähnliche Fraktale des Baums), wir sehen keine Veränderung. Wir sind nie erstaunt über »das immer Gleiche in der Ecke eines Felds«. Wir erkennen die langsamen Metamorphosen der Natur nicht, weil wir uns von ihr gelöst haben, abgesehen vom jährlichen Urlaub, vielleicht einer Fahrt in einen Nationalpark oder einer »Naturerlebnis«-Kreuzfahrt nach Galapagos oder in die Antarktis, wo unser kurzer Aufenthalt den Lebensraum weiter schädigt.
Um allmähliche Veränderungen zu erkennen, muss man bestimmte Regionen Woche für Woche, Jahr für Jahr, immer wieder aufsuchen, Wachstum, Blüte und Verwesung aufzeichnen, die örtliche Tierwelt beobachten, das Steigen und Fallen des Wasserstands zur Kenntnis nehmen und genau hinschauen – so wie früher alle Menschen gelebt haben. Henry David Thoreau (1817–1862) aus Concord, Massachusetts, folgte der Praxis wiederholter Beobachtung. Thoreau, der als Erwachsener immer wieder an Tuberkuloseausbrüchen litt, machte jedes Frühjahr meilenweite Spaziergänge und notierte in seiner schlechten Handschrift die Zeiten, zu denen die verschiedenen Wildpflanzen blühten. Seine Aufzeichnungen für die Jahre 1852–1856 waren sehr umfangreich. Als die Tuberkulose 1857 und 1858 wieder aufwallte, versäumte er es, die Pflanzen aufzulisten. 1860 fuhr er nach Minnesota, das war seine letzte längere Reise. Zurück in Concord, überarbeitete er seine Tagebücher. Im Dezember 1861 ging er an einem regnerischen Tag hinaus, um die Jahresringe eines ganz bestimmten Baumstumpfs zu zählen, und kam durchnässt und frierend nach Hause. Er zog sich eine Bronchitis zu, die die Tuberkulose verschlimmerte, und im Mai 1862 war er zu krank, um das Bett zu verlassen, und starb, als die Frühlingsblumen zu blühen begannen.
Viele seiner emsigen Nachbarn in Concord hielten Thoreau für einen Taugenichts, einen Narren, der durch die Wälder streifte, statt im Garten Beete anzulegen oder den Amboss zum Klingen zu bringen. Manche aber nahmen sich ein Beispiel an ihm. Auch Aldo Leopold führte auf seiner Farm in Wisconsin jahrelang Aufzeichnungen über die Blütezeiten von Frühlingsblumen, und das taten in ländlichen Gegenden viele, die die botanischen Jahreszeiten aufmerksam beobachteten. Näher an Thoreaus Zeit war Alfred Winslow Hosmer (1851–1903), auch er aus Concord, ein Fotograf und Textilhändler, der Thoreau glühend bewunderte. Sechzehn Jahre nach Thoreaus Tod beschloss Hosmer, die Aufzeichnungen über die Blütezeit von Frühlingsblumen fortzusetzen. Das tat er bis 1902. Hundertfünfzig Jahre nach Thoreau folgten der Biologe Richard B. Primack und Abe Miller-Rushing denselben Pfaden und beobachteten die dreiundvierzig häufigsten Pflanzen auf der Thoreau-Hosmer-Liste. Und sie nutzten die Vergleichsdaten als handfeste Beweise für eine Klimaerwärmung. In seinem Text über den Rosablütigen Frauenschuh und seine eigene Wildblumensuche rings um Concord bezog Primack sich auf Thoreaus Notizbücher.
1853 vermerkte er [Thoreau] den Beginn der Blüte bei dieser Art für den 20. Mai und in den folgenden Jahren zwischen dem 24. und 30. Mai. […] Wenn ich heute am 20. Mai nach den ersten Exemplaren des Rosablütigen Frauenschuhs suchen würde, käme ich schon zu spät […] Der Rosablütige Frauenschuh in Concord hat seine erste Blüte nach vorn verschoben und blüht jetzt drei Wochen früher als damals. […] Erst durch den Vergleich so weit auseinanderliegender Daten – Thoreaus Aufzeichnungen in den 1850er Jahren und unsere eigenen Beobachtungen hundertsechzig Jahre später – konnte ich die Veränderung der Blütezeiten erkennen.
Unsere heutigen Thoreaus sind die Inuit und die Bewohner der Marshallinseln, Miamis, Sibiriens, der Osterinsel sowie die Menschen in New York City, die den Anstieg des Wassers beobachten, und die in Jakutien, die sehen, wie ihr Land zerfällt und versinkt, während der Permafrostboden unter ihren Straßen und Feldern taut. Es gibt noch immer aufmerksame Beobachter, zum Beispiel den Ökologen Charles Crisafulli, der 1980 nur zwei Monate nach dem Ausbruch des Mount St. Helens die Aschelandschaft zu erforschen begann. Er entdeckte eine Pflanze – »Krauser Rollfarn« – Cryptogramma crispa, eine Pionierart, die auf sauren Schutthalden wächst und eine Begleiterscheinung von Vulkanen ist. Seither kehrt Crisafulli alljährlich in die Region zurück, um die Pflanze aufs Neue zu begrüßen.
Charles Wohlforth untersuchte in The Whale and the Supercomputer die Spannungen und Übereinstimmungen zwischen zwei Gruppen, die in den nördlichen Breiten mit dem Klimawandel befasst sind – indigene Völker und Wissenschaftler. Als der Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2 (ICE-2) 2018 einen älteren Satelliten ersetzte, wurden technische Geräte genauso wichtig wie die Beobachter. ICE-2 liefert in einem riesigen Gebiet sehr präzise Angaben zur Erhöhung des antarktischen Eisschildes und zeigt mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern, wo das Eis schmilzt und wo es anwächst. Dennoch klafft eine Lücke zwischen unserer einstigen idealistischen Ehrfurcht vor dem Gewebe des Lebens – dem stillschweigend angenommenen Band der Wechselbeziehungen zwischen allen Teilen der Erde – und einem Rezept dafür, wie eine uneinige und impulsive Spezies es in der heutigen, menschengeprägten Welt anpacken soll, »den gesamten Planeten als physikalisches und biologisches Verbundsystem zu managen«, wie ein bekannter Verfechter des marktorientierten Naturschutzes es sich zum Ziel gesetzt hat. Wir, die wir nicht einmal friedlich miteinander leben können, sollen die ganze Erde »managen«? Da stehen künstliche Intelligenz, Geo-Engineering und eine App-freudige, gigantomanische, von Big Tech kontrollierte Zukunft zu befürchten.
Doch an manchen Orten sind die Bande noch nicht zerrissen. Die Umweltdesignerin Julia Watson hat außergewöhnliche Beispiele kooperativer ökologischer Lösungen für spezielle regionale Bedürfnisse ausfindig gemacht. Am eindrucksvollsten sind die lebenden Wurzelbrücken und Leitern, die von Bergstämmen in Nordindien angefertigt werden. Sie sind vor etwa vierzigtausend Jahren aus Südostasien dorthin gekommen; heute leben sie an einem der regenreichsten Orte der Welt, hoch oben in den bewaldeten Bergen, wo während des Monsuns reißende Flüsse durch die Täler strömen und jeglichen Verkehr zwischen den Dörfern unterbinden. In der Region fällt eine unglaubliche Menge Monsunregen, der das Netzwerk der Dörfer in Inseln verwandelt. Die einzigen Brücken, die den tosenden Fluten standhalten können, werden aus den verdrillten Wurzeln des heiligen Gummibaums über den Schluchten errichtet, was jeweils fünfzig Jahre in Anspruch nimmt, aber eine Ewigkeit hält. Die Brücken sind ein kunstvolles Gewirr aus ungeheuer langen Baumwurzeln, die sich umeinanderwinden wie lebende Skulpturen. Die Geschichte der Khasi und ihr spiritueller Ursprungsglaube sind eng mit dieser generationenübergreifenden Bauweise verflochten. Ähnlich errichtete Leitern und Wege verbinden die Bergdörfer mit den tiefer gelegenen Anbauflächen.
Ebenso ausgeklügelt sind die »Waldgärten« der Chagga in Tansania. Die Chagga sind Bananenexperten, die die Früchte an den Hängen des Kilimandscharo anbauen. Über Generationen haben sie den ursprünglichen Wald verändert und ihn zugleich kopiert, indem sie ihre Gärten innerhalb des Waldes anlegten, der die Dörfer umgibt. Die Vielfalt ihrer Gärten ist legendär. In den Kihamba-Hainen bauen sie mehr als fünfundzwanzig Bananensorten an und kultivieren mehr als fünfhundert Pflanzenarten, darunter auch eingeführte Avocados, Papayas, Süßkartoffeln, Mangos, Wasserbrotwurzeln und Kaffee. Die Gärten bestehen aus mehreren Schichten und sind in Waldstücke mit Bäumen, Lianen, Sträuchern und Epiphyten eingestreut. Diese Gartengestaltung, die darauf ausgelegt ist, in die örtliche Natur zu passen, hat auch in anderen Ländern wie Sri Lanka, den Pazifikinseln, Indonesien und Peru Aufmerksamkeit erregt.
*
In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts beschäftigten mich die Beweise für den Klimawandel im amerikanischen Westen zunehmend, als die Drehkiefernwälder in den Rocky Mountains erkrankten und an Trockenheit und den verheerenden Schäden durch Kiefernbastkäfer starben. Diese grauen Zunderwälder überall in den Rockies regten mich zu einem Roman an, der einer dreihundert Jahre langen Spur der Waldrodung folgte. Und während ich heute schreibe, brennen diese realen Wälder, die meine Aufmerksamkeit geweckt haben, an allen Ecken und Enden.
Als ich von Wyoming an die Küstengewässer des pazifischen Nordwestens zog, musste ich einen neuen Ort kennenlernen, an dem Land und Wasser aufeinander einwirkten. Schon die verflochtenen Schichten von Mündungsgebieten verstehen zu lernen, brauchte Zeit. Nichts schien eine solide Grundlage zu haben; die Erklärungen für Gezeiten, Meeresspiegel, Riesenseetang, erodierende Klippen, das Leben der Küstenvögel, die Wälder und ihr Unterholz – alles war mit hartnäckigen Problemen verbunden. Ständig bekam ich Vergleiche mit der jüngeren Vergangenheit zu hören, als üppige Tangwälder noch ein küstennahes Paradies für Meereslebewesen bildeten, große Landstriche der Olympic Peninsula noch nicht erkundet waren, das Wasser von Orcas aufgewühlt wurde – nicht von Kreuzfahrtschiffen – und die Walwanderungen die Ordnung in Neptuns Reich bestimmten. Ich las von den ausgedehnten Muschelbänken und den riesigen Elefantenrüsselmuscheln, für die die Region berühmt war, doch Siedlungsbau und die Abwasserrohre der wachsenden Städte hatten diesen prachtvollen Zeiten ein Ende gesetzt. Auch das Meer war nicht unwandelbar, und inzwischen versauert es immer mehr. An manchen Stellen wird die Küstenlinie mit Steinaufschüttungen und Wellenbrechern verstärkt, wenn Hausbesitzer fälschlicherweise glauben, sie könnten das steigende Wasser besiegen. Eine viel befahrene Bahnlinie verschandelt große Teile der Festlandküste. Abgeschiedenheit und Stille des Meeres werden vom Brummen der Containerschiffe, Müllkähne und Tanker gestört, von schnellen Ausflugsdampfern, den stampfenden Fähren, die ihre endlosen Furchen ziehen, und den umherstreifenden Seismik-Schiffen auf der Suche nach Öl und Gas. Unter Wasser herrschte eine einzige Kakofonie, bis es dort im Frühjahr 2020 während des kurzen Covid-19-Lockdowns ziemlich still wurde. Wale, deren Kälber noch nie Stille erlebt hatten, dürften sich gefreut haben. Wir sind Landlebewesen, die Felder bestellen können, aber das genügt uns nicht, und wir fangen schamlos die Fische und auch den Krill, von dem das Leben der Meerestiere abhängt. Das Wasser bebt angesichts unserer Dreistigkeit, doch offenbar ändern wir uns nicht.
Und das wollen wir auch nicht. Alte jüdisch-christliche Überzeugungen erlauben es den Menschen, den Rest der Welt nach ihrem Gutdünken zu nutzen:
Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter dem Himmel, über alles, was auf dem Erdboden kriecht, und über alle Fische im Meer; in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das grüne Kraut habe ich’s euch alles gegeben.
Oliver Rackham schrieb wahrheitsgemäß, dass die Geschichte der Feuchtgebiete die Geschichte ihrer Zerstörung ist. Die meisten Feuchtgebiete auf der Welt entstanden, als das Eis der letzten Eiszeit taute und gluckernd davonströmte. In den alten Zeiten waren Nieder-, Hoch- und Waldmoore sowie Mündungsgebiete die begehrtesten und verlässlichsten Ressourcenorte der Erde, die unzählige Arten anzogen und ernährten. Die Vielfalt und Anzahl der Lebewesen in Frühjahrsfeuchtgebieten und am Himmel darüber muss einen ohrenbetäubenden, schon von Weitem hörbaren Lärm erzeugt haben. Wir dagegen kennen das nicht. Als die Menschen sich in besorgniserregendem Maße vermehrten, wurden Feuchtgebiete trockengelegt, um sie für Landwirtschaft und Bebauung nutzbar zu machen. Inzwischen konkurrieren 7,8 Milliarden Menschen in einer Zeit politischer Unruhen, einer weltweiten Pandemie und eines Krieges um Lebensraum und versuchen, immer heftigere Wetterextreme zu ignorieren, während sich die Klimakrise verschärft.
*
Torf ist kein einfacher Stoff. Er besteht aus teilweise verrottetem und verdichtetem Pflanzenmaterial – jahreszeitlichen Ablagerungen von Laub, Schilf, Gräsern, Moosen und Fasern, die ins Wasser fallen und dort liegen bleiben. Das Wasser schließt Sauerstoff, den Hauptfaktor der Verwesung, aus. Die schwammigen Ablagerungen nehmen im Lauf der Jahrhunderte zu, und jedes Hoch-, Nieder- oder Waldmoor entwickelt einen eigenen Charakter. Torf enthält freie Zellulose, viel Feuchtigkeit und weniger als sechzig Prozent Kohlenstoff. Sein Inhalt variiert in der chemischen Zusammensetzung sowie den makroskopischen und mikroskopischen Stoffen. Der unter der Deckschicht eines Hochmoors lagernde »Pfeifentorf«, der jahrhundertelang zum Heizen von Häusern verwendet wurde, hat das Aussehen und die Konsistenz von erstarrtem Schokoladenpudding. Er kann mit einem scharfen Werkzeug geschnitten werden. Ist er noch feucht, so ist er biegsam wie grünes Holz und muss getrocknet werden, bevor man ihn verbrennen kann.
Jahrtausendelang haben Palsenmoore, die für Tundraregionen charakteristisch sind, den Kohlenstoff allein durch ihre Lage auf dem gefrorenen Pflanzenmaterial eingeschlossen, das wir Permafrost nennen. An manchen Orten im North Slope in Alaska ist der Permafrostboden mehr als sechshundert Meter tief. Seit der Klimaerwärmung weicht der gefrorene Unterbau auf und scheint nicht mehr so perma zu sein. Das Schreckliche daran ist, dass Treibhausgase, die lange unter der Oberfläche verschlossen waren, jetzt entweichen und die Krise exponentiell verstärken, indem sie ein positives Klima-Feedback erzeugen – das heißt die Erwärmung beschleunigen, was wir auch für die tropischen Wälder befürchten. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Tauprozess irreversibel ist. Es steht eine ganze Kaskade von Kipppunkten bevor, und im Oktober 2020 hätte uns die Nachricht, dass das gefrorene Methan im Nordpolarmeer zu entweichen beginnt, Schauer über den Rücken jagen müssen. Zugleich versuchen wir, jeder katastrophalen Auswirkung des Klimawandels einen Hoffnungsschimmer zu entlocken. Zum Beispiel in Jakutien, wo der größte Thermokarst der Erde – der »Batagaika-Krater« – einen Kilometer lang, hundert Meter tief und noch immer schnell wachsend, auch eine Stätte ist, an der Wissenschaftler Proben von bis zu 200 000 Jahre alten konservierten und gefrorenen Böden nehmen. Sie hoffen, mit molekulargenetischen und mikrobiologischen Verfahren Bakterien und Viren aus den Böden zu extrahieren, die zur Herstellung neuer Antibiotika führen könnten, doch im dritten Jahr in Folge zerstören schreckliche Brände die Wälder Jakutiens. Der Rauch treibt auf den Pazifik hinaus, und auf den Schiffen, in Alaska und an der nordamerikanischen Westküste atmen Menschen den beißenden braunen Dunst ein und erleiden Hustenanfälle.
Seit dem 15. Jahrhundert, als der Feudalismus in Nationalstaaten, westlichen Kapitalismus und Imperialismus überging, haben wir immer wieder zu hören bekommen, Torfmoore seien wertlos, während dasselbe Land, wenn es trockengelegt würde, für die Landwirtschaft nützlich sei. Jetzt sind wir in der peinlichen Lage, die Bedeutung dieser seltsamen Orte, die zu 95 Prozent aus Wasser bestehen, aber so faserig sind, dass man darauf stehen kann, neu ergründen zu müssen. Klima, Wetter, Jahreszeit, Erdbewegung, feuchte und trockene Umgebungen sind flexibel, ein ständiges Geben und Nehmen, und diese konkurrierenden, sich ändernden Prozesse lassen sich von Deichen, Dämmen, Entwässerungen, Gräben und Abzugskanälen nur kurz beeindrucken. Wasser ist die größtmögliche Flexibilität, wie Fela Kuti in »Water No Get Enemy« gesungen hat. Es wird immer gewinnen. Oder nicht? Manche Forscher glauben, dass die Menschheit in den nächsten fünfzig Jahren das gesamte übrige Land als Anbauflächen nutzen und jeden Tropfen Süßwasser aufbrauchen wird. Und dann?
*
Europäer, besonders in Norddeutschland und Irland, haben Tausende von Jahren mit eigens dafür gemachten Werkzeugen von Hand Torf gestochen. In Irland waren das vor der Erfindung schwerer Torfstechmaschinen spezielle Spaten und Karren. Doch jetzt ist eine große Veränderung im Gange: Einige Leute haben mit der Wiedervernässung und Renaturierung alter Torfmoore begonnen. In Irland, wo es viele Hochmoore und kaum Ölquellen gibt, besteht eine größere Abhängigkeit von Torf als anderswo, und seit eine Studie ergeben hat, dass jeder Hektar trockengelegtes und abgetorftes Moor pro Jahr 2,1 Tonnen Kohlenstoff ausstößt, hat man mehr mit hochgesteckten Dekarbonisierungszielen zu kämpfen. Großbritannien, durch den Brexit von alten EU-Vorschriften über Agrarsubventionen zur Förderung einer intensiven landwirtschaftlichen Produktion befreit, zieht mehr Projekte der Kategorie »Allgemeinwohl« in Betracht, darunter auch die Renaturierung von Feuchtgebieten. Die sehr ermutigenden Bücher Mein Leben als Schäfer und Pastoral Song des britischen Farmers James Rebanks lassen auf eine Wende zu bewusst ökologischer Landwirtschaft hoffen.
Die größten Moorgebiete der Welt sind die Hudson Bay Lowlands in Kanada, die Wassjuganje in Russland, die Mayo Boglands, die Okefenokee National Wildlife Refuge in den USA, die indonesischen Torfwälder, die Magellan’sche Tundra in Patagonien, die Tierra del Fuego und die Falklandinseln, die Marschen Mesopotamiens und die Cuvette Centrale im Kongobecken. Die reich bewaldeten Moorgebiete Indonesiens, wo Unternehmer Bäume fällen, die Stümpfe verbrennen und alles umpflügen, um Palmölplantagen anzulegen, sind eins der traurigsten Beispiele für einen großen biologischen Schaden. In Läden lese ich die Etikette, und wenn ich ein Stück Seife finde, das aus Palmöl hergestellt wurde, sehe ich vor meinem geistigen Auge einen zerstörten Wald. Solche Seife kaufe ich nicht.
Während manche Menschen, die in Ländern mit Moorgebieten leben, vielleicht mit neuem Respekt auf die wasserreiche Landschaft blicken, verspüren andere Angst, wie die Bewohner Jakutiens in Ostsibirien, einer der Weltgegenden, die sich am schnellsten erwärmen. Hier und in der Wassjuganje in Westsibirien geht der Permafrost rapide zurück – der Deckel wird vom Topf gehoben.
Der Permafrost in Jakutien, einer bedeutenden Agrarregion, besteht aus großen Eisplatten – sehr dickem, Yedoma genanntem Eis –, die in den Boden eingebettet sind wie Knoblauchspalten in einen Braten. An der Oberfläche schwimmt das Land, das noch vor Kurzem als Anbaufläche und Weideland für Vieh oder Rentiere diente, in Schmelzwasser. Große Abgründe tun sich auf, Fahrbahnen neigen sich und sinken ab. Seltsame große Krater klaffen, möglicherweise durch unterirdische Methangasausbrüche entstanden. Die Flüsse schwellen an und überfluten die Felder. Jakuten, die nach mehreren Generationen auf diesem Land eine hohe Sensibilität für die Feinheiten der Natur haben, sagen inzwischen, dass sie die Landschaft nicht mehr begreifen. Sie wissen, dass sie hier ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, und ziehen aus der vertrauten ländlichen Welt ihrer Vorfahren in die Wildnis der Städte. Die Einzigen, die sich freuen, sind die Leute, die es auf die erstmals seit Jahrtausenden freigelegten Mastodonstoßzähne abgesehen haben. Die verwesenden Leichen der Tiere verströmen einen ungeheuren Gestank – für diese Leute ist es der Gestank des Geldes, solange Anhänger der Traditionellen Chinesischen Medizin weiter Elfenbein kaufen. Das ist die beängstigende Seite der Tatsache, dass Moore große Mengen Kohlendioxid speichern können: Wenn man die Deckschicht aufreißt oder verbrennt, fliegt einem alles um die Ohren.
In ihrer Gesamtheit gleichen die Moorgebiete der Welt einem Buch mit Tapetenmustern, jedes weist seinen eigenen Aufbau und Charakter auf – manche sind kaum mehr als Wasser und Schilf, andere üppige, vielfältige Landschaften mit Farben, von deren Existenz wir modernen Städter nichts wussten: stilles sepiafarbenes Wasser, glänzende Moose, blasse Flechten, Sonnentau wie verschüttete Wassertropfen. Immer sind sie in quälendem Zeitlupenmodus, Veränderung ist nur durch Messaufzeichnungen zu erkennen – man kann ein Jahr lang vor einer Salzwassermarsch stehen und sie beobachten und wird doch nicht sehen, wie sie verlandet und sich in ein Niedermoor verwandelt. Und die Moore stehen ständig unter Beschuss.
*