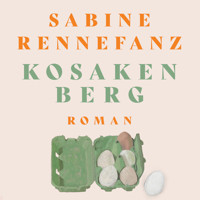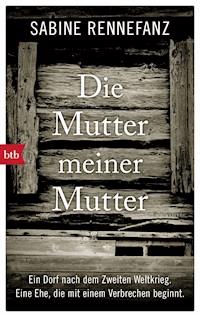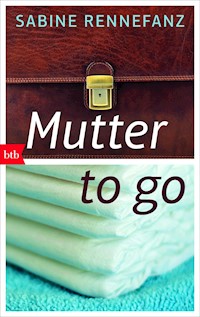
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Sabine Rennefanz war fünfzehn, als sie in Maxie Wanders »Guten Morgen, du Schöne« von den Kämpfen las, die berufstätige Frauen am Arbeitsplatz, zu Hause und mit sich selbst auszufechten hatten. Als sie selber Mutter wurde, war sie erstaunt, wie wenig sich bewegt hatte. Die Frauen kämpfen noch immer an den gleichen Fronten, es sind sogar noch neue hinzugekommen: die Sehnsucht nach Perfektion und immerwährendem Glück. In ihren Kolumnen untersucht Sabine Rennefanz mit Witz und Schärfe die Freuden, Zumutungen und Kämpfe moderner Mütter. Sie sucht Antworten auf große Fragen: Warum werden Männer und Frauen ungleich behandelt? Warum fordern Frauen nicht mehr? Wie soll sich jemals etwas ändern? »Ich sitze am Schreibtisch und schaue auf meine Tochter, die noch nicht ahnt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Es wäre schön, wenn sie und ihr Bruder es irgendwann einmal unvorstellbar finden, dass es solche Zeiten der Ungleichheit gegeben hat.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Sabine Rennefanz war fünfzehn, als sie in Maxie Wanders »Guten Morgen, du Schöne« von den Kämpfen las, die berufstätige Frauen am Arbeitsplatz, zu Hause und mit sich selbst auszufechten hatten. Als sie selber Mutter wurde, war sie erstaunt, wie wenig sich bewegt hatte. Die Frauen kämpfen noch immer an den gleichen Fronten, es sind sogar noch neue hinzugekommen: die Sehnsucht nach Perfektion und immerwährendem Glück. In ihren Kolumnen untersucht Sabine Rennefanz mit Witz und Schärfe die Freuden, Zumutungen und Kämpfe moderner Mütter. Sie sucht Antworten auf große Fragen: Warum werden Männer und Frauen ungleich behandelt? Warum fordern Frauen nicht mehr? Wie soll sich jemals etwas ändern? »Ich sitze am Schreibtisch und schaue auf meine Tochter, die noch nicht ahnt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Es wäre schön, wenn sie und ihr Bruder es irgendwann einmal unvorstellbar finden, dass es solche Zeiten der Ungleichheit gegeben hat.«
SABINE RENNEFANZ, 1974 in Beeskow geboren, arbeitet als Redakteurin für die Berliner Zeitung und wurde für ihre Arbeit u. a. mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Ihr erstes Buch, »Eisenkinder. Die stille Wut der Wendegeneration«, stand mehrere Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. 2015 erschien ihr zweites Buch »Die Mutter meiner Mutter«.
SABINE RENNEFANZ
Mutter to go
Zwischen Baby und Beruf
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Kolumnen in den Kapiteln I–IV sind erstmals zwischen Januar 2017 und September 2018 in der Berliner Zeitung erschienen.
1. AuflageOriginalausgabe Februar 2019Copyright © 2019 by Sabine RennefanzCopyright © 2019 bei btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCovergestaltung: semper smile, MünchenCovermotiv: © plainpicture/Stock4B/Stephanie WolfsteinerSatz: Uhl + Massopust, AalenSK · Herstellung: scISBN 978-3-641-23516-1V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Spiderman und Cornflake Girl
Inhalt
Mutterland – Ein Essay
I Frau sein. Rollen und Emanzipation
Guten Morgen, ihr Schönen!
Die Mütter sind schuld
Frauke Petrys Baby
Mütter und Mumien
Papa beim Sportkurs, Mama in der Küche
Väter, die helfen
Die Legende von den neuen Vätern
Eine altmodische Geste
Mami, Papi, Co-Parent
Wonderdaddys sind einsam
Schöne Grüße aus dem Paralleluniversum
Das Märchen vom Nacheinander-Prinzip
Die Mutti-Falle
Gebt den Männern die Babys!
II Mutter sein. Erziehungsfragen und Elternschaft
Flucht aus dem Familienbett
Cha-Cha-Cha mit Fiebersaft
Geheime Nächte
Das Leben mit zwei
Danke, liebes Amt
Das nachtaktive Ungeheuer
Smartphones retten Mütter
Das Modell Trump
Terence Hill und mein kleines Croissant
Wenn das Baby grunzt
Verbrecherische Antibiotika
Der Mütter-Pranger
Du bringst mich noch ins Grab
Der Aufstieg des Baby-Burkini
Wer Tiefkühlpizza serviert, ist raus
Halb sieben ist wie Ausschlafen
III Wähler sein. Das Politische
Ein falsches Geschenk
Pflicht-Elternzeit für Väter
Das Dilemma der Vereinbarkeit
Urlaub auf Staatskosten
Hebammen sind kein Luxus
Heult nicht rum, Eltern
Die Suche nach einem Kinderarzt
Verratene Ideale
Mütter, Töchter und #MeToo
Bitte nur Paare ohne Kinder
Plädoyer für die 28-Stunden-Woche
Gute Kinder, schlechte Kinder
Lehren aus der Kita-Krise
Weg mit der Teil-Zeit
Warum müssen Eltern um alles betteln?
Eltern in der Vollzeit-Falle
Denkt mal über eure Rente nach!
IV Familie sein. Aus dem Leben mit Kindern
Baby to go
Geburt als Party
Der perfekte Vorname
Babys sind Freundschaftskiller
Schlafen kann ich später
Panik am Flughafen
Kosmonauten auf der Regeninsel
Kinder in Cafés mit Bällebad
Reisen mit Baby
Der Junge, der ein Mädchen war
Die Verliebtheit ist weg
Spiderman lernt sprechen
Utopia bei OmaOpa
Chaos am Morgen
Mein Sohn, der Feminist
Weit weg vom Rondo-Kaffee
Wirkungen und Nebenwirkungen
Cornflake Girl und das Berliner Modell
Der Gott des Gemetzels
Einer schreit immer
Großstadtflucht als Falle
Netflix ist Date Night
Ein Denkmal
Spiderman fährt Fahrrad
Gestohlene Zeit Ein Nachwort
Mutterland
Lange dachte ich, Menstruation ist etwas, was ich nicht bekommen werde. Zwanzig Mädchen waren in der Klasse der »Schule des Friedens«, nacheinander hatte es sie getroffen, sie bluteten jeden Monat. Nur ich nicht, obwohl ich schon sechzehn war. Meine beste Freundin Peggy Schröder war die Erste gewesen, bei ihr hatte es schon mit elf angefangen. Dünne Ströme roter Flüssigkeit liefen im Turnhallenumkleideraum der »Schule des Friedens« an ihren Oberschenkeln hinunter. Als ich das sah, schrie ich vor Schreck, »Hilfe, du blutest, Peggy«. Ich dachte, sie hätte sich verletzt. Sie lächelte stolz und wissend, als handelte es sich um ein besonderes Zeichen, als wäre sie eine Auserwählte. »Ja, schon lange, seit zwei Monaten«, erwiderte sie. Ich starrte auf ihre Beine, ich konnte den Blick nicht von ihr abwenden. Das Blut, das an ihren Beinen hinunterlief, und sie machte sich nicht einmal die Mühe, es abzuwischen. Sie bekam einen Busen und stand morgens in der Pause mit einem Typen aus der elften Klasse herum. Mit 12 trug sie einen BH, mit 13 nahm sie die Pille. Sie sagte, dass sie heiraten und Kinder haben wollte. Das machte sie dann auch. Mit 19 heiratete sie den Jungen, mit dem sie seit der elften Klasse in der Pause herumgestanden hatte, und bekam zwei Söhne. Aber da waren wir längst keine besten Freundinnen mehr.
Ich war damals nicht neidisch, als Peggy Schröder das Blut an den Beinen hinunterlief, ich war erleichtert, dass es mich nicht getroffen hatte. Ich sah das Blut an den Schenkeln herunterlaufen, aber ich kam nicht auf den Gedanken, dass ich meinem eigenen Schicksal zusehen könnte. Ich hatte erst ein paar Monate vorher erfahren, dass Frauen bluten. Und dass es dafür einen Namen gab: Menstruation. Das klang fremd, kompliziert, technisch. Auf dem Dachboden meiner Eltern hatte ich alte Ausgaben des Magazins Neues Leben durchgestöbert. Ich erinnere mich an die Grafiken von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen. Es war mir peinlich, das anzugucken, aber wegpacken konnte ich die Hefte auch nicht. Ich las im Dunkeln, unter einem Dachbalken saß ich auf dem staubigen Boden. Ich wäre lieber jemand gewesen, der keine Geschlechtsorgane hat.
Jahre später fragte ich meine Mutter, warum sie mich nicht aufgeklärt hatte. Meine Mutter meinte lakonisch: »Ich dachte, das findest du schon früh genug heraus.«
Ich tat so, als handelte es sich bei der Menstruation um eine Krankheit. Manche würden sie bekommen, andere nicht. Ich hoffte, es würde an mir vorbeigehen, als könnte ich das monatliche Blut deaktivieren, vielleicht sogar abwählen. Das Blut und alles, was damit zusammenhing: Schwangerschaft, Mutterschaft, Frausein. Ich war nach Werten erzogen worden, die man traditionell als männlich bezeichnet: Ehrgeiz, Fleiß, Erfolg, Disziplin. Frausein bedeutete Abhängigkeit, Schwäche, Verletzlichkeit. Frauen sollten gütig, passiv, fürsorglich und ein bisschen naiv sein. Männer waren hart, konsequent, klug, durchsetzungsstark.
Beinahe alle Frauen, die ich in meiner Kindheit kannte, hatten nie außerhalb des Haushaltes gearbeitet. Die alten Damen, die ich Tante nannte, obwohl wir nicht verwandt waren, hießen Luise, Martha, Elli und Ilse. Sie verbrachten ihre Tage in der Küche, in der sie schwere Schüsseln voller Wäsche, Geschirr oder Kuchenteig herumtrugen. Ihre Arbeit: Kochen, Kuchen backen, abwaschen, putzen, bügeln, alles per Hand, alles zeitraubend. Sie ruhten sich am Kachelofen oder auf der Bank vor dem Haus aus, je nach Jahreszeit. Meine Großmutter wollte einmal Lehrerin werden, verließ wegen des Krieges die Schule aber nach der sechsten Klasse. Sie konnte einem Huhn den Kopf abhacken, eine feste Arbeitsstelle hatte sie nie. Meine Mutter arbeitete wenige Stunden bei der Post, als das zweite Kind kam, hörte sie auf zu arbeiten und wurde Hausfrau. Mein Vater verdiente das Geld, sie blieb zu Hause. Sie kümmerte sich um den Haushalt, sie sorgte dafür, dass wir regelmäßig aßen und saubere, adrette Kleidung trugen. Es war eine Arbeit, der sie selbst offensichtlich nicht viel Wert beimaß. Wenn sie sich nicht mit der Planung der unmittelbaren Zukunft beschäftigte, las sie mir vor, sang mir ein Lied und gab mir Ratschläge für mein Leben. »Streng dich an, lerne, bleibe unabhängig«, schärfte sie mir ein. Sie schickte mich nicht in den Kindergarten, weil sie dem Erziehungssystem misstraute. Eine gute Mutter war für sie eine Frau, die sich in den ersten Jahren ausschließlich dem Haushalt und den Kindern widmete, eigene Interessen zurückstellte, sich aufopferte.
Es gab nur eine Frau, die anders war. Meine Tante. Sie las viel, sie konnte stundenlang auf ihrem Sessel in einem Buch versinken, war nicht ansprechbar, wenn sie las.
Sie arbeitete als Buchhändlerin in der Kreisstadt, Bücher waren Luxusgegenstände, die man gegen andere Luxusgegenstände tauschen konnte. Sie konnte sich Kleider, Schallplatten, Schuhe leisten. Nach 1990 kaufte in der Kreisstadt kaum jemand mehr Bücher, sie verlor ihre Arbeit und versank in eine düstere Trauer. Die eine Frau, die in meiner Familie Spaß an ihrem Beruf hatte, brachte der Verlust der Arbeit fast um. Kinder bekam meine Tante keine.
Als ich in die Schule kam, war ich das einzige Kind, dessen Mutter Hausfrau war. Die Mütter meiner Mitschülerinnen hatten Berufe, die der Gesellschaft nützten: Sie waren Facharbeiterin für Viehzucht, Traktoristin, Sekretärin, Verkäuferin. Es war mir peinlich, wenn wir im Russischaufsatz über die Berufe der Eltern schreiben sollten. Das Einzige, was ich schreiben konnte, war: »Mama domoi«. Mama ist zu Hause. Hausfrau klang damals falsch, dekadent, asozial. Ich hätte als Kind lieber eine Mutter gehabt, die morgens früh zu Arbeit ging, wie in dem Lied, das wir in der Schule sangen. Solange ich denken konnte, war meine Mutter finanziell abhängig von meinem Vater.
Bei mir hat das dazu geführt, dass ich später alles anders machen wollte. Ich wollte einen Beruf, ein eigenes Einkommen, Unabhängigkeit, Freiheit. Ich wollte lieber keine Frau sein.
Mit 15 hörte ich auf, Kleider zu tragen, selbst bei der größten Hitze zog ich weite Sweatshirts und Jeans an. In der Zeit, als Peggy Schröder immer femininer wurde, wurde ich zu einem Neutrum. Frisuren, Make-up, Jungs-Poster, das hatte keine Bedeutung für mich. »Ich war ein Junge in einem Mädchenkörper, nicht im Transgender-Sinne, sondern im Denken, im Handeln«, schreibt die Britin Caitlin Moran in ihrem Buch »How to be a woman«. Alles, was Mädchen im Teenageralter machten, sich Poster von bekannten Popbands an die Wand hängen, schminken, Haare machen, schien mir oberflächlich, ein bisschen schlicht. Als ich doch meine Periode bekam, war es ganz unspektakulär. Es sah nicht schön aus, es tat nicht weh, es liefen keine Bäche an meinen Oberschenkeln entlang. In meinem Schlüpfer war ein rotbrauner Fleck, als ob in meinem Bauch ein Traktor rostete. Ich ging zu meiner Mutter, sie holte Binden von der Größe eines Dachziegels aus der hinteren Ecke ihres Schlafzimmerschranks. Warum tut es nicht weh, wollte ich wissen. »Sei froh«, sagte sie. Als sie in meinem Alter war, sagte sie, habe sie so schlimme Krämpfe gehabt, dass sie nicht zur Schule gehen konnte. Sie musste den ganzen Tag im Bett in einem dunklen Zimmer liegen. Ich hörte zu und sagte nichts. Wahrscheinlich hatte ich Glück.
Drei Monate danach passierte nichts. Keine Flecken. Keine Krämpfe. Ich dachte schon, das war’s, ich bin durch, ich hatte es geschafft, ich war dem Bluten entkommen. Ich gehörte zu den Frauen, die einfach keine Menstruation bekommen. Kinder wollte ich sowieso nicht. Und überhaupt: Hatte Kati Witt eine Periode? Lief das Blut, während sie »Carmen« auf dem Eis tanzte? Wie kriegte sie das hin? Oder lief sie besonders gut, wenn sie Bauchkrämpfe hatte?
Als ich 25 Jahre später selber Mutter wurde, hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. »In die Mutterrolle hineinzufinden kann ein ähnlich fordernder Prozess sein wie der Geburtsprozess selber«, schreibt der amerikanische Psychiater Daniel Stern. »Es ist die größte Transformation, die eine Frau in ihrem Leben erleben kann.« Für mich, das kann ich inzwischen sagen, ist es meine zweite Wende, vielleicht ähnlich erschütternd und revolutionär wie der Mauerfall 1989. Eine Transformation, banal, brutal und einzigartig zugleich. Vieles, was fest war, wurde auf den Kopf gestellt, was man von anderen wusste, vom Partner, den Freunden, den Eltern, von sich selbst. Das, was man als eigene Grenze definiert hat, verschob sich. Seitdem das Kind da war, dachte ich anders, über das Leben, die Erde, die Liebe, das Frausein.
Nachdem die Mauer gefallen war, hatte ich mich dauernd bewegt. Der Reiz des Lebens bestand darin, Neues zu entdecken. Ich war auf der Suche, süchtig nach Reizen von außen, nach Herausforderungen, neuen Wegen, Alternativen. Eine neue Stadt. Eine neue Arbeit. Ein Preis, den ich gewinnen könnte. Ich habe mit Popstars in Mailand getanzt und mit Männern in Bars in Barcelona über Fußball geredet, ich bin auf mexikanische Pyramiden geklettert und in südafrikanische Höhlen gekrochen. Ich konnte nicht stillhalten. Ich habe gedacht, ich habe viel erlebt, viel gesehen, und habe das mit Lebenserfahrung verwechselt. Als ich Mutter wurde, merkte ich, dass nichts davon stimmte, dass ich nichts wusste. Ich hatte keine Ahnung vom Leben.
Als ich das erste Mal einen Kinderwagen schob mit meinem Baby drin, kam ich mir komisch vor, fremd, falsch, als ob jemand gleich kommen würde und mich entlarven, als das, was ich war, ein Imposter, eine Hochstaplerin, ein Fake. Geben Sie sofort diesen Kinderwagen her, den Sie gestohlen haben! Wie konnte jemand wie ich eine Mutter sein?
Jemand hat einmal geschrieben, dass man sich als neue Mutter so fühlt wie ein alternder Rockstar, eben hatte man noch ein interessantes Leben, jetzt wird man freundlich ignoriert. Wie war die Geburt, wird vielleicht noch gefragt, aber die Antwort will schon keiner mehr hören. Alles dreht sich um das perfekte, schöne Baby. Wie heißt es? Woher kommt der Name? Wie viel trinkt es? Schläft es schon durch? Wem sieht es ähnlich? Warum trägt es Rosa? Warum nicht Hellblau? Habt ihr einen Kinderwagen oder ein Tragetuch? Familienbett, Beistellbett oder eigenes Bettchen im Kinderzimmer? Ich hielt das schöne, perfekte Baby im Arm, und alle bewunderten es. Wie das Leben mit einem Neugeborenen wirklich ist, darüber spricht kaum jemand. Das will auch niemand so genau wissen.
Als Mutter steht man da, pure Funktionalität, das Blut läuft noch, schon wieder das verdammte Blut.
Früher wurde man gefragt, nach seinen Projekten, nach seinen Plänen, jetzt fühlt man sich leicht perplex und erschlagen von den vielen Gefühlen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie in dieser Intensität fühlen konnte, dass man dazu fähig war, Liebe, Erschöpfung, Hilflosigkeit, Müdigkeit. »Genieße es«, sagten erfahrene Mütter zu mir in den ersten Wochen nach der Geburt meines Sohnes.
Als das Baby geboren war, hielt ich es nicht aus, von ihm getrennt zu sein. Ich schlief drei Tage nicht, obwohl ich sehr müde war. Ich war vollgepumpt mit Adrenalin. Selbst wenn ich schlief, wachte ich alle halbe Stunde auf, schreckte hoch und rannte hin, um zu gucken, ob das Baby noch atmete. Ich legte es neben mich in mein Bett. Ich hatte Angst, es könnte verschwinden, wenn ich mich zu weit weg bewegte. Es war eine körperlich spürbare Angst, ein Druck im Bauch, als ob ein Stück fehlte, und so war es ja auch. Das Kind war vierzig Wochen in meinem Körper gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass etwas fehlte, noch Wochen später, wenn ich auf einer Party stand und meinen Sohn vermisste.
Bevor ich Sebastian traf, bin ich mit sechs anderen Männern ausgegangen, einem arbeitslosen Schlosser, dem Sohn eines Fabrikbesitzers, dem Sohn eines Filmstars, dem Sohn eines Lords, einem DJ und einem Politiker. Einer davon war ein Ostdeutscher, zwei Westdeutsche, drei Ausländer. Keiner wollte Kinder.
Das war kein Problem gewesen, bis ich schließlich eines wollte. Das Gefühl kam langsam. Es war erst eine Sehnsucht nach etwas Dauerhaftem, das nicht den Launen, Befindlichkeiten und Zufälligkeiten unterworfen war, mit denen ich in meinen Zwanzigern zu tun hatte, eine Sehnsucht nach einer Verbundenheit, die unauflösbar war, nach etwas, das nur zu mir gehörte. Eine Sehnsucht nach einer anderen Art von Liebe.
Es war zunächst ein abstraktes Gefühl, die praktischen Aspekte des Lebens mit einem Baby waren mir völlig fremd. Als Kind musste ich oft auf meine jüngeren Geschwister aufpassen, aber später hatte ich keinen alltäglichen Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern. Ich lebte im Ausland, meinen kleinen Neffen sah ich zweimal im Jahr. Wann immer ich ihn sah, schlief er. Und wenn er aufwachte, dann nur, um Nahrung zu sich zu nehmen, eine Flasche Milch, eine Schale Brei. Ich tat so, als wüsste ich, wie man mit Kindern umgeht, ich schob ihm ein Auto hin, ich baute ihm einen Turm aus Bauklötzen, er guckte skeptisch. Ich hielt ihm einen Löffel mit Brei hin, er schrie. Ich war offenbar kein Naturtalent. Als ich ihn das nächste Mal sah, fuhr er schon Dreirad.
Die britische Journalistin Emma Brockes beschreibt in ihrem Buch »An excellent choice« ihre Vorstellungen, wie das Leben mit einem Kind sein würde: »Ich stellte mir ein Baby vor, das ich in meine Tasche stecken und dann auf Dienstreisen mitnehmen könnte, nach Los Angeles oder London. Ich würde ins Restaurant gehen und das Baby würde friedlich neben mir in seinem Sitz schlafen. Es würde schwarze Haare haben wie ich. Würde es ein Junge werden, würde ich mit ihm am Sonntagnachmittag alte Musicals ansehen. Wird es ein Mädchen, würde sie ein Bücherwurm werden wie ich. Sie würde aussehen wie Amélie in dem französischen Film, mit einem dicken Pony und schwarzen Haaren.« Ich war offenbar nicht die Einzige, die eine seltsame Vorstellung vom Kinderhaben hatte.
Als ich Sebastian in London kennenlernte, sagte ich ihm beim dritten Treffen, dass ich Kinder wollte. Wenn er andere Pläne hätte, fügte ich hinzu, dann bräuchten wir es gar nicht erst miteinander zu versuchen. Ich hatte mir die Worte vorher zurechtgelegt. Ich hatte den Song von Nancy Sinatra »Don’t let him waste your time« zehnmal hintereinander gehört, um mir Mut zu machen. Wir saßen in einem Tapas-Laden in Südlondon, der Kellner kam mit den Patatas bravas. Ich erwartete, dass Sebastian aufstand und sich verabschiedete. Doch er blieb sitzen. Wir zogen zusammen, heirateten. Wir wünschten uns ein Kind, aber nicht so sehr, dass wir uns besonders bemüht hätten. Es gab Zeiten, da redeten wir über nichts anderes als über dieses eine Thema. Oder zumindest fühlte es sich so an. Wir saßen zusammen auf dem Sofa im Wohnzimmer und diskutierten. Ich wollte ein Kind, konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, wie es sein würde, Mutter zu sein. Ich kam aus einer schwierigen Familie, wie sollte jemand wie ich es schaffen, einen Menschen großzuziehen, der mit dem Leben zurechtkam? Ich redete. Sebastian hörte zu. Er sagte, dass ich mir nicht so viele Gedanken machen sollte. Er sagte, dass wir es schon schaffen würden. Erst mal schwanger werden, und dann sehen wir weiter. »We will cross the bridge, when we come to it«, sagte er.
Eines Tages im Februar machte ich einen Schwangerschaftstest. Als ich ihm das Ergebnis zeigte, war ich so aufgeregt, wie ich das letzte Mal aufgeregt war, als mir mein damaliger Chef bei der Zeitung sagte, dass ich als Korrespondentin nach London gehen könnte. Ich wollte. Der Test war positiv. Ich machte ein Foto von dem Teststreifen, als Beweis.
Es gibt zwei Erzählungen über die vierzig Wochen Schwangerschaft. Die eine lautet, dass ich in den vierzig Wochen viel Angst hatte. Angst davor, dass etwas mit dem Kind nicht stimmen könnte. Weil ich über 35 war, galt ich als Risikoschwangere und wurde von einer Voruntersuchung zur nächsten geschickt. Dabei geht es darum, Krankheiten schon im Mutterleib herauszufinden. Das kann helfen, aber auch enorm verunsichern. Außerdem wird man, wenn man schwanger ist, zu einer Art öffentlichem Gut, man wird kontrolliert, überwacht und mit Empfehlungen überschüttet. Selbst Fremde hatten plötzlich eine Meinung, was ich essen und trinken sollte. Dass man keinen Alkohol anrührte und nicht rauchte, war in meinem Umfeld selbstverständlich. Ich sollte auch keinen Kaffee mehr trinken, keine Salami mehr essen, keinen rohen Fisch, keine Nasentropfen mehr benutzen – all das könnte schlecht fürs Baby sein.
Nach der ersten Freude versank ich in einem Nebel aus Angst, Verunsicherung und lähmender Müdigkeit. Ich absolvierte eine Vorsorgeuntersuchung nach der anderen, dazwischen lag ich auf dem Sofa und schlief. Ich war immer müde, es war eine Müdigkeit, die wehtat, die bis in die Haarspitzen drang. Ich hatte keine Ahnung, warum die erste Zeit so anstrengend war, das Baby war doch noch so klein, kleiner als eine Walnuss. Wäre Kafka eine Frau, schreibt die irische Schriftstellerin Anne Enright, dann hätte sich Gregor Samsa nicht in ein Insekt verwandelt, das wäre nicht nötig gewesen. »Aus Gregor wäre Gretel geworden, und eines Tages wäre Gretel aufgewacht und schwanger gewesen. Und wenn sie versucht hätte, sich zu bewegen, sich auf die Seite zu drehen und aufzustehen, hätte sie festgestellt, dass sie nicht vom Fleck kommt. Sie hätte auf dem Rücken gelegen, und ihre kleinen Hände würden hilflos in der Luft herumwedeln.«
Ich ging zur Ärztin, sie schaute besorgt, als trüge ich eine gefährliche Fracht in mir. Wir redeten über Risikoschwangerschaften und darüber, ob postnatale Depressionen auch schon vor der Geburt auftauchen könnten.
Bei der Ärztin sollte ich es mir auf einer Liege bequem machen, wie sie sagte, sie rieb ein Gel auf meinen Bauch und zeigte dann auf einen Fernseher, auf dem etwas sehr Seltsames flimmerte. Dort sah man etwas, was wie ein winziger Teddybär aussah. Ich hatte offenbar einen winzigen Teddybären in meinem Bauch.
Die andere Version lautet, dass ich die Schwangerschaft genossen habe, dass ich mich so gut gefühlt habe wie noch nie zuvor in meinem Leben. Mein Haar wurde dick und glänzend, alle Unreinheiten in meiner Haut verschwanden. Fremde Menschen auf der Straße hielten an, um mir Komplimente über mein Aussehen zu machen. Frauen werden nie so geliebt, öffentlich geliebt, wie wenn sie ein Kind im Bauch tragen.
Ich suchte nach einer Hebamme und landete auf einer Website, die mir eine Bekannte empfohlen hatte. Die Seite war in einem dieser Orangetöne gehalten, die man »sanft« nennt. Man sah darauf ein Foto eines nackten Frauenkörpers, Brüste, Bauch, Haut. Die Frau hatte keinen Kopf und keine Beine, was man im Nachhinein als Warnung interpretieren könnte. Eine Warnung für werdende Mütter, was ihnen bevorsteht, was das Muttersein mit ihnen macht. Damals erinnerte die Seite mich an Werbung für spirituelle Messen oder esoterische Rituale. Ich bekam ein wenig Angst, so wie man sie bei einem Umzug bekommt. Wenn man zum ersten Mal durch die neue Nachbarschaft spaziert und feststellt, dass einem alles fremd ist: die Sprache, die Ästhetik, die Ideologie. Die Website hieß »Bauchraum«. Ich meldete mich zu einem Geburtsvorbereitungskurs an.
Über die Geburt zu schreiben fällt mir nicht leicht.
Ich wollte schon lange darüber schreiben, doch statt aufzuschreiben, was ich wirklich erlebt und gefühlt hatte, notierte ich, was ich hätte fühlen sollen oder was ich woanders gelesen hatte. Es fiel mir schwer, mich an meine tatsächlichen Gefühle zu erinnern und sie in Worte zu fassen und in einen Einklang mit den Ereignissen zu bringen. Es wird viel über Geburten geschrieben. Dann geht es meist um die Liebe, das Baby, seine unvorstellbare Präsenz, diesen winzigen neuen Menschen, die kleinen Händchen, die großen Augen. Es geht kaum um den Prozess, die Gewalt, das Unentrinnbare.
Direkt nach der Geburt schrieb ich einen Geburtsbericht, wie die Hebamme es mir geraten hatte. Wenn ich ihn heute lese, bin ich fast erschüttert, wie technisch und emotionslos er verfasst ist. Es wird meist berichtet über Dauer, Einnahme von Drogen, Art der Geburt. Seltsam technisch. Ohne das Drama.
Wochen nach der Geburt stand ich an der Kasse, und in meinem Kopf spielten sich die Szenen ab, die ich erlebt hatte: Ich laufe herum und halte mich an Treppengeländern oder Bäumen fest, wenn die Schmerzen kommen. Mein nackter schwerer Körper in der Badewanne. Das Zucken, das Schreien. Der Körper, der zu einem Objekt der Natur wurde. Alles Individuelle verschwand. Das Schwierige bestand darin, loszulassen und gleichzeitig nicht vom Schmerz überwältigt zu werden. Lockerheit und Stärke zu zeigen. Es war ein Vorgriff auf das, was es heißt, ein Kind großzuziehen. Aber das wusste ich damals noch nicht.
Es gibt Frauen, die mit einem sogenannten Geburtsplan in die Klinik kommen. Es wird der Eindruck vermittelt, ein Kind zu gebären sei etwas wie Whisky trinken. Je mehr man sich informiert, desto intensiver wird der Geschmack. Es gibt Kurse, Anleitungsbücher, Massagen, Hypno-Birthing. Es wird so getan, als spürte man den Schmerz nicht, wenn man sich nur genug anstrengt. Ein Prozess wie eine Yoga-Übung, eine Abfolge mehrerer Figuren, die man hintereinanderweg turnt. »Ich beneide dich: Es gibt nichts Schöneres als Geburten«, sagte meine Nachbarin, als ich hochschwanger war.
Nicht gesagt wird, dass eine Geburt einem Kampf ähnelt, der sich wie ein Todeskampf anfühlen kann. Ein Kampf zwischen Leben und Tod. »Werde ich wieder das Gefühl haben, dass ich sterben muss?«, fragte eine Schwangere in einem Geburtsvorbereitungskurs, den ich besuchte, als ich zum zweiten Mal schwanger war. Sie hatte schon ein Kind, wie alle anderen Frauen in der Gruppe. Nur in solchen Runden wird so etwas besprochen. Niemand will sonst die Details hören. Schon die Vokabeln der Ärzte und Hebammen wirken obszön, intim. Muttermund. Beckenboden. Man erwartet eine glückliche Mutter und ein rosiges Baby. Wie Kate, die Herzogin von Cornwall, die sich kürzlich nach der Geburt ihres dritten Kindes präsentierte: schlank, High Heels, perfektes Makeup. Sie wirkte wie ein Abziehbild von Weiblichkeit, bereinigt von Drama, Blut und Tod.
Ich hatte meine Mutter gefragt: Hat es sehr wehgetan?
Sie antwortete ausweichend, die Schmerzen, die vergisst du. Das stimmt, aber erst einmal muss man sie ertragen.
Noch Monate später wachte ich nachts auf, ich versuchte, mich zu erinnern.
Ich sah mich vor meinem inneren Auge. Ich ging spazieren vor der Klinik. Ein sonniger Tag im November. Blauer Himmel. Ich sah die Bäume vor mir, an denen ich mich festgeklammert habe, wenn die Wehen kamen. Das war, als ich die Schmerzen noch wegatmen konnte, wie ich es im Yoga gelernt hatte. Ein, aus, ein, aus.
Das Härteste ist das Loslassen. Vor allem nach einem Leben, in dem man gelernt hat, sich zu kontrollieren. Man hat sein Leben damit verbracht, sich anzupassen, sich die Regeln anzueignen, und auf einmal soll man eine Welt betreten, die animalisch ist, archaisch. Lass dich nicht verrückt machen, wir sind alle Säugetiere, und Säugetiere wissen, wie es funktioniert, riet eine Freundin. Auf einmal soll man auf Instinkte hören. Zum Tier werden.
Am Vorabend vor dem errechneten Termin platzte die Fruchtblase. Das war ein Schock, denn zuvor hatten mir alle Expertinnen, die viel mehr Erfahrung als ich hatten, versichert, dass das nicht passieren würde. Erste Kinder kommen nie zum Termin. Fruchtblasen platzen nur in Hollywood-Filmen. Die Hebamme, die mich seit Beginn der Schwangerschaft begleitet hatte und bei der Geburt im Krankenhaus dabei sein sollte, war sich so sicher gewesen, dass sie zu einer Fortbildung außerhalb der Stadt gefahren war. Die Ärztin hatte wenige Stunden zuvor gesagt, dass das Baby noch nicht so weit sei. Sie hatte Herztöne gemessen, den Muttermund befühlt. »Das Kind kommt auf keinen Fall heute oder morgen«, sagte sie. »Gehen Sie nach Hause, machen Sie sich mit Ihrem Mann ein schönes Wochenende.« Im Geburtsvorbereitungskurs hatte ich gelernt, dass nur fünf Prozent aller Geburten mit einem Blasensprung beginnen. »Das ist Hollywood«, hatte die Kursleiterin gesagt. Ich stand im Badezimmer und rief mir diese Sätze in Erinnerung.
Jetzt war passiert, was nicht passieren durfte. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hatte ja auch so getan, als wüsste ich, wie man das macht, ein Kind bekommen, als wäre das nur eine Frage der Technik, der Konzentration, der richtigen Hebamme. Ich bin eine Frau, Kinderkriegen ist doch meine Kompetenz. Ich habe so getan, als würde ich in die Arena gehen, einmal mit dem Tuch links und rechts wedeln und dann wäre plötzlich das Baby da.
Ich war schwanger, ich hatte einen riesigen Bauch, aber dass da wirklich ein Baby kommen würde, das hatte ich verdrängt. Ich rief mir die Aussagen ins Gedächtnis, als wollte ich nicht wahrhaben, was passieren würde. Als würde das Kind verschwinden, es sich anders überlegen, nur weil die Ärztin diesen Satz gesagt hatte. Es war ein wahrscheinlich dahingesagter Satz.
Mir wurde kalt, ich zitterte. Ich hatte Angst um das Baby, Angst um mich. Niemand hatte mir das vorher gesagt, niemand hatte mich gewarnt, wie nahe ich mich dem Tod fühlen würde. Die Angst vor dem Tod des Babys. Die Angst vor dem eigenen Tod. Obwohl mein Mann neben mir stand, fühlte ich mich allein, sehr allein. Es war, als ob mir erst in diesem Moment, in dem mir das Wasser von den Beinen rann, klar wurde, was auf mich zukommen würde, obwohl ich das Baby vierzig Wochen herumgetragen hatte. Meine Beine zitterten. Meine Muskeln zitterten. Meine Füße traten auf den Boden wie ein unerfahrener Torero, der auf den Bullen wartet. Mit dem Unterschied, dass sich der Bulle in mir befand. Er wollte raus.
Wollte er raus?
Ich hatte keine Wehen.
Ich rief eine Nummer an, die mir meine Hebamme gegeben hatte. Ihre Vertretung. Es war elf Uhr, am Telefon klang sie verschlafen. Welche Farbe hat das Wasser, wollte sie wissen. Die Frage klingt beiläufig. Sie sagte nicht, warum das wichtig ist. Sie sagte, ich soll mich hinlegen. Zwei Stunden später stand sie an meinem Bett. Ich mustere die Frau auffällig, sie wirkt ruhig, fast gelangweilt. Sie holte ein Fieberthermometer heraus, einen langen Schlauch und ein graues Messgerät. Sie legte den Schlauch um meinen Bauch, schloss die graue Kiste an, die nun vor sich hin piept.
Die Herztöne Ihres Kindes sind okay, sagte sie. Aber ihr Gesicht sah ernst aus.