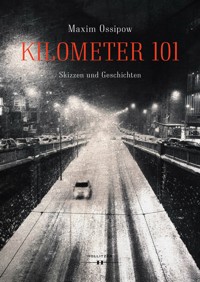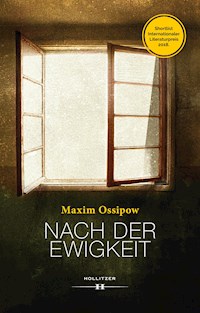
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
"Moskau - Petrosawodsk: eine Zugfahrt von ganzen vierzehneinhalb Stunden. Fast immer nerven einen die Mitreisenden: mit ihrem Bier, dem Dörrfisch, billigem Cognac Bagration oder Kutusow, anfangs mit Offenheit, dann mit Aggression. Wir fahren los, alles in Ordnung, noch bin ich alleine im Abteil."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NACH DER EWIGKEIT
MAXIM OSSIPOW
NACH DER EWIGKEIT
Deutsch von Birgit Veit
Lektorat: Regine Weisbrod
Umschlaggestaltung: Nikola Stevanović
Satz: Daniela Seiler
Hergestellt in der EU
Maxim Ossipow: Nach der Ewigkeit
Aus dem Russischen von Birgit Veit
Die Übersetzung wurde vom Institut Perevoda
und vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Alle Rechte vorbehalten
© HOLLITZER Verlag, Wien 2018
www.hollitzer.at
ISBN 978-3-99012-455-0
INHALT
Der Schrei des Federviehs
Moskau – Petrosawodsk
Schere, Stein, Papier
Ein Mann der Renaissance
Der in den Wogenschwall des Meeres einst begrub
Cape Cod
Der polnische Freund
Pappkombinat Liebknechtzk
Bergarbeitersiedlung Ewigkeit
An der Spree
Herzensgute Menschen
Glossar
DER SCHREI DES FEDERVIEHS
Statt eines Vorworts
Provinz heißt Heim: warm, nicht zu reinlich, dein. Doch es gibt noch eine andere Sicht, aus der Distanz, von oben herab, von vielen geteilt, die gegen ihren Willen hier gestrandet sind. Provinz, das bedeutet: Schwärze, Schlamm, Matsch; die Bewohner: arme Teufel, so ihr schmeichelhaftester Leumund.
Der Schrei des Federviehs vertreibt das Böse, das in der Nacht an Macht gewonnen hat.
Krankenhausmorgen. Im Bett ein hagerer, verrauchter Mann, kein Heimvögelchen, ein Busfahrer, Herzinfarkt. Das Schlimmste ist vorüber, er verfolgt die Behandlung seines Bettnachbarn, eines alten Penners, auf dessen Handgelenk eine eintätowierte blaue Sonne prangt. Elektroschock, der Herzrhythmus ist wieder normal. „Dem ist leichter geworden, dem Opa da, er atmet seltener“, sagt der Fahrer hinter der Schirmwand. Wir werfen einander einen Blick zu. Wird er wieder als Busfahrer arbeiten dürfen? Und was ihm im Augenblick am meisten auf den Nägeln brennt: dass sich seine Ehefrau und die andere, die ihm Schaschlik zusteckt, bloß nicht hier im Zimmer begegnen. Der Fahrer durchschaut auch mich verdammt gut: Wilde Vögel haben scharfe Augen.
Ein klares Verlangen drängt einen, nicht nur die Angehörigen daheim zu lieben, sondern darüber hinausgehend: die Leute und den Ort. Da hilft es, sich zu erinnern, genau hinzusehen, erfinderisch zu sein.
Aus meinen Kindheitserinnerungen. Vater und ich haben in der Hitze einen weiten Weg zurückgelegt. Ein Dorf, wir haben schrecklichen Durst. Vater klopft irgendwo an und bittet um Wasser. Die Hausfrau sagt: „Wir haben kein Wasser“, bringt aber kalte Milch. Wir trinken und trinken, ganze anderthalb Liter. Vater bietet der Hausfrau Geld an. Die zuckt befremdet mit den Achseln: „Mein Lieber, hast du sie noch alle?“
Jeder Ort ist auf seine Weise anziehend, das gilt erst recht für Mittelrussland. Sich dafür zu begeistern, ist so leicht, wie sich eine Frau in einen Versager verliebt. „Doch, wir lieben diese Felsen“, heißt es in der norwegischen Nationalhymne. Auch in unserer Hymne wird die Geographie besungen, ein bisschen peinlich angesichts unserer Weiten. Die Hymne haben sich die da oben ausgedacht, die anderen, keins unsrer Federvieh-Vögelchen.
Noch eine Erinnerung. Ich bin achtzehn und sitze am Steuer eines klapprigen Saporoshez; hinten, wo der Motor ist, steigt Rauch auf. Bedrohlich. Die Leute auf dem Bürgersteig geraten in Panik: Achtung, der fliegt gleich in die Luft! „Mach auf“, sagt ein Passant um die dreißig, nimmt einen Lappen, erstickt damit seelenruhig die Flamme und geht seiner Wege – noch so ein unheimlicher Vogel.
Auto- oder Reisegeschichten fallen mir jede Menge ein. Unterwegs ist das heimische Federvieh ja Unannehmlichkeiten ausgesetzt, begegnet wilden Vögeln und Raubvögeln. Begegnungen, die sich einprägen, da sie sich genauso überraschend liebenswürdig wie unerhört, undenkbar böse gestalten können. „Mörder sind durchschnittliche Menschen“, wird der Milizoberst sagen, und du, Grünschnabel, Heimvögelchen, plötzlich nimmst du ihm das ab, begreifst. Es wird deins.
Apropos Miliz. Die hiesigen Ärzte haben einen guten Draht zu ihr. Patienten hochschaffen, wenn der Aufzug streikt, Alkoholiker bis zum nächsten Tag wegsperren, damit sie im Krankenzimmer nicht randalieren, selbst ein Auto aus dem Schlamm ziehen, da ruft man die Miliz. Die sind wie die Ärzte in Uniform und vermitteln den Einheimischen den Eindruck, sie würden beschützt.
Notaufnahme. Daneben: ein Milizionär mit einem Untersuchungsgefangenen in Handschellen, einem jungen Mann, der Prügel abbekommen hat. Er muss etwas Ernstes ausgefressen haben, sonst wären ihm keine Handschellen angelegt worden. „Hättest du doch gleich gesagt, dass du Frau und Kinder hast“, sagt der Milizionär zu dem Untersuchungsgefangenen, „statt einen Rechtsanwalt zu fordern und mit deinen Moskauer Kumpanen zu drohen …“
Neben dem Burschen, der das Feuer im Motor erstickte, taucht das Gesicht eines verschwitzten, schlampig angezogenen Hockeyspielers aus meiner Erinnerung auf. „Dass Sie die Erfinder des Hockeys in deren Heimatland bezwungen haben, muss Sie doch doppelt freuen.“ Sein zahnloser Mund lacht. „Das ist doch Jacke wie Hose!“ Bei dem, was er verdient, hätte er sich weiß Gott die Zähne machen lassen können, aber offenbar hat er auch so keine Probleme, in Fleisch zu beißen. Ein äußerst überzeugender Eindruck.
Was noch? Die Predigt, die ich an Mariä Schutz und Fürbitte hörte: Den Tag, da unsere Vorfahren besiegt wurden, haben wir zu einem unserer höchsten Feiertage erkoren. Es gibt nichts Einfacheres, als über die Kirche zu schimpfen. Das ist wie über Dostojewskij schimpfen: richtig, zweifellos richtig, aber es geht an der Sache vorbei, trifft nicht den Kern. Die Kirche ist ein Wunder, Dostojewskij ist ein Wunder, und dass wir Russen überhaupt am Leben sind, ist gleichfalls ein Wunder.
„Mein Lieber, hast du sie noch alle?“ Das könnte eine der Babkas sagen, die im ersten Zimmer liegen. Babka, Oma, das ist keine Beleidigung, sie nennen sich selbst so. Die am schwersten krank ist, hört Stimmen und hat Halluzinationen. „Jurij, bist du’s?“ „Nein, ich bin nicht dein Jurij“, antwortet die Bettnachbarin. „Sondern?“ „Eine Babka.“ „Dann ist das hier Jurij?“, fragt sie die andere Bettnachbarin. „Nein“, antwortet die, „ich bin auch eine Babka.“ Das Wort „Babka“ hat nichts Beleidigendes. Im Unterschied zu den gleichaltrigen Vögelchen in den großen Städten fühlen sie sich nicht wie alte Frauen mit klarem Kopf, sondern wie Babkas.
Tagsüber haben sich zwei Krankenpflegerinnen lautstark angekeift. Die eine arbeitet hier, um ihr Vieh und sich selbst mit dem Essen, das von den Patienten übrigbleibt, durchzubringen; die andere besitzt ein paar Hektar Land, fährt abwechselnd in die Türkei und nach Europa und hat die Stelle als Pflegerin angenommen, um unter Menschen zu kommen. Oder, Moment, andersrum: Die in Europa war, das ist die erste Pflegerin, sie hat mehrere Kredite aufgenommen, die Ärmste, der Gerichtsvollzieher war schon bei ihr zu Besuch.
Der Einzelne steht bei uns über der Gemeinschaft. Der Steuerprüfer, ein Bursche Anfang zwanzig, strahlt: „Das trifft sich gut, dass Sie Arzt sind, ich will mich nämlich vor der Armee … verstehen Sie?“ Was gibt’s da zu verstehen? „Ausnahmsweise“ ist bei uns eine probate Klausel, jeder hängt von jedem ab. Wenn Moskau nicht den Tränen glaubt, bei uns glaubt man sonst an nichts. Ausweglose Situation? Na klar, machen wir. Ausnahmsweise.
Ein Verstoß, der einen nicht rühren sollte, aber die fröhliche Beteiligung am allgegenwärtigen Betrug schweißt eine Nation nicht schlechter zusammen als gute Gesetze. Wie, Licht, Gas, Telefon nicht bezahlt? In der Hauptstadt ist Geldmangel eine Schande, hier ist er die Regel. „Diese Zähler machen, was sie wollen.“ „Das Gefühl habe ich auch.“ „Kommen Sie vorbei, wir kriegen das schon hin.“ Paten, Schwiegertöchter, Neffen, Wasser-, Elektrizitäts-, Gaswerke: überschaubar, anheimelnd, warm. Sicher, man muss ein paar Abstriche machen, aber die Lage ist recht stabil. Hier weiß jeder alles über jeden. Wie im Paradies.
Die Pflegerinnen und Babkas sind Tagesgespräch, am Abend aber stellt sich heraus, einiges hat heute bei weitem zu viel Kraft gekostet, und vieles hat gar nicht geklappt. Mit der Dämmerung kehren die bösen, quälenden Gedanken zurück. Besonders: Wo sind die tüchtigen Menschen hin? Als wir klein waren, waren es genug. Alle emigriert? Eins fügt sich ans andere und schaukelt sich hoch. In der Nacht mit ihren Schrecken ist die Seele empfänglicher für das Böse. Und noch eins: Immer wieder verirren sich Meisen oder Schwalben ins Haus, ein schlimmes Vorzeichen. Man kann die Fenster doch nicht ständig geschlossen halten. Geh weg, wenn du Angst hast, oder setz dich über die gespenstischen Vorstellungen hinweg. In diese Richtung gehen alle Gedanken bis zum Morgen, nur der Schlaf unterbricht sie.
Ob in Moskau, Petersburg oder der Provinz: Das Leben ist schrecklich. Zumindest auch. Es geschieht Unbeschreibliches: Opfer sind Unschuldige, noch junge Menschen und ganz kleine Kinder. Das schreckliche, unnötige Leid durch ihren Tod lässt uns nicht los, du schreist es dir nicht aus dem Leib, der Schrei vertreibt das Böse nicht.
Und dann bricht der Tag an, und sie sind wieder da: die Vögel unter dem Himmel, das Federvieh, wilde Vögel, alle miteinander. Was auch eintritt, die Welt bricht nicht entzwei, so ist sie eingerichtet.
September 2010
MOSKAU – PETROSAWODSK
Merck auff Hiob / vnd höre mir zu / vnd schweige das ich rede.
Hiob 33, 31
Den Menschen von seinem Nächsten befreien, ist das nicht der Sinn des Fortschritts? Was kümmern mich die Freuden und Nöte anderer? Richtig, nichts. Kann man nicht wenigstens auf Reisen mal alleine sein?
Es musste entschieden werden: Wer fährt nach Petrosawodsk? Eine Konferenz mit internationaler Beteiligung. Meine Herren Doctores, einer muss! Kenn ich, Konferenzen dieses Kalibers: eine Handvoll Emigranten, und fertig ist die Internationale. Kleiner Empfang, Hotel, Vortrag, großes Besäufnis und ab nach Hause. Nach dem Vortrag gibt’s noch Fragen, doch kräftige Männer deuten hinter deinem Rücken mit hochrotem Gesicht auf die Uhr: Zeitlimit. Diese Männer sind lokale Größen. In der Provinz ist jetzt jeder ein Professor. Wie im amerikanischen Süden. Jeder Weiße ist Richter oder Oberst.
Also, wer fährt nach Petrosawodsk? Ich melde mich: der Ladogasee-See und so. „Nein, nicht der Ladoga-, sondern der Onega-See.“
„Na und? Kennen Sie Petrosawodsk? Na eben, ich auch nicht.“
Am Bahnhof wird mir mulmig. Um mich zu schützen, mime ich einen abgebrühten Reisenden. Schlendere betont lässig zu meinem Abteil und signalisiere: Kenn mich mit Bahnhöfen aus, Überfall zwecklos.
Moskau – Petrosawodsk: eine Zugfahrt von ganzen vierzehneinhalb Stunden. Fast immer nerven einen die Mitreisenden: mit ihrem Bier, dem Dörrfisch, billigem Cognac „Bagration“ oder „Kutusow“, anfangs mit Offenheit, dann mit Aggression.
Wir fahren los, alles in Ordnung, noch bin ich alleine im Abteil.
„Bitte die Fahrkarten bereithalten.“
„Fräulein, können wir einen Deal machen … Wissen Sie, ich möchte … Ich würde gern alleine bleiben?“
Sie wirft einen Blick auf mich: „Das hängt davon ab, was Sie vorhaben.“
Was soll ich denn vorhaben? „Ich will ein Buch lesen.“
„Ein Buch lesen macht fünfhundert.“
Auf einmal erscheinen zwei Typen. Auf den letzten Drücker. Belegen die unteren Plätze. Sitzen da und atmen. Verflucht. Die Reise ist im Eimer. Schade. Macht es euch bequem, ich will nicht stören. Ich auf die obere Liege geklettert und ihnen den Rücken zugedreht, sie richten sich unten ein.
Der Erste ist ein einfacher, primitiver Kerl. Kopf, Hände, Schuhe, alles groß und grob, offen stehender Mund, ein Debiler. Ein verschwitzter Debiler. Holt das Handy raus und spielt wie ein Wilder. Klingelingeling, wenn er gewinnt. Wenn er verliert: Plopp. Mit der freien Hand ruckelt er an seinem Reißverschluss, was ebenfalls Krach macht, und zieht auch noch die Nase hoch. Aber er scheint nüchtern zu sein.
Der Zweite unter mir sagt gereizt: „Zieh die Jacke aus, du Idiot.“ Aufgebracht: „Lass das Geschniefe!“
Das kann ja heiter werden. Räderrattern. Von unten kommt: Klingelingeling. Dabei soll ich lesen können? Wird das die ganze Fahrt so gehen?
Ich raus auf den Gang. Unterhaltung im Nachbarabteil:
„Russland gehört zu den länglichen Ländern“, tönt eine angenehme junge Männerstimme, „im Unterschied beispielsweise zu den USA oder Deutschland, Ländern des runden Typus. Übrigens habe ich in beiden Ländern lange gelebt.“
Das Mädchen seufzt begeistert.
„Russland“, fährt die Stimme fort, „ähnelt einer Kaulquappe. Man kann es nur von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten durchqueren, mit Ausnahme des Körpers der Kaulquappe, der relativ dicht besiedelt ist und den man nur von Norden nach Süden und von Süden nach Norden durchqueren kann.“
Das kommt links von der Tür meines Abteils. Rechts trinkt man, zerlegt ein Huhn, zerquetscht Tomaten, stößt miteinander an und wiehert vor Lachen.
Ich setze mich wieder auf meinen Platz. Wie langsam die Zeit vergeht! Wir sind gerade erst aus Moskau raus.
Dreißig Minuten, sechzig Minuten. Bald muss Twer kommen. Der Debile bimmelt. Der Zweite ist munter geworden.
„Schalt den Ton aus!“
„Tolja, das ist …“
Aha, Tolja. Groß, eins neunzig oder so, lange, weiße Finger mit runden Nägeln. Gesicht: unauffällig. Dünne Lippen. Quasi gesichtslos. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Irgendwas missfällt mir an Tolja. Er hat keinerlei Ausstrahlung. Anaesthesia dolorosa: schmerzhafte Unempfindlichkeit der Sinne. Du streichst mit der Hand über eine Fläche und hast kein Gefühl dafür, ob du etwas Glattes oder etwas Raues berührst. Ob ich voreingenommen bin? Er ist nüchtern, respektvoll, bemüht, nicht zu stören.
„Lass uns einen Blick in die Zeitung werfen, neueste Ausgabe.“
Besten Dank. Die Zeitungen von euch kennen wir: Striptease einer Tennisspielerin vor Journalisten, Tragödie in der Familie einer Fernsehmoderatorin, Tochter eines Milliardärs entführt. Tipps für den perfekten Waschbrettbauch. Chronik der Verbrechen. Tote in Farbe. Pfui, Spinne.
Tolja hat sich die Zeitung genommen, raschel-raschel. Nach einer Weile zu dem Debilen: „Komm, gehn wir raus.“
Ich bleibe kurz alleine. Eine feine Reise.
Bevor sich alle schlafen legen, passieren noch ein paar uninteressante Dinge.
Erstens: Aus dem Nachbarabteil, in dem getrunken wird, kommt ein Besoffener. Mit Kamera in der Hand. Öffnet die Tür und will ein Foto machen. Tolja zuckt zusammen, wendet sich schlagartig ab und verbirgt das Gesicht. Aha, einer vom KGB, Tschekist. Alles klar.
Der Betrunkene streckt die Hand nach mir aus, ich wollte gerade Zähneputzen gehen. Ich soll ihn mit seinen Freunden knipsen. Ich knipse. War’s das? Nein. Ich muss mir seine Lebensgeschichte anhören. Er rückt mir auf die Pelle: Wodka, Schweiß, Zigarettenqualm, mir bleibt die Luft weg. Man kann doch wohl ein bisschen Distanz halten, oder? Wie in Amerika.
Seine Mutter hat ihm seinerzeit hundert Rubel für eine Kamera geschenkt, sie ihm aber, als ihr das Geld ausging, wieder abgenommen. Und das, wo er seit frühster Kindheit hatte fotografieren wollen. Schrecklich, nicht wahr? Ich zeige Mitgefühl und will gehen.
„Halt!“ Er deklamiert einen hippen Vers.
„Entschuldige“, sag ich, „ich muss dringend aufs Klo. Bin gleich wieder da.“ Mit Mühe reiße ich mich los.
„Mit der Bahn durch die Tundra, tralalala …“, grölt er, breitet die Arme aus und droht, alle zu umarmen, die es nicht schaffen, ihm vorher aus dem Weg zu gehen.
Es gibt also noch Schlimmere als meine Abteilnachbarn, muss ich schließen. Einer vom KGB, na und? Sagt nichts, stinkt nicht und hält Abstand. Darauf legt er ebenso viel Wert wie ich.
Zweitens: Wie sich herausstellt, ist das nächstliegende Klo unbenutzbar. Jemand hat die Kloschüssel bis zum Rand mit Zeitungen vollgestopft. Durchnässte bunte Bildchen – was das soll?
Drittens: Das Wasser für den Tee ist lauwarm, ob es wenigstens abgekocht ist?
„Diese Sowjetratte“, stößt Tolja hervor.
Nein, der ist nicht vom KGB.
Das Deckenlicht geht aus, ich sollte versuchen zu schlafen. Was die beiden verbinden mag? Etwas Gutes kaum. Nicht verwandt und keine Kollegen. Ob sie schwul sind? Wer weiß? Na, und wenn! Möglich, ja. Unter einfachen Leuten ist das weiter verbreitet, als man denkt.
Dieselben Geräusche: ratter-ratter, schnief-schnief. Selbstmitleid. Ich schlafe ein.
Ich bin eingeschlafen und habe unerwartet fest und lang geschlummert. Als ich aufwache, erwartet mich draußen die Morgensonne, Schnee und – dem Aussehen der Fichten nach zu schließen – starker Frost.
Ohne meine Mitreisenden anzusehen, verlasse ich das Abteil. Der Zug hält. „Snytj“ oder so ähnlich, schwer zu erkennen. Achtung, beim Halt auf dem Bahnhof darf das WC nicht … Geduld. In ein paar Stunden müssen wir das heißersehnte Petrosawodsk erreichen: Hotel, Warmwasser, Mittagessen, Wein. Ich fühle mich schon viel besser. Warum muss ich auch alles immer so schwernehmen?
Mein Abteil ist vollzählig. Tolja hat sich offenbar überhaupt nicht hingelegt, sitzt am Fenster und schüttelt erregt den Kopf: „Was ist los? Wieso fahren wir nicht?“
„Snytj oder so“, sage ich. „Halt in Snytj.“
„Was? Wo sind wir eigentlich, Gelber?“
„In Swirj, halbe Stunde Aufenthalt.“ Der Gelbe macht jetzt einen viel besseren Eindruck. Spielt nicht, schnieft nicht.
Der Gelbe geht, der Zug fährt weiter. Ich wasche mich, trinke heißen Tee und werde fröhlicher. Meine Lebenskräfte sind zurückgekehrt, ich will frühstücken, gute Laune verbreiten, über die Moskauer Professoren herziehen, jungen Ärztinnen imponieren. Ob wir pünktlich eintreffen? Ich erkundige mich. Es sieht gut aus.
Aber was ist mit meinem Abteilnachbarn los? Tolja, der allein geblieben ist, macht beim Tageslicht einen geradezu mitleiderregenden Eindruck.
„Anatoli, ist Ihnen nicht gut?“
„Was?“ Er wendet sich mir zu.
Um Gottes willen, er zittert ja wie Espenlaub! Kenn ich. Gegen Ende des ersten Krankenhaustages beginnt der Patient zu zittern, kämpft mit irgendwelchen Teufeln und springt womöglich aus dem Fenster. Delirium tremens! Klarer Fall. Aha, Tolja ist Alkoholiker.
„Schaffnerin“, schreie ich, „Schaffnerin! Der Fahrgast hier ist im Delirium tremens, wirklich. Alkoholdelirium. Haben Sie einen Erste-Hilfe-Koffer?“
Fehlanzeige. Sowjetratte, genau! Ich soll mich an den Zugführer wenden. Und wo finde ich den? „Geben Sie ihm Alkohol, das bezahle ich, der schlägt sonst alles kurz und klein!“
„Beruhigen Sie sich“, sagt die Schaffnerin, „wo ist denn sein Kumpel hin?“
„Ausgestiegen in diesem Swirj oder wie das Kaff heißt.“
„Wieso ausgestiegen? Der hatte doch eine Fahrkarte bis Petrosawodsk.“ Sie schreit: „Wie der das Klo mit seinen Zeitungen versaut hat! Ein ganzer Stapel! Als ob das Klopapier nicht gereicht hätte!“
Was hat denn das Klo damit zu tun? Dem Fahrgast hier geht es schlecht. Er braucht Hilfe und kein Gezeter. Wer weiß, ob er nicht gleich mit dem Kopf gegen die Wand rennt!
Zu spät, sie explodiert: „Wir knöpfen uns Ihr Abteil gleich vor, junger Mann, und schmeißen Sie aus dem Zug.“ Und weg ist sie. Himmel, ich habe Angst, das Abteil zu betreten. Stehe vor der Tür und warte.
Halt in Pjazh Selga. Ein Milizionär kommt. Klar, der blickt durch. Ich, Doktor der Medizin, nicht, aber der, na klar! Genosse von Felix dem Eisernen, so eine Amtsperson, die hat per se einen Riecher für die Wahrheit.
„Die Ausweise, bitte!“
Meinen registriert er kaum. Mit Tolja geschieht währenddessen etwas Schreckliches: Er ist auf den Tisch geklettert, will das Fenster mit dem Schuh einschlagen. Beim ersten Mal schafft er’s nicht, dann doch: Glassplitter, kalter Wind, Blut. Alles geht blitzschnell. Der Milizionär schlägt Tolja mit dem Gummiknüppel auf die Beine, Tolja hält sich an der oberen Liege fest und hängt in der Luft. Dann stürzt er zu Boden. Wie man ihn herausgezogen hat, konnte ich nicht sehen, die Schaffnerin brachte mich ins Nachbarabteil, zu einem sympathischen jungen Mann und einem Mädchen.
Ein auffallend leicht gekleideter Bursche im Trainingsanzug und weitere Milizionäre kommen angelaufen und bearbeiten Tolja minutenlang unter unserem Fenster. Sie schlagen ihn mit Fäusten und schwarzen Knüppeln. So sieht die Therapie von Delirium tremens bei uns aus, offen gesagt, nicht gerade eine Krankheit mit Seltenheitswert in unseren Breiten. Muss ich ins Detail gehen? Die von der Miliz nennen das „harte Nummer“. An einem bestimmten Punkt meine ich ein Knacken der Knochen gehört zu haben, aber was für Geräusche lassen die Doppelfenster des Abteils schon durch?
Sie schlagen ihn, sagen etwas, stellen ihm wohl auch Fragen. Von der Seite schleppen sie den Gelben an und schlagen gleichfalls auf ihn ein. Der fällt sofort hin, dreht den Kopf weg, krümmt sich, sie strengen sich mit ihm weniger an. Die Hüter der Rechtsordnung sind anscheinend müde geworden.
Wir beobachten dieses entsetzliche Schauspiel durchs Fenster, bis der Zug losfährt.
„Entsetzlich, wie entsetzlich“, jammert das Mädchen. Warum haben wir nicht verhindert, dass sie zuschaute? „Schrecklich, ich möchte, ich will in diesem Land nicht leben!“
„Das ist genau das, was ich gesagt habe“, erklärt der junge Mann. „Aber darüber zu lamentieren und zu klagen, ist kontraproduktiv.“
Ich verstehe nicht auf Anhieb, was ich angerichtet habe. Wie wenn du nach einem folgenschweren ärztlichen Fehler noch eine Weile blöde den Patienten, die Monitore und deine Kollegen anstarrst.
„Sie passen hervorragend zusammen, die Geschlagenen und die Schläger“, fährt der junge Mann fort. „Wenn ein Professor aus Berkeley so zusammengeschlagen wird, nimmt er sich aus Scham den Strick. Während die hier aufstehen, sich schütteln und finden: Bis zur Hochzeit ist’s wieder gut.“
„Und Sie?“, frage ich. „Was würden Sie tun?“
„Ich?“, entgegnet er lächelnd. „Ausreisen.“
Wir wissen wohl alle drei nicht recht, was wir sagen.
„Warum nicht ausreisen“, schaltet sich das Mädchen ein, „bevor man geschlagen wird? Normale Menschen halten es hier nicht aus.“
Mein neuer Kamerad lächelt wieder: „Ich weiß nicht, wie ich diese Reise ohne meine reizende Weggefährtin hätte überstehen können. Der Zug hat noch nicht einmal richtige Schlafwagen.“
Ich schaue mich um: Merkwürdig, ein Abteil genau wie meins, aber alles blitzt vor Ordnung und Wohlstand. Der junge Mann duftet nach einem wohlriechenden Parfum. Jawohl, auch ein Konferenzteilnehmer. Früher war er Arzt, jetzt Verleger, Herausgeber einer Zeitschrift („wie Puschkin“), Präsident einer Assoziation und vieles andere. Auf dem Tisch: eine halbe Flasche „Napoleon“. Und das Mädchen: wirklich reizend.
„Sie müssen etwas trinken.“ Gläser hat er auch mit, aus Onyx oder Jaspis oder so. Steingläschen. In der Tat: ein exquisiter Cognac.
Der junge Mann erklärt, warum er nicht ausgereist ist. Die Kultur: „Für meine amerikanischen Freunde ist dreimal A zum Beispiel: American Automobile Association. Und was verbinden wir mit dreimal A?“ Vielsagende Pause. „Die Dichterin Anna Andrejewna Achmatowa.“ Er mustert uns triumphierend und fügt hinzu: „Und die Businesse.“ Im Ernst: Businesse.
Es tut gut, sich mit Cognac aufzuwärmen, wenn man das Unglück zweier Menschen auf dem Gewissen hat!
„Sie haben vollkommen recht“, fährt der junge Mann fort, „das ist nicht unser, sondern deren Land.“
Habe ich so etwas gesagt?
„Die Auswahl dieser Leute liegt nicht in unseren Händen, es findet eine Art negativer Auslese statt. Das Ergebnis: Im Rahmen des herrschenden Systems ist ein humaner Milizionär ein Ding der Unmöglichkeit! Das System würde ihn rausschmeißen. Die Alternative? Das System ändern. Oder innere Emigration. Schlimmstenfalls“, er breitet theatralisch die Arme aus, „Downshifting.“
Ich fange den Blick des Mädchens auf. Tja, Downshifting.
Jemand klopft mit etwas Eisernem an die Tür. „In fünfzehn Minuten sind wir da.“
Ich muss meine Sachen holen, der Nachbar will mir dankenswerterweise helfen.
In dem verwüsteten Abteil mache ich eine höchst wichtige Entdeckung. Ich verstehe auf einmal, was für Typen Tolja und der Gelbe sind. Neben meinem Koffer unter der Bank stehen zwei riesige, karierte Taschen, mit denen nur ganz bestimmte Leute unterwegs sind: fliegende Händler. Auch die merkwürdige Freundschaft meiner Weggefährten klärt sich auf. Unter den fliegenden Händlern sind ganz unterschiedliche Leute. Und warum man sie brutal zusammengeschlagen hat, ist ebenfalls klar.
„Die Konkurrenz“, stimmt der junge Mann mir zu. „Die Miliz handelt in deren Auftrag.“
„Und warum mit solcher Verve, wenn es ein Auftrag war?“
„Aus Begeisterung. Ich sage ja, Milizionäre sind keine Menschen.“
Fliegende Händler. Auch zu dieser Berufsgruppe hat mein Gesprächspartner einiges zu berichten: „Sie erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Funktion“, sagt er mit seiner schönen Stimme. „Unsere ganze Gesellschaft reißt sich momentan um ein und dasselbe: Designerklamotten, eine Rolex und so weiter; und diejenigen, die sich keine Schweizer Rolex leisten können.“ Er macht eine abwertende Geste mit der linken Hand, „die werden von fliegenden Händlern wie Ihren beiden da – wie hießen sie noch? – mit einer chinesischen oder anderen Rolex versorgt. Das ist schließlich auch eine Uhr, sie zeigt die Zeit an und sieht gut aus.“
Wie schwer diese Taschen sind! Wohin damit? Der Schaffnerin geben? Nein, dieses Miststück kriegt nichts von mir. Der junge Mann zuckt mit den Achseln, ich schleppe die Taschen in den Flur und frage: „Könnten Sie mir beim Tragen helfen?“
„Wissen Sie was?“ Er denkt nach. „Geben Sie mir Ihren Koffer. Was soll man von mir denken, wenn mich jemand mit diesen Riesentaschen sieht?“
Gut, danke. Ich möchte ihm ein Kompliment machen und sage: „Sie haben wirklich eine reizende Reisegefährtin!“
„Von wegen!“, entgegnet er. „Eine Schreckschraube! Höchstens siebeneinhalb Punkte.“
Nun will ich es aber ganz genau wissen: „Von höchstens zehn?“
„Nein, höchstens siebeneinhalb!“, sagt er lachend. „Hat topsyturvy im Kopf, verstehen Sie? Kraut und Rüben.“
Das passt mir in den Kram. Er hat also nichts mit ihr gehabt. Merkwürdig, dass mich das unter diesen Umständen so interessiert. Aber es wäre doch zu ärgerlich, wenn wir die Zeit auf derart unterschiedliche Weise zugebracht hätten.
Ohne eine Miene zu verziehen, lässt uns die Schaffnerin aussteigen, das Mädchen wird abgeholt, wir verabschieden uns, warten auf einen Gepäckträger, hetzen mit Mühe hinter ihm her und sehen auf einmal ein Transparent: „Wir begrüßen die Teilnehmer …“ Die Konferenz scheint wirklich hochkarätig zu sein.
Im Taxi sagt der junge Mann: „Wissen Sie, lassen Sie die Sache mit diesen Unschuldigen Kindern auf sich beruhen.“
„Aber ich bin doch schuld an dem Ärger, den sie bekommen haben! Oder richtiger gesagt: an ihrem Unglück!“
„Ach.“ Er winkt ab. „Typischer Schuldkomplex eines Intellektuellen. Die Bullen prügeln jetzt die fliegenden Händler im ganzen Land grün und blau. Daran muss man sich gewöhnen, das Leben ist ungerecht. Lassen Sie das auf sich beruhen.“
Nein, sage ich mir, du miese Type. Das werde ich nichtauf sich beruhen lassen.
Im Hotel bitte ich um ein Telefonbuch und rufe überall an. Innenministerium, Russische Eisenbahn, Amt für Private Sicherheit, ein Amt nach dem anderen. Wider Erwarten erreiche ich spielend mein Ziel. „Kommen Sie vorbei. Der Milizoberst empfängt Sie.“ Und eine oder anderthalb Stunden später stürme ich schon mit dem Taxi zu einem dieser dunklen, gesichtslosen Gebäude. Die karierten Taschen habe ich mitgenommen. Der Oberst erwartet mich.
Schwarz auf Gold prangt ein Schild an der Tür des Obersts: Schatz, darunter steht: Semjon Isaakowitsch, und noch weiter unten in Klammern: Schlojme Izkowitsch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz schön mutig.
Der Chef ist eben erst aufgewacht und wirkt noch etwas schläfrig. In Unterhemd und Trainingshose sitzt er auf einem Sofa ohne Kissen und Decke. Mit dem einen Fuß ist er schon ganz in den Schuh geschlüpft, mit dem anderen noch nicht. Semjon Isaakowitsch mag siebzig Jahre alt sein, ist klein, ganz kahl, ohne Backen- und Schnurrbart, aber mit jeder Menge Haare, die aus Ohren und Nase sprießen, aus allen Löchern, wo keine Haare hingehören. Arme, Schultern und Brust bedeckt schwarzgraue Wolle. Ich finde, er gleicht Esau.
Wie soll ich den Oberst anreden? Der Name Schlojme passt zu ihm und gefällt mir, aber mit Schlojme reden ihn sicher nur Leute an, die ihn kennen.
„Oberst Schatz“, sagt er zum Tisch humpelnd, noch immer ist er nicht in den Schuh geschlüpft.
Also Genosse Oberst.
Er hat einen großen Bauch und dicke Arme wie ein Gewichtheber. Die breite, fleischige Nase ist von Furchen durchzogen, die Wangen noch mehr. Die Augen zu beschreiben, fällt mir schwer; ich habe kaum hineingeguckt. Der Oberst geht zum Tisch, zieht sich sein Dienstjackett über das Unterhemd und setzt sich.
Ich habe mich ein wenig vorbereitet: „Ich bin Besucher der internationalen Ärztekonferenz.“
„Aha, Arzt“, sagt er.
„Im Staatsdienst.“
Schweigen.
„Setz dich.“
Ich setze mich ihm gegenüber auf einen kleinen Stuhl. In dem Zimmer gibt es ohnehin nur einen großen polierten Tisch, ein Sofa und ein paar Stühle. Offenbar wurde der Raum vor kurzem renoviert.
„A Jid?“
Ich nicke. Komisch: a Jid in Staatsdiensten. Wie er. Kann ich zur Sache kommen? Ich erkläre: die fliegenden Händler im Zug, das, gelinde gesagt, inhumane Vorgehen, die von seinen Mitarbeitern zu verantwortende Abrechnung. Ich fordere eine objektive Untersuchung, Gerechtigkeit. Es wäre ja wohl das Mindeste, den Besitzern die Sachen zurückzugeben.
Mal nickt der Oberst, mal schüttelt er leicht den Kopf.
Das Telefon klingelt. Er nimmt den Hörer ab, antwortet in kurzen Sätzen, hauptsächlich mit unflätigen Flüchen. Ich mag keine Mutterflüche und Grobheiten, aber hier wirken sie organisch.
Kahle Wände ohne Porträts. Nur an einer Wand hängt eine mit Fähnchen bespickte Weltkarte. Riesige Dimensionen. Das System, nach dem die Fähnchen in der Karte stecken, ist undurchschaubar.
„Kommen Sie zum Ende“, sagt er, hängt ein und spricht wieder mit mir. „Wir hatten einen Parteigruppenorganisator, Wassilij Dmitritsch, einen prima Kerl. Der hat jeden Morgen eine Flasche Cognac gekippt, Punkt acht war er schon besoffen.“
Was geht mich dieser Wassilij Dmitrijewitsch an? Was soll das?
„Der hat so viel unterschlagen, dass er sich allmorgendlich eine Flasche Cognac leisten konnte. Verstanden?“
Ich höre erst einmal zu.
„Und hier“, er nickt Richtung Telefon, „geht es um den Direktor einer staatlichen Institution, bei dem man dreizehn Millionen Dollar sichergestellt hat, in bar. Die Mitarbeiter bekamen ein halbes Jahr kein Gehalt. Kannst du mir vielleicht sagen, wofür dieser Armleuchter dreizehn Millionen Dollar braucht?“
Ja, wirklich, ein dicker Hund. Aber was hat das mit den armen fliegenden Händlern zu tun?
„Fliegende Händler? So kann man die auch nennen. Hier, lies.“
Der Oberst holt die Zeitung heraus, die ich schon im Zug zu Gesicht bekommen habe.
„Gesucht wird ein gebürtiger Petrosawodsker,“ lese ich, „er steht im Verdacht, einen Doppelmord begangen zu haben …“ Ein Foto von Tolja, mit Schnurrbart, lachend, bei einem Zechgelage. Opfer des Mordes: ein Mann und ein minderjähriges Mädchen. Sie hatten Tolja bei sich wohnen lassen.
Ein abgekartetes Spiel. Der Mann, der mit seiner Tochter zusammenlebte, hatte seine Wohnung verkauft, um in eine kleinere umzuziehen. Tolja rief seinen Kumpanen zu Hilfe … Den Gelben, Gleb.
„Er heißt nicht Gleb“, widerspricht der Oberst. „Der Spitzname Gelber ist von seinem Nachnamen abgeleitet, im Interesse der Untersuchung wird er vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.“
Ich falte die Zeitung zusammen und reiche sie dem Oberst. Mir zittern die Hände, meine Stimme bebt.
„Entschuldigen Sie, Genosse Oberst, dieses Käseblatt von der Klatschpresse kann doch wohl nicht als Beweis gelten“, wende ich dennoch ein. „Das überzeugt mich nicht.“
„Willst du dich als Schwurgericht aufspielen, das ich überzeugen muss?“
Sein Ton lässt keinen Zweifel daran: Die Zeitung sagt die Wahrheit.
Der Oberst holt ein paar Fotos heraus: „Arzt, hast du gesagt. Schau mal.“
Wir haben auch Gerichtsmedizin im Studium gehabt, aber das hier ist etwas anderes. Mir wird schlecht, ich kann nichts dagegen tun.
„Komm“, fordert er mich auf und schenkt ein. „Trink einen Schluck Wasser.“
Wie Tolja und der Gelbe sie umbrachten, verrate ich nicht. Es gibt Dinge, die wirklich keiner zu wissen braucht.
Ich erkläre dem Oberst: Ich habe schlecht geschlafen, Cognac auf nüchternen Magen getrunken, überhaupt …
„Farsteyn“, antwortet der.
„Was sollen die Fotos?“
„Zur Absicherung. Um ihre hiesige Klientel zum Sprechen zu bringen.“
Die Mörder wurden über ihre Anrufe aus der Wohnung gefunden. Das Fernmeldeamt speichert alle Telefonnummern, das wusste ich nicht. Einer von beiden oder beide hatten in Petrosawodsk angerufen, und zwar vor der Tat und – was das Wichtigste war – danach. Um keine Roaminggebühren zahlen zu müssen.
Sie sind nicht sofort gegangen, sondern haben mit den in der Wohnung gebliebenen Leichen übernachtet. Das geht mir unter die Haut. Wenn ein Patient gestorben ist, hast du den Drang, sofort die Fenster aufzureißen und aus dem Zimmer zu rennen, und die beiden … Eine oder sogar zwei Nächte haben sie mit ihnen verbracht.
„O Gott“, stammele ich außer mir vor Entsetzen, „ich habe zusammen mit Mördern in einem Abteil übernachtet! Und ruhig geschlafen! Nichts gemerkt. O Gott!“
Den Oberst lässt das kalt.
„Denk nicht darüber nach“, sagt er. „Mörder sind durchschnittliche Menschen.“
Wieder geht das Telefon, wieder redet er kaum, sondern hört zu, ich habe wieder eine Pause und bin froh darüber. Er legt auf.
„Was ist da drin? Hast du nachgesehen?“ Er meint die Taschen.
Nein, darauf bin ich nicht gekommen. Ohne sich anzustrengen, stellt er die schweren Taschen auf den Tisch. Er ist sehr stark. „Nichts anfassen. Sonst müssen wir Fingerabdrücke abnehmen.“
Elektronik. Eine Spielekonsole, für den Gelben natürlich. Er öffnet ein Etui.
„Was ist das denn?“
„Eine Flöte.“
Hat das Mädchen Flöte gespielt? Verflixt, mir wird wieder übel.
„Nicht unbedingt. Das kann von verschiedenen Stellen stammen.“
Klamotten. Selbst Klamotten haben sie nicht verschmäht! Ach so, die sind nur dazu da, um die Ikonen zu verdecken.
„Ikonen“, sagt der Oberst. „Glaubst du an Gott?“ Ohne die Antwort abzuwarten, sagt er: „Bei uns glaubt ja jetzt jeder an Gott. Sogar Juden laufen rum mit einem Kreuz um den Hals.“
Ich fasse mir instinktiv an den Hals: Ist mein Kettchen zu sehen? Ich hoffe, der Oberst merkt es nicht. Ich will ihn jetzt ungern enttäuschen.
Bücher, nein, Briefmarken.
„Verstehst du was von Briefmarken?“
Nein. Ich weiß nur, dass Briefmarken sehr wertvoll sein können.
Der Oberst legt die Sachen zurück in die Tasche. „Das kann man alles zu Geld machen.“
„Diese Mörder, ob die ein Kreuz um den Hals tragen?“
„Nein. Ich sage dir doch: Das sind ganz durchschnittliche Menschen.“
Ich stehe auf und gehe im Zimmer umher. Wie kann das sein? Wie kommt das? Warum kenne ich mich so schlecht mit den Menschen aus? Warum durchschaue ich die Dinge nicht? Ich trinke wieder einen Schluck Wasser, ich fühle mich hier schon fast wie zu Hause.
Der Oberst räumt die Taschen weg. „Setz dich. Du hast alles richtig gemacht und der Ermittlung auf die Sprünge geholfen. Sonst hätten wir sie in der Stadt schnappen müssen.“
Ich erkenne: Es war einfach ein glückliches Zusammentreffen. Wie sich herausstellt, hatte schon ein Fahnder aus Moskau in dem Zug gesessen, um die beiden zu verhaften. Genau, der Mann im Trainingsanzug. So ein glückliches Zusammentreffen. Möglicherweise hätten sie die beiden sonst nicht gefunden. Die Aufklärungsquote von Kapitalverbrechen ist minimal.
„Minimal? Wer hat das behauptet? Was für ein Armleuchter?“
Der Oberst lächelt und sagt schmeichelnd: „Schlimmasl.“
Ein Wort, das ich nicht kenne. Was heißt das?
„Schlimmasl“, wiederholt der Oberst mit Begeisterung: „Grünschnabel.“
Bin ich vielleicht nach Petrosawodsk gekommen, um mich Grünschnabel nennen zu lassen! Unangenehm!
„In Amerika“, sage ich, „muss man nicht jedem gleich eins mit dem Gummiknüppel überziehen. Da gibt es Regeln. Nicht, dass ich die Mörder in Schutz nehmen will, nein, das nicht …“
„In Amerika“, entgegnet er, „da werd ich dir was erzählen.“
Und der Oberst erzählt mir die Geschichte seines Vaters.
Schatz senior, ein beschnittener Jude, wurde zu Kriegsbeginn an die Front geschickt, brauchte aber nicht zu kämpfen. Schon im August einundvierzig wurde seine ganze Armee eingekesselt und musste sich ergeben. Schatz besorgte sich die Papiere eines toten ukrainischen Rotarmisten, sodass er nicht gleich erschossen wurde und nicht ins KZ, sondern anfangs in ein Arbeitslager und später in ein anderes Lager gesteckt wurde. Er landete schließlich in einem Bergwerk im Ruhrgebiet.
„Weißt du, was das deutsche Wort Schatz bedeutet?“
Der Oberst nickt. „Mein Vater konnte ein wenig Deutsch, vor dem Krieg konnten alle Deutsch. Er war also in dem Bergwerk gelandet und hatte nur einen Wunsch: zu überleben. Obwohl ihn die Ungewissheit quälte, wie und wann der Krieg zu Ende ginge, und obwohl er nicht wusste, was mit seiner Familie war. Ein Arbeitslager ist kein Vernichtungslager, aber von denen, die den ganzen Krieg dort eingesperrt waren, überlebte nur jeder Zehnte.
Sollte er sich als Übersetzer melden? Nein, ging nicht. Erstens war es riskant, sich zu exponieren, zweitens, die Leute im Lager waren alle prosowjetisch. Wer mit den Deutschen mehr Kontakt als nötig hatte, war ein Schwein. Schatz wählte einen anderen Weg: Er erfüllte nicht eine Norm, sondern zwei. Dafür gab es eine Prämie: Brot, Tabak. Er hörte auf zu rauchen, die einzige Freude, die er hatte. Aber er hörte auf, um mehr essen, mehr arbeiten und den Plan erfüllen zu können. Er tauschte bei den Kameraden Tabak gegen Essen und aß sich immer satt. Wenn er als Erster aus dem Stollen nach oben kam, klaute er bei der Wache Kartoffeln, Eier, Brot. Nur Essbares. Wenn er erwischt wurde, setzte es Schläge, und zwar nicht zu knapp, jedes Mal zwanzig Stockhiebe. Das nannte sich deutsche Ordnung. Sein Rücken war schwarz von den Stockhieben, von oben bis unten. Sie schlugen ihn, schlugen ihn aber nicht tot.“
„Und die haben nicht rausgekriegt, dass Ihr Vater Jude ist?“
„Solange die Selektion andauerte, nicht. In der Dusche stellten sich die Kameraden vor ihn, für die eigenen Leute hatte er sich etwas einfallen lassen.“
„Eine Phimose.“
„Zum Beispiel. Dann bekamen sie Wind davon. Sie erfuhren es von unseren Leuten. Als bekannt wurde, dass Schatz Jude ist, wurde sein Leben sehr viel härter. Er galt als ‚nützlicher Jude‘, so nannten die Deutschen das. Die Norm, die er zu erfüllen hatte, war dreimal so hoch wie die übliche. Hinzu kam, er hatte unter den Deutschen und unter seinen eigenen Leuten zu leiden. Aber richtige Sadisten gab es wenige im Lager. Die Wachposten waren normale Menschen.“
„Durchschnittliche“, springe ich ihm bei.
„Ja, durchschnittliche.“ Der Oberst bemerkt die Ironie nicht.
„Sadisten gab es wenige, nicht mehr als jetzt, aber eine hatte es in sich, die Frau des Lagerkommandanten. Ein schönes Weibsbild, meint mein Vater. Sie haute den Männern mit Wollust ihren Stöckelschuh in die Leistengegend. Zwang sie, in ihrer Gegenwart die Hose runterzulassen. Kurz, sie amüsierte sich bis zum Geht-nicht-mehr.
Sie wurden von den Amis befreit. Das lief so: Die Amerikaner umzingelten das Lager und warteten, bis die Wache kapitulierte und von den Häftlingen erschlagen wurde. Das dauerte so ein, zwei Tage. So lange hielten sie Abstand. Die typisch amerikanische Vorgehensweise. Die Deutschen wollten sich den Amis ergeben, aber die wollten keine deutschen Kriegsgefangenen.“
„Was hat er mit ihr gemacht?“, frage ich.
„Sie gespachtelt. Verstehst du? Als Erster.“
„Und dann? Danach? Hat man sie erschlagen?“
„Klar“, sagt er achselzuckend. „Die Deutschen wurden alle erschlagen. Unwahrscheinlich, dass jemand davonkam.“
Wir schweigen eine Weile.
„Und was für eine Einstellung hatte Ihr Vater später den Deutschen gegenüber?“
„Eine ganz normale. Was heißt hier hatte? Mein Vater lebt noch. Er ist nur wütend, dass er von den Deutschen keine Wiedergutmachung bekommt. Er wurde in den Papieren nie unter dem Namen Schatz geführt.“
Sein Vater lebt also. Und was macht er?
„Nichts, was sonst? Geht auf den Markt. Denkt an dieses deutsche Weibsbild. Früher, als meine Mutter noch lebte, hielt er den Mund, aber jetzt redet er öfter von ihr als von seiner Frau.“
Im Büro ist es fast dunkel. Ich habe auf einmal das Bedürfnis, den Oberst zu trösten, ihm wenigstens in die Augen zu blicken, aber er sitzt mit dem Rücken zum Fenster, sodass ich seine Augen nicht sehen kann. Ich druckse herum: Affektstau, Alterssexualität. Als gäbe der Arztberuf mir das Recht, mit Worten um mich zu werfen, die nicht den geringsten Sinn haben.
„Während des ganzen Krieges“, sagt der Oberst, „hat mein Vater keinen einzigen Menschen umgebracht. Und wenn deine Amerikaner ihn befreit hätten, wie es sich gehört, wie Menschen, würde ihm dieses deutsche Weibsbild nicht im Kopf herumspuken.“
Die Geschichte ist zu Ende, der Oberst ist müde. Soll ich gehen?
Ich habe noch eine Frage: „Was haben die Fähnchen auf der Karte zu bedeuten?“
Er lächelt auf einmal breit, die Zähne schimmern im Halbdunkel: „Gar nichts. Ich habe sie reingesteckt, wie es gerade kam. Einfach so.“
Ich will aufbrechen.
„Bist du auch warm genug angezogen?“, fragt der Oberst besorgt. „Hast du etwa keine Mütze?“
„Gleich zwei sogar. Eine Schirmmütze und eine Wollmütze, die wärmt.“
„Setz die Wollmütze auf.“
Petrosawodsk: Finsternis, Kälte, Eis, schlecht beleuchtete Straßen, du siehst die Hand nicht vor den Augen.
Auf dem Kongress treffe ich am Abend den jungen Mann aus dem Zug mit der schönen Stimme, er teilt mir seine Eindrücke von der Stadt mit: „Das ist der Arsch der Welt hier, wie überall sonst auch“, und er äußert den Wunsch, unsere Bekanntschaft in Moskau fortzusetzen.
„Gehen wir zusammen essen? Ich lade Sie ein.“ Und er erkundigt sich ganz nebenbei: „Haben Sie etwas herausgekriegt über diese Prügelknaben?“ Chapeau, was für ein Wort!
„Nein“, antworte ich, „nichts.“
Februar 2010
SCHERE, STEIN, PAPIER
Heute, Friedenszeit. Eine Kleinstadt in Mittelrussland, abseits von Eisenbahn und Landstraße. Am Fluss gelegen und mit Kirche.
Im Zentrum der Stadt das Haus der Xenia Nikolajewna Knysch. Einstöckig, aber groß. Der Pelmeni-Imbiss neben dem Haus gehört ebenfalls ihr. Knysch ist Vorsitzende der gesetzgebenden Versammlung des Kreises. Siebenundfünfzig Jahre alt.
Dienstagmorgen, siebter März. Auf der Vortreppe: Xenia Nikolajewna und Pachomowa, Direktorin der allgemeinbildenden Schule. Pachomowa hat eine Grußadresse und gelbe Blümchen in der Hand: „Alles Gute, Xenia Nikolajewna, Gesundheit, Glück und Wohlstand! Und ein langes Leben zum Wohle der Stadt!“
Xenia nickt, bittet sie aber nicht herein. Die Mappe enthält Papier. „Na, betteln wir mal wieder, Pachomowa?“
„I wo! Das sind Schreiben Ihres Nachbarn. Aus dem Computer, im Lehrerzimmer; heutzutage läuft ja alles über den Computer. Viel Spaß beim Lesen. Man muss ja schließlich nicht alles in der Gegend rumliegen lassen. Aber: pst!, Xenitschka Nikolajewna, Sie wissen ja, die Leute …“
Xenia, barsch: „Wir werden uns damit befassen.“
Und lächelt immerhin: „Herzlichen Glückwünsch zum Internationalen Frauentag, Ihnen allen, dem ganzen weiblichen Lehrkörper.“ Und ab ins Haus, um zu lesen. Der Nachbar ist ihr Feind. Betet für eure Feinde. Das tut sie, weiß Gott, jeden Tag, den Gott erschaffen hat …
Ich bin vierzig Jahre alt und gesund, aber mit über vierzig zu sterben, gilt nicht mehr als verfrüht; da wird es Zeit, sich zu sammeln und Aufzeichnungen zu machen. Gedanken, die sich aufdrängen, nicht abgeschlossen sind … Vierzig Jahre. Der Glaube an den Menschen nimmt ab, und damit auch der an Gott. Wozu das Ganze, wozu? Wie wenn ich gegen die Fahrtrichtung sitzend aus dem Fenster sähe. Vergangenheit, alles Vergangenheit. Vierzig Jahre, ein guter Anlass, sich die Vergangenheit vorzunehmen!
Ich bin Lehrer für russische Sprache und Literatur, unverheiratet, kinderlos. Mit Ausnahme meines Studiums an der Universität von Kalinin (ein unangenehmer, vergessener Albtraum), habe ich mein ganzes Leben in unserer Stadt verbracht. Nimmt man die triste Schönheit Mittelrusslands, so ist es hier schön. Beachtet man nicht, was der Mensch so macht, sogar sehr schön. Hier werde ich wohl für immer bleiben: Hier bin ich geboren, und hier sterbe ich. Früher, in meiner Jugend, hat mich dieser Gedanke bedrückt, jetzt nicht mehr. Ich fühle mich natürlich etwas einsam, besonders im Winter, wenn es um fünf schon stockfinster ist und alles fehlt, was das Leben ausmacht: der Fluss, die Bäume, die Nachbarhäuser. Mich totzusaufen, droht mir nicht, ich vertrage keinen Alkohol. Schreiben, das habe ich versucht, wie wahrscheinlich jeder in meiner Lage. Sollen sie das lesen und Mund und Nase aufsperren, das war Motiv für mein „Oeuvre“. Aber wer eigentlich? Ein paar Lehrer, das ist unsere ganze Intelligenz. Die Ärzte und der Pope gehören nicht zur Intelligenz; die Frauen an unserer Schule sind farblos und überlastet, mit Männern, die meist kleine Amtspersonen sind. „Wie groß ist der Durchmesser der Erde?“, fragt der Erdkundelehrer die Kinder. „Das weißt du nicht? Schlecht. Die Erde ist doch unsere Mutter.“ Diesen Spruch wiederholt er seit zwanzig Jahren, und keiner, die Lehrer eingeschlossen, hat es je für nötig gehalten, zu fragen, warum. Wir verreisen nicht; nein, die Erde ist nicht rund für uns. Und der Erdkundelehrer wird bald an Krebs sterben. Hier weiß man alles über alle, besonders das Schlechte.
„Ich geh zur Armee, sitz im Knast …“, sagte ein Dorfknabe vor kurzem verträumt, als wir seine Zukunft erörterten. Sehen so Lehr- und Wanderjahre aus? Von den Jungen meiner ersten Abschlussklassen ist fast keiner mehr am Leben: Drogen, Geschäfte, Kampfhandlungen. Anfangs war ich betrübt, aber jetzt bin ich’s schrecklicherweise leid geworden, sie zu bedauern, hab mich dran gewöhnt. Die Mädchen sind überwiegend am Leben, jedes Jahr immatrikulieren sich einige der Abgängerinnen an der Universität oder Akademie in Twer, Jaroslaw, ja sogar in Moskau. Die Mädchen haben auch mehr Interesse an Büchern, sie wollen gefallen. Ich bin kein alter Mann und habe keine Familie, wir veranstalten Literaturabende, ich habe ein großes Haus. Literaturdonnerstage nennen wir das, alles ganz gesittet: Tee, Verse, Prosa. Ich freue mich gern und erfreue gerne die anderen. Selbst die traurige, überaus traurige Geschichte von Verotschka Zhidkowa hat mich nicht davon abbringen können.
Wir haben einen Fluss, aber keine Eisenbahn, und das im Umkreis von mehreren Dutzend Kilometern. Man sagt, das verhindere die Ansiedlung von Industrie, aber eine Eisenbahn, ist Unfreiheit, ein Übel. Wie Tolstoj sie gehasst und wie die Bolschewiki sie geliebt haben! Unsere Lokomotive, die fliegt voran, und so weiter. Ein Bremsweg von anderthalb Kilometern, so ein Ding. Ein Auto, ja, das ist was anderes. Wenn ich eins hätte! Das Autofahren, das würde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich würde mich ans Steuer setzen und in die Puschkin-Berge oder sogar nach Boldino fahren, an den heiligen Stätten wandeln und, hast du nicht gesehen, eine Lehrerin treffen, eine, die nicht vergeben ist, eine Alleinstehende. Wenn ich nicht einschlafen kann, lege ich mir manchmal Dialoge mit ihr zurecht. Kindisch? Na und? „Wie hat Ihnen die Exkursion gefallen?“, frage ich, und sie antwortet mir nicht ganz passend, aber so, dass ich das Zitat erkenne: „Bizarr.“
Bald gestehe ich: „Bei mir war’s Liebe auf den ersten Blick.“ Vielleicht nicht ganz so direkt, aber so was in der Art.
Sie lacht, als glaube sie es nicht.
„Ich schwöre.“
Die Lehrerin macht ein finsteres Gesicht: „Sie sollten weder beim Himmel noch bei der Erde schwören.“
Und ich beende den Satz: „Und auch nicht beim lustigen Puschkin.“
Nachdem wir die Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, fahren wir ohne große Worte zu mir. Im Auto spielen wir ein Spiel: Ich sage: „Gift und Galle“, sie antwortet: „Himmel und Hölle.“ Ich fahre fort: „Feuer und Flamme“, „Haut und Haar“, „Ross und Reiter“, „Kind und Kegel“, „Hof und Haus“, „Mann und Maus“, „Kopf und Kragen“. Sie denkt einen Moment nach und gibt sich geschlagen.
Was für Spiele man nicht alles spielen kann, aber ein Auto besitze ich nun mal nicht. Wenn ich cleverer wäre, würde ich die Hälfte meines Grundstücks verkaufen (es ist groß, und außer Unkraut wächst da nichts), das Haus umbauen, mir ein Auto kaufen und sogar noch etwas übrigbehalten. Die Preise für Grund und Boden sind bei uns in den letzten Jahren auf das Fünfzigfache gestiegen. Sodass ich ein sehr wohlhabender Mann bin, ich kann nur nichts mit meinem Reichtum anfangen. Und sehne mich, ehrlich gesagt, auch nicht sonderlich danach. Zu einem Provinzlehrer passt die Armut doch, oder? Ich hab’s warm. Zwar ist es gefährlich, dreckig und anrüchig, klar, ein bisschen anrüchig ist es schon, aber lassen wir das.
Ich habe wunderbare Eltern, der Dorfknabe (der findet: „Ich geh zur Armee, sitz im Knast …“) hat die nicht. Ein grobes Leben von Geburt an, er raubt einen Laden aus, nicht, weil er Hunger hat, sondern aus Übermut, oder trinkt und prügelt sich mit jemandem – wie soll man den verurteilen? Und wenn er eine Klassenkameradin vergewaltigt? Oder einen Menschen umbringt? Ab welchem Moment ist ein Kind für seine Taten verantwortlich, ist es das überhaupt?
Vor Neujahr habe ich einen sehr leicht angezogenen Knaben von sechs Jahren am Busbahnhof aufgelesen. Er wollte betteln, offenbar zum ersten Mal, und wusste noch nicht, wie er das anstellen sollte. Ich habe ihn unter die Neujahrstanne zu den Datschniki mitgenommen, die wuschen ihn, bekleideten ihn, gaben ihm alle möglichen Sachen.
Ich bringe ihn nach Hause. „Da, unsere Wohnung“, sagt er und deutet auf ein Zimmer, mit absolut nichts, bloß eine Glühbirne unter der Decke und ein Eisenbett, darin liegt ein nackter, dreckiger, betrunkener Typ auf einem Haufen Lumpen, es stinkt. Ich ziehe dem Typen etwas über, versuche, mit ihm zu reden: Hier sein Sohn, die Säcke mit den Sachen, es muss doch Ordnung herrschen, da fragt der mich doch: „Bist du orthodox?“ Ich druckse herum, was soll die Frage?
Der Typ richtet sich auf, wackelt auf dem Bett hin und her und fragt: „Bist du Russe?“
„Ja“, antworte ich, „ich bin Russe.“
„Wozu kommst du mit den Sachen, mit Ordnung? Ich zum Beispiel brauche überhaupt nichts.“
Warum denn das? Das wundert ihn dann eigentlich auch.
Den Sohn traf ich am nächsten Tag erneut am Busbahnhof. Er erkannte mich nicht und sprudelte nur so: „Ich war gestern vielleicht in einem tollen Haus! Die Moskauer, die leben wie die Made im Speck … Was die alles zusammengeklaut haben!“
So sind die Kinder. Und die Erwachsenen? Auf die kann man erst recht nichts geben. Fast keiner kennt die Vorwahl unserer Stadt, was soll jemand von außerhalb damit, wir fühlen uns nicht einem Ganzen zugehörig. Buddha, Sokrates, Tolstoj, ich komme aus der und der Stadt, Vorwahl soundso, so müsste es sein! An die Tiefen des Volksbewusstseins und ähnliche Ammenmärchen glauben jetzt nur noch die Datschniki, die Einheimischen sitzen vor der Glotze. Nicht aus Müdigkeit, nicht, weil das Leben schwer ist – nein, es ist leicht, es ist genug zu essen da –, sondern, um ein Loch zu stopfen, um sich mit irgendwas zu beschäftigen.
Zurück zu meiner Situation. Meine Eltern leben noch, beide pensioniert. Mein Vater war Englischlehrer, meine Mutter Grundschullehrerin, Enkel haben sie von mir nicht, und so zogen sie nach Moskau. Da gibt es Theater und Ausstellungen, und auch meine jüngere Schwester wohnt da. Meine Eltern lieben einander, lieben meine Schwester und mich. Ich habe nie gegen die Welt der Erwachsenen rebelliert. Es gibt Leute, die meinen, zur Jugend gehöre unbedingt die Revolte, ich bin anderer Meinung.
Also: Meine Angehörigen sind am Leben, und Verotschka ist der größte, ja eigentlich der einzige zu verzeichnende Verlust für mich. Drei Jahre ist es nun her, dass sie nicht mehr da ist, und ich denke täglich, wenn nicht gar stündlich an sie. Immer, wenn ich auf aufgeweckte, intelligente Mädchen treffe, die es unter meinen Schülern durchaus gibt. Eine hat mich vor kurzem gefragt: „Wenn es Kommaregeln gibt, sind die Kommas dann nicht eigentlich überflüssig?“ Warum bin ich selbst nicht auf diese Frage gekommen? „Lass mich überlegen“, sagte ich ihr, „lass mich überlegen.“ Für solche hellen Köpfchen setze ich mich gerne ein.
Um die Sache mit den Datschniki zum Ende zu bringen: Kurz vor ihrer Abreise hocken Verotschka und ich auf der Veranda und diktieren meiner Schulabsolventin Polina den Aufsatz für die Aufnahmeprüfung irgendeiner sinnlosen Höheren Lehranstalt. Dienstleistungsakademie oder so was. Die nehmen alle durch die Bank, sammeln bei der Prüfung nicht die Handys ein, sodass wir gemütlich dasitzen, Tee trinken und Polina eine SMS nach der anderen senden. Thema: „Die geistige Welt der Provinzadeligen in dem Roman ‚Jewgenij Onegin‘“. Alles, was wir ihr schicken, soll Polina weiter ausführen.
Wir tippen: „Diese Welt wird in dem Roman vom zweiten bis Ende des siebten Kapitels entfaltet. Onegin ist aus der großen Welt, aus Petersburg geflohen. Die Einfalt der Dorfbewohner: Er nahm sich das Gemach zur Bleibe, / Wo vierzig Jahr der Edeling / Sich zankte mit dem Schaffnerweibe / Am Fenster saß und Fliegen fing … und lautes Schwätzen / In ihren nüchtern-klugen Sätzen / Von Branntwein, Hundezucht und Heu / Und von Familienstreiterei. Charakteristika der Provinzbewohner: Einfachheit, Natürlichkeit der Interessen, einförmige Lebensweise, weniger Liebe zueinander als Gewöhnung. Ein unstrukturierter Tag, viel Freizeit: Schweift sie im stillen Wald, allein / Des Buchs Gefahren überlassen … Sensible Menschen tendieren dazu, sich eine rosarote Welt zurechtzulegen: Ihr Seufzen scheint den Schmerz zu melden / Fremden Entzückens, fremden Leids / Auswendig flüstert sie bereits / Den Brief an den geliebten Helden … Wichtigste Besonderheit der Provinz: Fehlen echter Lebenseindrücke, besonders bei den Frauen.“ So haben wir wirklich geschrieben: „Besonderheit“, „besonders“, wir mussten uns ja beeilen.
„Noch was?“, fragten wir.
„Ja, ja, please.“
„Ernste Einstellung zum Leben: Wäre Tatjana in Petersburg geboren, hätte sie weder bei der ersten Aussprache mit Onegin noch bei den folgenden diese Aufrichtigkeit besessen. Strenge und Einfachheit spielen hier eine andere Rolle als in den Städten. Onegin lebt nach städtischen Gesetzen, die weder Aufrichtigkeit noch Tiefgang kennen. Er tötet Lenskij aus Unachtsamkeit und macht Tatjana unglücklich. Natürlich gibt es in der Provinz ebenso wie in der Stadt auch Hochmut, Dummheit, Dandytum offener, grotesker Form, sie solle also“ – raten wir Polina – „die Situation nicht idealisieren.“ Sie bedankte sich bei uns, es war schon an der Zeit, die Reinschrift anzufertigen, aber Verotschka und ich kamen ins Überlegen: Onegin im Dorf, das ist wie die Datschniki bei uns.
Die Einfacheren laufen in der Hitze halbnackt herum, in Moskau machen sie das nicht. Die kultivierteren Datschniki wollen keinen kränken, und es unterläuft ihnen doch. Die Petersburger tun sich hervor: Anrede mit Vor- und Vatersnamen, während sich die Moskauer mit dem Vornamen begnügen. In den Hauptstädten werden Doktorarbeiten verteidigt, es passiert was Essenzielles, die Schriftsteller polieren einander die Fresse, aber hier? Dieses liebe, warme, unreinliche Leben hier kann man doch nicht ernst nehmen. Unernste Verliebtheit, unernstes Verhalten. Wenn sie vom Fluss kommen, schauen sie bei mir herein, und dann nichts wie ab in den Pelmeni-Imbiss, rumsitzen, abhängen, wie man das heutzutage nennt. Und wenn der Sommer rum ist, heißt es: auf bessere Zeiten warten, melden Sie sich bei uns, wenn Sie zu uns nach Moskau kommen.
Mich selbst nimmt manchmal eine entsetzliche seelische, geistige und physische Trägheit gefangen, ich möchte nicht den Sittlichen spielen, sondern bin schon froh, wenn ich mit meinem Fach durchkomme, aber manche Erinnerungen verärgern mich schrecklich. So schwer es mir auch wurde, wie ein Mönch zu leben, und so wenig Liebe von Frauen ich auch in meinem Leben erfahren habe, aber als Verotschka aufgetaucht war, konnte ich auch auf das bisschen, das ich hatte, verzichten, nämlich als Zerstreuung für die weiblichen Datschniki zu dienen: ein Dorflehrer der Dichtung, ein Enthusiast, das ist was für uns, wieso ist er noch nicht vergeben? Es tat mir nicht leid, mich davon zu verabschieden.