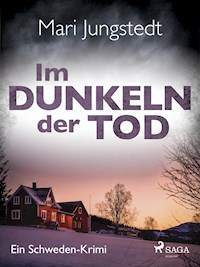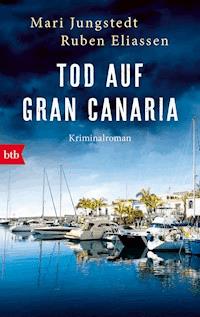Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Spektakulärer Mord auf Gotland: der zweite Fall für Kommissar Knutas! Der Fotograf Henry Dahlström wird mit eingeschlagenem Schädel in seiner Dunkelkammer gefunden. Kurze Zeit später wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst gemeldet. Besteht eine Verbindung zwischen dem Tod des Fotografen und dem plötzlichen Verschwinden des Mädchens? Kommissar Anders Knutas ermittelt mit Hochdruck und versucht gleichzeitig dem Druck der Medien standzuhalten. Als in Dahlströms Dunkelkammer Fotos des vermissten Mädchens entdeckt werden, scheint sich ein Zusammenhang abzuzeichnen. Kann es sich bei dem Fall um eine verunglückte Erpressung handeln?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Mari Jungstedt
Näher als du denkst - Ein Schweden-Krimi
Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs
Saga
Näher als du denkst - Ein Schweden-Krimi ÜbersetztGabriele Haefs Copyright ©, 2019 Mari Jungstedt und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726343052
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Für meinen Mann Cenneth Niklasson –
Geliebter, bester Freund
Sonntag, 11. November
Zum ersten Mal seit einer Woche öffnete sich die Wolkendecke. Die müden Novembersonnenstrahlen fanden einen Weg, und die Zuschauer auf der Trabrennbahn von Visby hoben ihnen sehnsüchtig die Gesichter entgegen. Es war das letzte Rennen der Saison, und Erwartung, aber auch ein Hauch Wehmut lagen in der Luft. Ein verfrorenes, doch begeistertes Publikum drängte sich auf den Bankreihen aneinander. Die Zuschauer tranken Bier und Kaffee aus Plastikbechern, aßen heiße Würstchen mit Brot und machten sich im Rennprogramm ihre Notizen.
Henry »Blitz« Dahlström zog seinen Flachmann hervor und trank einen ordentlichen Schluck Schwarzgebrannten. Er verzog angewidert das Gesicht, doch der Fusel wärmte hervorragend. Um Henry herum saß die ganze Bande auf der Tribüne: Bengan, Gunsan, Monica und Kjelle. Alle bereits mehr oder weniger angetrunken.
Die Parade hatte soeben begonnen. Die schnaubenden, schweißglänzenden Warmblüter tänzelten einer nach dem anderen vorüber, während aus den Lautsprechern Musik schallte. Die Fahrer saßen breitbeinig in ihren leichten Sulkys.
Die Ziffern, mit denen auf der schwarzen Anzeigetafel draußen auf der Bahn die Quoten angegeben wurden, tickten weiter.
Henry blätterte im Programm. Er wollte auf Ginger Star im siebten Rennen setzen. Sonst schien offenbar niemand an die erst drei Jahre alte Stute zu glauben. Henry aber hatte sie während des Sommers beobachtet und festgestellt, dass sie trotz der Tendenz, in Galopp zu verfallen, immer besser wurde.
»Hömma Blitz, hassu Pita Queen gesehn, issie nich toll?«, nuschelte Bengan und streckte die Hand nach dem Flachmann aus.
Henry trug den Spitznamen »Blitz«, weil er viele Jahre als Fotograf für die Zeitung Gotlands Tidningar tätig gewesen war, bis sein Leben ganz vom Alkohol bestimmt wurde.
»Scheiße, ja. Bei dem Trainer«, antwortete er und erhob sich, um seinen V-5-Schein abzugeben.
Die Wettschalter mit ihren halb heruntergelassenen Holzläden lagen nebeneinander. Brieftaschen kamen bereitwillig zum Vorschein, Scheine wechselten die Besitzer, und Tippzettel wurden registriert. Eine Treppe höher befand sich das Rennbahnrestaurant, in dem die Stammgäste Steaks verzehrten und Bier tranken. Bekannte Wettspezialisten pafften ihre Zigarren und diskutierten über die Tagesform der Pferde und den Stil der Fahrer.
Langsam rückte der Start näher. Der erste Fahrer grüßte die Schiedsrichter auf ihrem Turm vorschriftsmäßig mit einem Nicken. Der Ansager rief über Lautsprecher zum Start.
Nach vier V-5-Läufen hatte Henry auf seinem Tippzettel ebenso viele Richtige. Mit etwas Glück würde er die ganze Reihe füllen. Und da er außerdem auf die mit hohen Quoten belegte Ginger Star im letzten Rennen gesetzt hatte, rechnete er mit einer ansehnlichen Gewinnsumme. Wenn die Stute nur seine Erwartungen erfüllte!
Der Startschuss fiel, und Henry beobachtete Pferd und Sulky so konzentriert, wie ihm das nach acht Bieren und diversen Schwarzgebrannten überhaupt noch möglich war. Beim Klingeln nach der ersten Runde steigerte sich sein Puls. Ginger Star lief gut, sie lief verdammt gut. Mit jedem Schritt, den sie den beiden Favoriten in der Führung näher kam, wurden ihre Umrisse für Henry schärfer. Der kräftige Hals, die geblähten Nüstern und die nach vorn gelegten Ohren. Sie konnte es schaffen!
Jetzt nicht galoppieren, bloß nicht galoppieren. Er murmelte diese Worte immer wieder, wie ein Mantra. Seine Augen hingen an der jungen Stute, die sich der Spitze mit wütender Energie näherte. Einen Rivalen hatte sie bereits überholt. Da bemerkte Henry plötzlich die Kamera um seinen Hals, und ihm fiel ein, dass er doch fotografieren wollte. Er schoss einige Bilder, und seine Hand war dabei einigermaßen ruhig.
Der rote Sand der Trabrennbahn umstob die Hufe, die sich in wahnwitzigem Tempo weiterbewegten. Die Fahrer schlugen mit den Peitschen auf die Pferde ein, und im Publikum steigerte sich die Erregung. Viele hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen, einige klatschten in die Hände, andere schrien.
Ginger Star rückte auf der Außenseite vor und lag Kopf an Kopf mit dem bisher führenden Pferd. Und nun benutzte der Fahrer zum ersten Mal die Peitsche. Dahlström sprang auf und beobachtete das Pferd durch das kalte Auge der Kamera.
Als Ginger Star eine Nasenlänge vor dem absoluten Favoriten durchs Ziel schoss, seufzte das Publikum enttäuscht auf. Henry hörte verstreute Kommentare: »Was zum Teufel!« – »Das darf doch nicht wahr sein!« – »Unglaublich!« – »Einfach Wahnsinn!«
Er selbst ließ sich auf die Bank sinken.
Er hatte die V-5 geholt!
Nach dem hektischen Tag auf der Rennbahn war Ruhe eingekehrt. Nur das Streichen des Besens über den Stallboden war zu hören und die Kiefer der Pferde, die den Abendhafer zermahlten. Fanny Jansson fegte mit kurzen, rhythmischen Strichen. Ihr Körper schmerzte nach der harten Arbeit, und als sie fertig war, ließ sie sich auf den Futterkasten vor Reginas Box sinken. Das Pferd schaute von der Krippe auf. Fanny schob die Hand durch das Gitter und streichelte die weiche Nase.
Das schmächtige Mädchen mit dem dunklen Teint war mittlerweile allein im Stall. Sie hatte es abgelehnt, die anderen ins nahe gelegene Restaurant zu begleiten, um den Abschluss der Saison zu feiern. Sie konnte sich nur zu gut vorstellen, wie hoch es hergehen würde. Schlimmer noch als sonst. Sie war einige Male mitgegangen, doch es hatte ihr nicht gefallen. Manche Pferdebesitzer tranken zu viel und versuchten, mit Fanny herumzuschäkern. Sie nannten sie »Prinzessin«, legten den Arm um sie und kniffen sie heimlich in den Hintern.
Einige wurden frecher, je mehr sie tranken, kommentierten Fannys Körper, mit Worten und mit Blicken. Sie waren einfach alte Schweine.
Fanny gähnte, hatte aber auch keine Lust, ihr Rad zu nehmen und nach Hause zu fahren. Noch nicht. Ihre Mutter hatte frei, und da war die Gefahr groß, dass sie betrunken war. Wenn sie allein zu Hause war, saß sie sicher mit unzufrieden verzogenem Mund und der Weinflasche auf dem Sofa. Wie immer würde Fanny dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie den Tag mit den Pferden verbracht hatte und nicht mit ihrer Mutter. Ihre Mutter zeigte kein Verständnis dafür, dass an einem Renntag jede Menge Arbeit anfiel. Sie begriff auch nicht, dass Fanny bisweilen aus dem Haus musste. Der Stall war Fannys Rettungsring. Ohne die Pferde wäre sie untergegangen.
Sie wurde unruhig, als sie sich eine noch schlimmere Szene vorstellte: dass ihre Mutter vielleicht nicht allein zu Hause war. Wenn ihr so genannter Freund Jack bei ihr wäre, würden sie sich beide gemeinsam voll laufen lassen, und Fanny würde nicht einschlafen können.
Am nächsten Tag musste sie früh in der Schule sein, und deshalb brauchte sie ihren Schlaf. Die achte Klasse war eine Qual, die sie möglichst schnell hinter sich bringen wollte. Zu Beginn des Schuljahrs hatte sie sich alle Mühe gegeben, aber inzwischen lief es immer schlechter. Sie litt unter Konzentrationsschwierigkeiten und schwänzte recht häufig, hatte ganz einfach keine Lust auf die Schule.
Schließlich hatte sie auch so schon genug Probleme.
Montag, 12. November
Eine Speichelblase hing ihm im Mundwinkel. Bei jedem Ausatmen wurde sie größer, dann platzte sie und lief über sein Kinn aufs Kopfkissen.
Im Zimmer war es hell. Die Rollos waren hochgezogen und die Schmutzränder auf der Fensterscheibe deutlich zu sehen. Vor dem Fenster stand ein einsamer Topf mit einem längst vertrockneten Usambaraveilchen.
Henry Dahlström kam langsam zu Bewusstsein, als aufdringliches Telefonklingeln die tiefe Stille in der Wohnung durchschnitt. Es hallte zwischen den Wänden in dem verwohnten Zweizimmerappartement wider, drängte sich auf, um am Ende den Sieg über den Schlaf davonzutragen, bevor es endlich verstummte. Gedankenfetzen führten Henry unerbittlich zurück in die Wirklichkeit. Er empfand ein abstraktes Glücksgefühl, konnte sich aber nicht an dessen Ursache erinnern.
Die Kopfschmerzen schlugen zu, als er die Beine über die Bettkante schwang. Vorsichtig setzte er sich auf. Sein Blick irrte vage über das verschwommene Muster des Bettbezuges. Durst zwang Henry, aufzustehen und in die Küche zu taumeln. Der Boden schwankte. Er lehnte sich an den Türrahmen und betrachtete das Chaos.
Der Küchenschrank stand weit offen, und die Anrichte war überladen mit schmutzigen Gläsern, Tellern voller Essensreste und der Kaffeemaschine mit eingetrocknetem Kaffee in der Kanne. Irgendwer hatte einen Teller auf den Boden fallen lassen. Henry konnte zwischen den Porzellanscherben Reste von gebratenem Hering und Kartoffelpüree erkennen. Auf dem Küchentisch drängten sich Bierdosen und leere Schnapsflaschen, ein überquellender Aschenbecher und ein Stapel Wettzettel vom Rennen.
Plötzlich wusste er wieder, worüber er sich freuen konnte. Er hatte als einziger Gewinner eine V-5 geholt. Und damit eine, zumindest in seinen Augen, Schwindel erregende Summe gewonnen. Über achtzigtausend waren ihm bar ausgehändigt worden, direkt auf die Hand. Noch nie im Leben hatte er so viel Geld besessen.
Gleich darauf erkannte er, dass er keine Ahnung hatte, wo das Geld war. Die Angst, es könne verschwunden sein, ließ seinen Magen brennen. Am Vorabend war er offenbar sternhagelvoll gewesen.
So verdammt viel Geld!
Seine Blicke liefen unruhig an den halb leeren Fächern des Küchenschranks auf und ab. Er hätte doch Verstand genug haben müssen, um das Geld zu verstecken. Wenn nur niemand von den anderen ... nein, das konnte er nicht glauben. Aber wenn es um Schnaps und Geld ging, wusste man ja nie.
Er verdrängte diesen Gedanken und versuchte, sich zu erinnern, was er gemacht hatte, nachdem er am Vorabend vom Rennen nach Hause gekommen war. Wo zum Teufel ...
Aber sicher, natürlich, der Besenschrank. Mit zitternden Fingern zog Henry die Staubsaugerbeutel hervor. Als er die Geldscheine unter seinen Fingern spürte, atmete er erleichtert auf. Er ließ sich auf den Boden sinken, hielt dabei die Beutel in der Hand wie eine kostbare Porzellanvase, und gleichzeitig flimmerte ihm die Frage durch den Kopf, was er mit dem Geld anfangen sollte. Nach Gran Canaria fliegen und Cocktails trinken. Vielleicht Monica oder Bengan einladen – oder warum nicht alle beide?
Dann sah er das Bild seiner Tochter vor sich. Eigentlich müsste er ihr etwas schicken. Sie war mittlerweile erwachsen und wohnte in Malmö. Kontakt hatten sie schon lange nicht mehr.
Henry stopfte die Staubsaugerbeutel zurück in den Schrank und erhob sich. Vor seinen Augen tanzten tausend Lichtblitze.
Nun meldete sich das dringende Bedürfnis nach etwas Trinkbarem zurück. Die Bierdosen waren leer, die Schnapsflaschen auch. Er zündete eine der längeren Kippen aus dem Aschenbecher an und fluchte, als er sich die Finger verbrannte.
Dann entdeckte er unter dem Tisch eine Flasche Wodka, die noch einen ordentlichen Schluck enthielt. Den goss er sich gierig in den Rachen, und das Karussell in seinem Kopf verlangsamte sich. Er trat hinaus auf den Balkon und atmete die feuchtkalte Novemberluft ein.
Auf der Schilfmatte lag entgegen aller Erwartung eine ungeöffnete Dose Bier. Er leerte sie und fühlte sich eindeutig besser. Im Kühlschrank fand er ein Stück Wurst und einen Kochtopf mit eingetrocknetem Kartoffelpüree.
Es war Montagabend, nach sechs Uhr, und der staatliche Alkoholladen hatte geschlossen. Er musste irgendwo Schnaps auftreiben.
Er fuhr mit dem Bus in die Stadt. Der Fahrer war so nett, ihn gratis mitzunehmen, obwohl Henry sich einen Fahrschein nun doch wirklich hätte leisten können. Beim Östercentrum stieg er aus. In der Luft hing Regen, und draußen war es dunkel und ziemlich menschenleer. Die meisten Läden hatten schon geschlossen.
Auf einer der Bänke bei »Alis Grillkiosk« saß Bengan mit diesem Örjan, der neu vom Festland gekommen war. Ein unangenehmer Typ; blass, mit dunklen, nach hinten gekämmten Haaren und stechendem Blick und mit einem Bizeps, der keinen Zweifel daran ließ, wie er sich bis zu seiner kürzlich erfolgten Entlassung im Knast die Zeit vertrieben hatte. Er hatte angeblich wegen schwerer Körperverletzung gesessen. Sein Brustkorb war mit Tätowierungen bedeckt, die unter seinem verdreckten Hemdkragen hervorschauten. Henry fühlte sich in Örjans Gegenwart alles andere als wohl, und die Sache wurde auch nicht besser dadurch, dass Örjan immer seinen knurrenden Kampfhund bei sich hatte. Weiß mit roten Augen und viereckiger Schnauze. Hässlich wie die Sünde. Örjan protzte damit, dass der Hund im Stadtteil Östermalm mitten in Stockholm einen Zwergpudel totgebissen hatte. Die kackvornehme Oberklassenkuh, der die Töle gehört hatte, war durchgedreht und hatte Örjan mit ihrem Regenschirm geschlagen, schließlich war die Polizei aufgetaucht und hatte sich ihrer angenommen. Örjan war mit der Mahnung davongekommen, sich eine kräftigere Leine zuzulegen. Sogar das Fernsehen hatte von diesem Zwischenfall berichtet.
Als Henry sich näherte, stieß der Hund zu Örjans Füßen ein dumpfes Knurren aus. Bengan grüßte mit einem verwackelten Winken. Der Freund war reichlich zugedröhnt, das war schon von weitem zu sehen.
»Na, wie sieht’s aus? Noch mal einen Herzlichen, meine Fresse, scheißtoll.«
Bengan richtete seinen trüben Blick auf den Freund.
»Danke.«
Örjan zog eine Plastikflasche mit farblosem, unidentifizierbarem Inhalt hervor.
»Einen Schluck?«
»Aber sicher.«
Der Fusel roch scharf. Nach einigen tiefen Zügen zitterten Henrys Hände nicht mehr.
»Kommt doch gut, so ein Schluck, was?«
Örjan stellte diese Frage, ohne dabei zu lächeln.
»Absolut«, sagte Henry und setzte sich neben die beiden anderen auf die Bank.
»Und wie geht’s selbst?«
»Na ja, Kopf oben und Füße unten eben«, antwortete Örjan obenhin.
Bengan beugte sich zu Henry hinüber und pustete ihm ins Ohr.
»Verdammt, hömma, die ganze Kohle«, zischte er. »Dolle Kiste. Hassu denn damit vor?«
»Keine Ahnung.«
Henry schaute kurz zu Örjan hinüber, der sich eine Zigarette anzündete und in den Anblick des Stadtteils Östergravar vertieft war. Er schien nicht zugehört zu haben.
»Darüber reden wir später«, flüsterte Henry. »Und halt die Klappe, was die Kohle angeht, davon soll niemand etwas wissen. Okay?«
»Alles klar«, versprach Bengan. »Selbstverständlich, Kumpel.«
Er klopfte Henry auf die Schulter und wandte sich wieder Örjan zu.
»Schmeiß mal ’nen Schluck rüber.«
Dann riss er die Flasche an sich.
»Jetzt übertreib mal nicht, Mann. Piano.«
Typisch Örjan, dachte Henry. Der redet immer so komisch. Wieso denn Piano?
Er wollte nun nur noch den Schnaps haben und dann weg hier.
»Habt ihr was zu verkaufen?«
Örjan wühlte in einer abgenutzten Reisetasche aus Kunstleder. Schließlich zog er eine Plastikflasche voll Schwarzgebranntem heraus.
»Fünfzig Ecken. Aber du kannst vielleicht ein bisschen drauflegen?«
»Ne. Ich hab bloß einen Fuffziger.«
Henry zog den Schein hervor und packte die Flasche. Örjan wollte sie jedoch noch nicht loslassen.
»Sicher?«
»Japp.«
»Und was, wenn ich dir nicht glaube? Was, wenn ich glaube, dass du mehr hast und einfach nicht mehr blechen willst?«
»Zum Teufel, red keinen Scheiß!«
Henry riss die Flasche an sich und sprang gleichzeitig auf. Örjan grinste spöttisch.
»Kannst du nicht mal einen kleinen Spaß vertragen?«
»Ich muss jetzt los. Also, bis dann.«
Henry ging zur Bushaltestelle, ohne sich noch einmal umzusehen. Örjans Blicke bohrten sich wie Nadelstiche in seinen Rücken.
Bequem zurückgelehnt saß Henry im einzigen Sessel des Wohnzimmers. Auf dem Heimweg hatte er an dem auch abends geöffneten Kiosk eine Flasche Grape Tonic gekauft und daraus mit dem Fusel einen wohlschmeckenden Cocktail gemixt. Das Glas auf dem Tisch vor ihm war voll, die Eiswürfel klirrten. Er betrachtete die Glut der Zigarette im Halbdunkel und genoss das Alleinsein.
Dass er die Wohnung nach der Zecherei des Vorabends noch immer nicht aufgeräumt hatte, war ihm egal.
Er legte eine alte Johnny-Cash-LP auf. Die Oma von nebenan klopfte empört gegen die Wand, vermutlich, weil die Musik sie bei der gerade laufenden schwedischen Fernsehserie störte. Henry ließ sich davon nicht beirren, denn er verachtete das schwedische Spießertum einfach nur.
Schon während seiner berufstätigen Zeit hatte er jegliche Form von Routine vermieden. Als wichtigster Fotograf der Gotlands Tidningar hatte er seine Arbeitszeit weitgehend selbst festlegen können. Und als er sich dann selbstständig gemacht hatte, war sein Leben natürlich nur noch nach seinen Vorstellungen verlaufen.
In klaren Momenten dachte er, dass gerade diese Freiheit der Anfang vom Ende war. Sie hatte ihm die Möglichkeit zum Trinken geboten, und das hatte nach und nach Arbeit, Familienleben und Freizeit mit Beschlag belegt und war irgendwann wichtiger geworden als alles andere; seine Ehe ging in die Brüche, die Aufträge blieben aus, und der Kontakt zu seiner Tochter wurde immer sporadischer und schlief schließlich ganz ein. Am Ende hatte er weder Geld noch Arbeit gehabt. Und seine einzigen verbliebenen Freunde waren die alten Zechkumpane.
Henry wurde durch Lärm vom Hof aus seinen Überlegungen gerissen. Seine Hand, die gerade das Glas hob, hielt unsicher in der Bewegung inne.
War das eins von den verdammten Kindern aus der Nachbarschaft, die Fahrräder stahlen, sie anders anstrichen und dann verkauften? Sein eigenes stand draußen und war nicht abgeschlossen. Es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwer es zu stehlen versuchte.
Der Lärm hörte nicht auf. Henry schaute auf die Uhr. Viertel vor elf. Da draußen war jemand, das stand fest.
Konnte natürlich auch ein Tier sein, eine Katze vielleicht.
Er öffnete die Balkontür und schaute hinaus in die Dunkelheit. Die kleine Rasenfläche an der Hausecke leuchtete im kalten Licht der Straßenlaterne. Sein Rad lehnte wie immer an der Wand. Auf dem Gehweg verschwand zwischen den Bäumen ein Schatten. Vermutlich einfach jemand, der seinen Hund Gassi führte. Henry zog die Tür wieder zu und verriegelte sie sicherheitshalber.
Diese Unterbrechung hatte ihm die Laune verdorben. Er schaltete die Deckenlampe ein und blickte sich angewidert in der Wohnung um. Mochte sich das Elend nicht mehr ansehen, sondern schob die Füße in die Pantoffeln und ging hinunter in die Dunkelkammer im Keller, um sich den Bildern von der Rennbahn zu widmen. Er hatte einen ganzen Film auf Ginger Star verschossen, zwei Bilder in dem Moment, als sie die Ziellinie überquerte. Den Kopf vorgeschoben, die Mähne wehend, die Nase vor allen anderen. Was für ein Gefühl!
Der Hausbesitzer hatte ihm freundlicherweise einen alten Fahrradkeller überlassen, und den hatte Henry mit Kopiergerät, Wannen für Flüssigkeiten und einem Gestell zum Trocknen der Bilder ausgestattet. Das Kellerfenster war mit einer schwarzen Pappscheibe abgedunkelt.
Die einzige Lichtquelle bot eine rote Lampe an der Wand. In ihrem trüben Schein konnte er problemlos arbeiten. Er hielt sich gern in der Dunkelkammer auf. Es gefiel ihm, sich hundertprozentig in Stille und Dunkelheit auf etwas zu konzentrieren. Dieses Gefühl der Ruhe hatte er sonst nur ein einziges Mal verspürt, und zwar auf seiner Hochzeitsreise nach Israel. Dort hatten Ann-Sofie und er geschnorchelt. Als sie unter der Oberfläche des stummen Meeres dahinglitten, schienen sie sich in einer anderen Dimension aufzuhalten. Ungestört, unerreichbar für den ewigen Lärm der Umwelt. Henry hatte nur das eine Mal geschnorchelt, aber dieses Erlebnis war ihm noch immer klar in Erinnerung.
Er hatte schon eine ganze Weile gearbeitet, als leise an die Tür geklopft wurde. Instinktiv erstarrte er und horchte aufmerksam. Wer mochte das sein? Es musste doch auf Mitternacht zugehen.
Wieder wurde geklopft, drängender und länger. Er hob das Foto, an dem er gerade arbeitete, aus der Fixierflüssigkeit und hängte es zum Trocknen auf, während die Gedanken ihm durch den Kopf wirbelten. Aufmachen oder nicht?
Die Vernunft riet ihm ab. Der Besuch konnte ja etwas mit seinem Gewinn zu tun haben. Vielleicht hatte jemand es auf das Geld abgesehen. Natürlich hatte sich die Nachricht von seinem Glück bereits verbreitet. In dem Geräusch, das er von der anderen Seite der Tür her hörte, schien eine Gefahr zu liegen. Henrys Mund wurde trocken. Aber es konnte ja genauso gut Bengan sein.
»Wer ist da?«, rief er.
Die Frage blieb in der Dunkelheit hängen. Keine Antwort, nur kompakte Stille. Henry ließ sich auf den Hocker sinken, tastete nach der Schnapsflasche und trank schnell einige Schlucke. Mehrere Minuten vergingen, nichts passierte. Er saß ganz still da und wartete, ohne zu wissen, worauf.
Plötzlich hörte er ein energisches Klopfen aus der anderen Richtung, vom Fenster her. Er fuhr dermaßen zusammen, dass ihm fast die Flasche zu Boden gefallen wäre. Blitzartig wurde er nüchtern und starrte zur Pappscheibe vor dem Fenster hoch. Wagte kaum zu atmen.
Dann wurde erneut geklopft. Hart, laut. Als benutze die Person draußen nicht die Fingerknöchel, sondern irgendeinen Gegenstand. Decke und Wände in der Dunkelkammer schienen zu schrumpfen. Die Angst packte Henry an der Kehle. Hier saß er nun, gefangen wie eine Ratte, während draußen jemand offenbar mit ihm spielte. Ihm brach der Schweiß aus, und seine Därme verkrampften sich. Er musste dringend zur Toilette.
Die Schläge gingen jetzt in ein rhythmisches Pochen über, ein monotones Hämmern gegen das Kellerfenster. Niemand im Haus würde Henrys Hilferufe hören. Mitten in der Nacht, an einem normalen Werktag. Würde, wer immer dort draußen stand, das Fenster einschlagen? Doch trotzdem wäre es unmöglich, in die Dunkelkammer zu gelangen, dafür war das Fenster viel zu klein. Die Tür hatte er abgeschlossen, da war Henry sich sicher.
Schlagartig herrschte wieder Stille. Jeder Muskel in Henrys Körper war angespannt. Er horchte auf Geräusche, die es nicht gab.
Fast eine Stunde lang harrte er in dieser verkrampften Haltung aus, dann wagte er endlich, sich zu erheben. Von der hastigen Bewegung wurde ihm schwindlig, und er geriet ins Schwanken, sah in der schwarzen Nacht blitzende weiße Sterne. Er musste nun unbedingt zur Toilette, konnte sich nicht mehr beherrschen. Seine Beine trugen ihn kaum noch.
Als er die Tür öffnete, begriff er sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte.
Fanny musterte sich im Spiegel und zog den Kamm durch ihr glänzendes Haar. Ihre Augen waren dunkelbraun, ebenso wie ihre Haut. Schwedische Mutter und westindischer Vater. Mulattin, aber ohne eine Spur vom typisch afrikanischen Aussehen. Ihre Nase war klein und gerade, die Lippen schmal. Ihr rabenschwarzes Haar reichte bis zur Taille. Manchmal wurde sie für eine Inderin oder Nordafrikanerin gehalten, dann wieder wurde auf Marokko oder Algerien getippt.
Sie kam gerade aus der Dusche und trug nur eine Unterhose und ein weites T-Shirt. Sie hatte sich mit einer harten Bürste abgeschrubbt, die sie im Kaufhaus Åhlén gekauft hatte. Solche Bürsten rauten die Haut auf und ließen sie rot werden. Ihre Mutter hatte wissen wollen, warum Fanny sie angeschafft hatte.
»Um mich damit zu waschen. Dann wird man viel sauberer. Außerdem ist es gut für die Haut«, hatte Fanny geantwortet und erklärt, dass der Pferdegeruch sich sonst festsetze. Die Dusche war zu ihrer besten Freundin geworden.
Fanny drehte sich zur Seite und musterte ihren schmächtigen Körper im Profil. Ihre Schultern hingen herunter; wenn sie den Rücken geradehielt, ragten ihre Brüste hervor und waren noch deutlicher zu sehen. Deshalb hielt sie sich immer leicht gebückt. Sie war früh entwickelt. Hatte schon in der vierten Klasse einen Busen bekommen. Anfangs hatte sie sich alle Mühe gegeben, ihn zu verbergen. Weite Pullover waren eine gute Hilfe gewesen.
Am schlimmsten war es beim Sport. Trotz Sport-BH, der die Brüste flach drückte, waren sie beim Laufen und Springen doch zu sehen. Fanny fand die Veränderung ihres Körpers schrecklich. Warum entwickelte der sich so widerlich, nur weil er erwachsen wurde? Die Haare in den Achselhöhlen rasierte sie weg, sowie auch nur millimeterlange Stoppeln zu sehen waren. Aber noch viel schlimmer war ihr Unterleib. Das Blut, das jeden Monat ihre Unterhosen und die Bettwäsche besudelte, wenn sie nachts zu stark menstruierte. Sie verabscheute ihren Körper.
Zudem machte ihre Hautfarbe die Sache nicht besser. Sie wollte aussehen wie alle anderen. In ihre Klasse gingen drei Kinder mit dunklem Teint. Die beiden anderen waren Zwillinge, die immerhin einander hatten. Zwei Jungen aus Brasilien, von schwedischen Eltern adoptiert und die besten Fußballspieler der Schule. Sie galten als aggressiv und unschlagbar, denn sie sahen aus wie Real Madrids Roberto Carlos. Für sie war ihre Hautfarbe ein Pluspunkt. Fanny dagegen wollte nicht auffallen.
Sie sehnte sich danach, einer Clique anzugehören, so wie alle anderen. Leute zu haben, denen sie sich anvertrauen konnte. In der Schule achtete niemand mehr richtig auf sie. Sie ging allein dort hin und allein nach Hause zurück. Ihr war klar, dass es ihre eigene Schuld war. Als sie nach der Grundschule in die siebte Klasse gekommen waren, hatten die anderen sie manchmal eingeladen, nach dem Unterricht gemeinsam etwas zu unternehmen. Fanny lehnte immer ab. Nicht, weil sie nicht mit den anderen zusammen sein wollte, sondern, weil sie in aller Eile einkaufen und daheim so viel erledigen musste. Eine Freundin mit nach Hause zu nehmen, daran war nicht zu denken. Das Risiko, vor einer unaufgeräumten, zugeräucherten Wohnung mit heruntergelassenen Rollos zu stehen, in der nicht einmal der Frühstückstisch abgeräumt war, erschien Fanny zu groß. Sie wollte nicht auf eine deprimierte Mutter mit einer Zigarette im Mundwinkel und einem Weinglas in der Hand stoßen. Nein, danke, das wollte sie weder sich noch irgendeiner Freundin zumuten. Es würde sonst nur Gerede geben und schrecklich peinlich sein. Das brauchte Fanny nun wirklich nicht auch noch.
Deshalb blieb sie allein. Die anderen verloren schließlich die Lust, sie einzuladen, und am Ende machten sie sich nicht einmal mehr die Mühe, mit ihr zu reden. Fanny schien überhaupt nicht mehr zu existieren.
Sonntag, 18. November
Der Hagel, der auf das Blechdach seines Hauses prasselte, das einen Steinwurf vor Visbys Stadtmauer lag, weckte Kriminalhauptkommissar Anders Knutas.
Er stieg aus dem Bett und schauderte zusammen, als seine Füße den kühlen Boden berührten. Müde streckte er die Hand nach seinem Bademantel aus und zog die Rollos hoch. Überrascht starrte er aus dem Fenster, Hagel im November kam nun doch recht selten vor. Der Garten erinnerte ihn an eine Szene aus einem alten Schwarzweißfilm von Bergman. Die Bäume standen mit kahlen Ästen da, die sie traurig in den stahlgrauen Himmel streckten. Die Wolken zogen vorüber, eine bedrohlicher als die andere. Die Asphaltstraße des Wohnviertels sah feucht und kalt aus. Ein Stück weiter schob eine Frau in einem dunkelblauen Mantel einen Kinderwagen über die Straße. Sie hatte den Kopf eingezogen, um sich vor dem Wind und den scharfen Hagelkörnern zu schützen. Zwei zerzauste Spatzen drückten sich unter den Johannisbeersträuchern aneinander, deren magere Zweige ihnen aber nur wenig Schutz bieten konnten.
Warum muss man überhaupt aufstehen?, überlegte Knutas und kroch noch einmal unter die warme Decke. Line hatte ihm den Rücken zugedreht und schien noch immer zu schlafen. Er schmiegte sich an sie und küsste ihren Nacken.
Der Gedanke an ein Sonntagsfrühstück mit heißen Scones und Kaffee lockte sie endlich aus den Federn. Das Lokalradio brachte ein Wunschkonzert, und am Fenster saß die Katze und versuchte, die Regentropfen auf der anderen Seite der Fensterscheibe einzufangen. Erst viel später kamen die Kinder in die Küche getrottet, noch immer in Schlafanzug und Nachthemd. Petra und Nils waren Zwillinge und hatten kürzlich ihren zwölften Geburtstag gefeiert. Sie hatten Lines Sommersprossen und ihre roten Locken geerbt, dazu die schlaksige Gestalt ihres Vaters. Das gleiche Aussehen, aber ganz unterschiedliche Charaktere. Petra hatte die Gelassenheit ihres Vaters, sie liebte Angeln, alles, was sie unter freiem Himmel machen konnte, und Golf. Nils war von feurigem Temperament, er lachte polternd, spielte immer wieder den Clown und war versessen auf Film und Musik, genau wie Line.
Knutas warf einen Blick auf das vor dem Fenster angebrachte Thermometer. Zwei Grad über Null. Mit einer gewissen Düsterheit stellte er fest, dass sein Lieblingsmonat, der goldene Oktober, längst verstrichen war. Mit seiner scharfen, klaren Luft, dem bunten, purpurroten und ockergelben Laub an den Bäumen, dem Duft von Äpfeln und Erde. Leuchtende Vogelbeeren und der Wald voller Pfifferlinge. Blauer Himmel. Nicht zu warm und nicht zu kalt.
Jetzt war der Oktober dem grauen, nebligen November gewichen. Die Sonne ging um kurz nach sieben auf und noch vor vier wieder unter. Die Tage würden von nun an und bis Weihnachten immer kürzer werden.
Kein Wunder, dass viele um diese Jahreszeit unter Depressionen litten. Alle, die draußen zu tun hatten, versuchten, so rasch wie möglich wieder ins Warme zu kommen. Die Leute zogen in Wind und Regen die Köpfe ein und mochten sie nicht einmal heben, um einander anzusehen. Wir müssten Winterschlaf halten wie die Bären, dachte Knutas. Dieser Monat ist eine unerfreuliche Übergangsphase, mehr nicht.
Der Sommer schien lange her zu sein. Im Sommer sah die Insel ganz anders aus. Jedes Jahr fielen dann hunderttausende von Touristen in Gotland ein, die die ganz besondere Natur, die Sandstrände und die mittelalterliche Stadt Visby genießen wollten. Horden von Jugendlichen strömten in die Stadt, um in den vielen Kneipen zu feiern. Die Drogen- und Alkoholprobleme nahmen gewaltig zu.
Aber der vergangene Sommer hatte das alles noch übertroffen. Ein Serienmörder hatte die Insel terrorisiert und Feriengäste wie Einheimische in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei hatte unter starkem Druck arbeiten müssen, und die geballte Aufmerksamkeit der Medien war noch erschwerend hinzugekommen.
Am Ende hatte Knutas sich als Versager gefühlt, weil alles so gelaufen war, wie es eben gelaufen war. Er zerbrach sich den Kopf darüber, warum die Polizei die Verbindungen zwischen den Opfern nicht früher erkannt hatte und warum mehrere junge Frauen deshalb ihr Leben verlieren mussten.
Nachdem er mit seiner Familie fünf Wochen Urlaub gemacht hatte, nahm er seinen Dienst wieder auf. Doch erholt fühlte er sich nicht.
Der Herbst war ereignislos verlaufen, und das kam Knutas überaus gelegen.
Er stand inzwischen sicher schon fünf Minuten vor der Tür und drückte immer wieder auf die Klingel. So verdammt tief konnte Blitz doch wohl nicht schlafen? Jetzt nahm er den Finger überhaupt nicht mehr von dem blanken Knopf, aber aus der Wohnung war nichts zu hören.
Er bückte sich mit einer gewissen Mühe und rief durch den Briefschlitz: »Blitz! Blitz! Aufmachen, zum Teufel!«
Seufzend lehnte er sich an die Tür und steckte sich eine Zigarette an, obwohl er wusste, dass die Nachbarin darüber meckern würde, wenn sie zufällig vorbeikäme.
Es war fast eine Woche her, dass er Blitz beim Östercentrum getroffen hatte, und seither hatte der sich nicht mehr blicken lassen. Was ihm überhaupt nicht ähnlich sah. Sie hätten sich auf jeden Fall bei der Bushaltestelle oder vor dem Supermarkt über den Weg laufen müssen.
Er zog ein letztes Mal an der Zigarette und klingelte bei der Nachbarin.
»Wer ist da?«, fragte eine piepsige Stimme.
»Ich bin ein Kumpel von Blitz ... von Herrn Dahlström von nebenan. Ich hätte da mal eine Frage.«
Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet, und die Oma lugte über eine dicke Sicherheitskette.
»Was ist los?«
»Haben Sie Henry in letzter Zeit gesehen?«
»Ist etwas passiert?«
Ein neugieriges Funkeln trat in ihre Augen.
»Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich wüsste nur gern, wo er ist.«
»Ich habe seit diesem Radau am letzten Wochenende keinen Mucks mehr gehört. Da war ein grauenhafter Lärm. Ja, Sie haben sicher gezecht, wie üblich«, sagte sie schnippisch und blickte ihn anklagend an.
»Wissen Sie, ob irgendwer einen Schlüssel zu seiner Wohnung hat?«
»Der Hausmeister hat Schlüssel für alle. Er wohnt im Aufgang gegenüber. Fragen Sie ihn doch einfach. Er heißt Andersson.«
Als er mithilfe des Hausmeisters die Wohnung betreten konnte, empfing sie ein Chaos aus herausgezogenen Schubladen, Schränken, aus denen der Inhalt gerissen worden war, und umgekippten Möbeln. Papiere, Bücher, Kleidungsstücke und allerlei andere Gegenstände lagen wild durcheinander. In der Küche fanden sie Essensreste, Kippen, Schnapsflaschen und anderen Abfall auf dem Boden. Es stank nach altem Bier, kaltem Zigarettenrauch und Bratfisch. Irgendwer hatte mit Sofakissen und Bettwäsche um sich geworfen.
Die beiden Männer blieben mitten im Wohnzimmer stehen und glotzten verblüfft.
Nur stoßweise konnte der Hausmeister Andersson sagen: »Was zum Teufel ist denn hier passiert?«
Er riss die Balkontür auf und schaute hinaus.
»Da ist er auch nicht. Vielleicht ist er in seiner Dunkelkammer.«
Sie gingen die Treppe zum Keller hinunter. An der einen Seite des leeren Ganges lag eine Tür neben der anderen, beschildert mit Aufschriften wie »Waschküche«, »Kinderwagen«, »Räder«. In der Mitte befanden sich normale Kellerräume mit Türen aus Maschendraht. Ganz hinten kam eine Tür ohne Schild.
Der Gestank hätte sie fast umgeworfen. Aus der Dunkelkammer drang eine Fäule, bei der sich ihnen der Magen umdrehte.
Andersson machte Licht, und ihnen bot sich ein entsetzlicher Anblick. Auf dem Boden lag Henry Dahlström in seinem Blut. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch. Sein Hinterkopf war zertrümmert und zeigte eine offene Wunde von der Größe einer Faust. Das Blut hatte die Wände und sogar die Decke bespritzt. Dahlströms ausgestreckte Arme waren von kleinen braunen Blasen übersät. Seine Jeans wies hinten braune Flecken auf, als habe er sich in die Hose gemacht.
Andersson wich in den Gang zurück.
»Muss die Polizei anrufen«, jammerte er. »Hast du ein Handy? Ich hab meins oben vergessen.«
Als Antwort erhielt er nur ein Kopfschütteln.
»Warte so lange hier. Und lass niemanden rein.«
Der Hausmeister drehte sich um und lief die Treppen hoch.
Als er zurückkam, war Henrys Bekannter verschwunden.
Die grauen Betonblocks machten in der Novemberdunkelheit einen finsteren Eindruck. Anders Knutas und seine engste Mitarbeiterin, Kriminalkommissarin Karin Jacobsson, stiegen in der Jungmansgata im Stadtteil Gråbo aus dem Wagen.
Ein eiskalter Nordwind sorgte dafür, dass sie sehr schnell auf Henry Dahlströms Wohnhaus zuliefen. Dort hatten sich schon allerlei Neugierige versammelt. Einige unterhielten sich mit der Polizei. Die Nachbarn wurden befragt, und der Hausmeister war zur Vernehmung auf die Wache gebracht worden.
Das Haus sah heruntergekommen aus; die Lampe über der Haustür war zerbrochen, und im Treppenhaus blätterte die Farbe von den Wänden.
Sie begrüßten einen Kollegen, der ihnen den Weg zur Dunkelkammer zeigte. Als er die Kellertür öffnete, schlug ihnen ein unerträglicher Gestank entgegen. Der süßliche, widerliche Leichengeruch verriet, dass der Tote bereits in den Zustand der Verwesung übergegangen war. Karin spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Sie hatte sich bei Funden von Mordopfern schon so oft übergeben und hätte das diesmal gerne vermieden. Sie zog ein Taschentuch hervor und presste es sich auf den Mund.
Erik Sohlman, Techniker der Spurensicherung, trat in die Tür der Dunkelkammer.
»Da seid ihr ja. Das Opfer heißt Henry Dahlström. Ihr kennt ihn doch sicher, Blitz, den alten Säufer, der früher mal als Fotograf gearbeitet hat? Das hier war seine Dunkelkammer. Er hat sie offenbar noch immer benutzt.«
Sohlman nickte rückwärts zum Kellerraum hin.
»Ihm ist der Schädel eingeschlagen worden und es waren nicht wenig Schläge. Überall ist Blut. Ich muss euch warnen, es ist kein angenehmer Anblick.«
Sie blieben in der Türöffnung stehen und starrten den Leichnam an.
»Wann ist er gestorben?«
»Er liegt sicher schon ungefähr eine Woche hier, nehme ich an. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt, zwar nicht übermäßig stark, hier unten ist es ja arg kalt. Aber noch ein Tag, und es hätte im ganzen Treppenhaus gestunken.«
Sohlman strich sich die Haare aus der Stirn und seufzte.
»Ich muss wieder an die Arbeit. Es dauert noch eine Weile, ehe ihr rein könnt.«
»Wie lange denn?«
»Einige Stunden auf jeden Fall. Ich wäre froh, wenn ihr bis morgen warten könntet. Wir haben hier ungeheuer viel zu tun. Und das gilt auch für die Wohnung.«
»Na gut.«
Knutas musterte den engen Raum. Hier war wirklich jeder Zentimeter genutzt worden. Plastikwannen wetteiferten mit Chemikalien, Scheren, Wäscheklammern, Stapeln von Fotos, Schubladen und Schachteln um den Platz. In einer Ecke stand ein Kopierer.
Eine Wanne war umgekippt, und die Chemikalien hatten sich mit dem Blut vermischt.
Als sie aus dem Haus kamen, füllte Knutas seine Lunge mit der frischen Abendluft. Es war Viertel nach acht, und der Regen unter dem düsteren Himmel war in feuchten Schnee übergegangen.
Montag, 19. November
Am nächsten Morgen versammelte sich das Ermittlungsteam auf der Wache in der Norra Hansegatan. Eben erst waren eine aufwändige Renovierung abgeschlossen und der Kripo neue Räumlichkeiten zugewiesen worden. Der Besprechungsraum war hell, hatte hohe Wände und war doppelt so groß wie der alte.
Das Mobiliar war in diskretem skandinavischem Design gehalten, es handelte sich um graue und weiße Birkenmöbel. Mitten im Zimmer stand ein langer, breiter Tisch, der auf beiden Seiten Platz für zehn Personen bot. An der einen Querwand hingen eine große Tafel und eine Leinwand. Alles roch nagelneu. Die helle Farbe an den Wänden war noch kaum getrocknet.
Beide Längsseiten des Raumes waren verglast. Die eine Fensterreihe blickte auf die Straße, den Parkplatz beim Supermarkt und die östliche Seite der Stadtmauer. Hinter der Mauer war das Meer zu erkennen. Die andere Fensterreihe zeigte auf den Flur, sodass man sehen konnte, wer draußen vorbeiging. Dünne Baumwollvorhänge konnten zugezogen werden, wenn mehr Intimität gewünscht wurde – die alten gelben waren durch weiße mit dezentem Muster ersetzt worden.
Knutas kam ungewöhnlicherweise einige Minuten zu spät zu dieser Besprechung. Ein angeregtes Gemurmel empfing ihn, als er mit einem Kaffeebecher in der einen und einem Ordner mit Papieren in der anderen Hand den Raum betrat.
Es war schon nach acht, und alle hatten sich eingefunden. Knutas streifte seine Jacke ab, hängte sie über den Stuhlrücken, ließ sich wie immer an der Querseite des Tisches nieder und trank einen Schluck von dem bitteren Automatenkaffee. Musterte die Kollegen, die noch immer miteinander ins Gespräch vertieft waren.
Rechts von ihm saß Karin Jacobsson: siebenunddreißig Jahre alt, klein von Wuchs, dunkelhaarig und braunäugig. Bei der Arbeit war sie hartnäckig und furchtlos und konnte wütend werden wie ein Terrier. Sie war offen und redselig, über ihr Privatleben jedoch wusste er nicht viel, obwohl sie nun schon seit fünfzehn Jahren zusammenarbeiteten. Sie lebte allein und war kinderlos. Knutas wusste nicht, ob sie einen Freund hatte.
Den ganzen Herbst hatte er ohne sie zurechtkommen müssen, und sie hatte ihm entsetzlich gefehlt. Im Zusammenhang mit der Mordserie des Sommers hatte Karin Jacobsson eine Untersuchung wegen eventueller Dienstvergehen über sich ergehen lassen müssen. Die Untersuchung war eingestellt worden, aber das Ganze hatte Karin doch arg zu schaffen gemacht. Sie war während des laufenden Verfahrens vom Dienst suspendiert gewesen und im Anschluss daran in Urlaub gegangen. Was sie in dieser Zeit unternommen hatte, wusste Knutas nicht.
Jetzt war sie in eine leise Unterhaltung mit Kriminalkommissar Thomas Wittberg vertieft. Der sah eher aus wie ein Surfer als wie ein Polizist, mit seinem blonden Schopf und seinem durchtrainierten Körper. Ein Partylöwe von siebenundzwanzig mit hohem Frauenverschleiß, der seine Arbeit jedoch tadellos verrichtete. Seine Begabung, was zwischenmenschlichen Kontakt anging, war ihm immer wieder nützlich – als Vernehmungsleiter war er großartig.
Lars Norrby auf der anderen Seite des Tisches war Wittbergs genauer Gegensatz. Groß, dunkel und sorgfältig, an der Grenze zur Pedanterie. Knutas fühlte sich bisweilen von Norrbys Art, aus allem ein Problem zu machen, an den Rand des Wahnsinns getrieben. Sie hatten gleichzeitig bei der Polizei angefangen und waren vor langer Zeit zusammen auf Streife gegangen. Jetzt gingen sie auf die fünfzig zu und kannten die kriminelle Szene auf Gotland ebenso gut wie einander.
Kriminalkommissar Norrby war außerdem Pressesprecher der Polizei und stellvertretender Chef der Kriminalpolizei, eine Lösung, mit der Knutas nicht immer ganz zufrieden war. Der Techniker des Teams, Erik Sohlman, war intensiv, temperamentvoll und eifrig wie ein Spürhund, zugleich aber auch ungeheuer systematisch.
Am Tisch saß schließlich noch Gotlands Oberstaatsanwalt, Birger Smittenberg. Er kam ursprünglich aus Stockholm, war aber schon lange mit einer Gotländerin verheiratet. Knutas wusste Smittenbergs Fähigkeiten und sein Engagement sehr zu schätzen.
Knutas eröffnete die Besprechung:
»Bei dem Opfer handelt es sich um Henry Dahlström, genannt Blitz, geboren 1943. Er wurde gestern Abend um sechs in einem Kellerraum, den er als Dunkelkammer nutzte, tot aufgefunden. Wenn jemand das noch nicht wissen sollte, es handelt sich um den heruntergekommenen Trinker, der früher mal Fotograf war. Er trieb sich meistens unten in Öster herum, und sein besonderes Kennzeichen war die Kamera, die er immer um den Hals trug.«
Am Tisch herrschte tiefes Schweigen, und alle hörten aufmerksam zu.
»Dahlström wurde mit zahlreichen Verletzungen am Hinterkopf aufgefunden. Wir haben es hier eindeutig mit einem Mord zu tun. Sein Leichnam wird heute zur Gerichtsmedizin nach Solna gebracht.«
»Habt ihr die Mordwaffe gefunden?«, fragte Lars Norrby.
»Noch nicht. Wir haben Dunkelkammer und Wohnung durchsucht. Beide wurden auch abgesperrt. Weitere Absperrungen wären sinnlos, da der Leichnam eine Woche unten gelegen hat und Gott weiß wie viele Menschen in dieser Zeit im Treppenhaus unterwegs waren. Dahlström wohnte im Erdgeschoss in einer Eckwohnung. Genau neben dem Fußweg nach Terra Nova. Wir werden die gesamte Umgebung durchkämmen. Die Dunkelheit hat diese Arbeit erschwert, aber sowie es hell wurde, ist die Suche wieder aufgenommen worden. Tja, aber das ist ja noch nicht lange her.«
Er schaute auf die Uhr.
»Wer hat uns verständigt?«, fragte der Oberstaatsanwalt.
»Der Leichnam wurde von einem der vier Hausmeister entdeckt. Dieser hier wohnt im Aufgang gegenüber von Dahlström. Ove Andersson heißt er. Er berichtet, dass gestern Abend gegen sechs ein Mann, der sich als guter Freund des Opfers ausgab, an seiner Tür geschellt hat. Der Mann sagte, er habe Dahlström seit einigen Tagen nicht mehr gesehen und mache sich langsam Sorgen um ihn. Wie wir wissen, haben sie Dahlström dann im Keller gefunden. Aber als der Hausmeister in seine Wohnung ging, um die Polizei zu verständigen, ist der Freund verschwunden.«
»Vielleicht handelt es sich bei ihm ja um den Mörder«, schlug Wittberg vor.
»Warum sollte er dann den Hausmeister alarmieren?«, hielt Norrby dagegen.
»Er wollte vielleicht in die Wohnung, um etwas zu holen, was er dort vergessen hatte, wagte aber nicht, einzubrechen«, meinte Karin.
»Na ja, ausgeschlossen ist das sicher nicht, aber es hört sich doch ziemlich unwahrscheinlich an«, sagte Norrby. »Warum hätte er eine ganze Woche warten sollen? Das Risiko, dass der Leichnam entdeckt würde, bestand doch die ganze Zeit.«
Knutas runzelte die Stirn.
»Eine Alternative wäre, dass er verschwunden ist, weil er Angst hatte, in Verdacht zu geraten. Er war vielleicht mit auf dem Fest, denn in der Wohnung ist gefeiert worden, das ist ganz klar. Aber egal, wir müssen ihn so bald wie möglich ausfindig machen.«
»Wie sah er aus?«, fragte Wittberg.
Knutas schaute in seine Papiere.
»Mittleres Alter, um die fünfzig, meint der Hausmeister. Groß und kräftig. Schnurrbart, dunkles Haar, zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Dunkler Pullover, dunkle Hose. Auf die Schuhe hat der Hausmeister nicht geachtet. Ich finde, das hört sich an wie Bengt Johnsson. Der ist wohl der einzige von den Parksäufern, auf den diese Beschreibung zutrifft.«
»Ja, das muss Bengan sein. Die beiden waren doch unzertrennlich«, sagte Wittberg.
Knutas wandte sich dem Techniker zu.
»Erik, du kannst die technischen Details übernehmen.«
Sohlman nickte und begann mit seinen Ausführungen.
»Wir haben Wohnung und Dunkelkammer untersucht, sind aber noch längst nicht fertig damit. Wenn wir mit dem Opfer und den Verletzungen anfangen wollen, dann müssen wir uns jetzt Bilder ansehen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass die ziemlich scheußlich sind.«
Sohlman löschte das Licht und warf per Beamer die digitalen Bilder auf die Leinwand.
»Henry Dahlström lag ausgestreckt auf dem Boden, und er hatte umfassende Schlagwunden am Hinterkopf. Der Täter muss einen stumpfen Gegenstand verwendet haben. Ich tippe auf einen Hammer, aber das wird uns die Gerichtsmedizin demnächst genauer sagen können. Er wurde mehrere Male auf den Kopf geschlagen. Die vielen Blutspritzer rühren daher, dass der Täter ihm zuerst den Schädel eingeschlagen und dann die blutige Oberfläche weiter bearbeitet hat. Bei erneutem Ausholen mit der Waffe verspritzte jedes Mal Blut.«
Sohlman griff zu einem Zeigestock, um auf die Blutspritzer auf Boden, Wänden und Decke hinzuweisen.
»Vermutlich hat der Täter Dahlström niedergeschlagen und sich dann über ihn gebeugt und weiter gemacht, als er bereits am Boden lag. Was den Zeitpunkt des Todes angeht, so nehme ich an, dass der Mord von heute an gerechnet vor sechs oder sieben Tagen geschehen ist.« Sohlmann schaute in die Runde.
»Das Gesicht des Opfers war gelbgrau und spielte ins Grünliche. Die Augen waren von dunklem Braunrot und die Lippen schwarz und eingetrocknet. Der Verwesungsprozess hatte bereits eingesetzt«, fügte Sohlman ungerührt hinzu. »Ihr seht hier die kleinen braunen Blasen am Körper, aus denen bereits Leichenflüssigkeit austritt. Die sickert jetzt auch aus Mund und Nase.«
Die Kollegen am Tisch verzogen angewidert das Gesicht. Karin fragte sich, warum es Sohlman immer schaffte, über blutige Opfer, Leichenstarre und verwesende Körper zu reden wie über Wind und Wetter oder die letzte Steuererklärung.
»Alle Möbel sind umgeworfen, Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Der Mörder hat offenbar irgendetwas gesucht. Das Opfer weist auch Abwehrverletzungen an den Unterarmen auf. Hier seht ihr Blutergüsse und Kratzer. Dahlström hat also versucht, Widerstand zu leisten. Der Bluterguss am Schlüsselbein kann durch einen verfehlten Schlag verursacht worden sein. Wir haben Proben genommen, von Blut, Haaren und einer im Flur gefundenen Kippe, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vom Opfer stammt. Alles wird nach Linköping geschickt, aber es kann natürlich dauern, bis wir Antwort erhalten.«
Er trank einen Schluck Kaffee und seufzte.
Die Antwort vom SKL, dem Staatlichen Kriminaltechnischen Labor in Linköping, traf frühestens nach einer Woche ein, meistens dauerte es drei.
Sohlman schaute auf die Uhr und redete weiter: