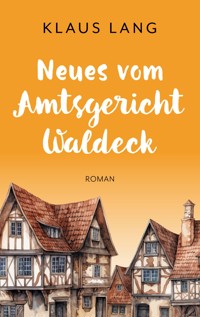
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Gerd ist von Beruf Richter, sowohl im Privatleben als auch im Dienst klebt ihm das Pech an den Füßen. Hiervon frustriert lässt er sich schließlich aus der Großstadt an ein kleines Amtsgericht versetzen. Anstatt gemächlich in den Ruhestand zu gleiten, trifft er in der Provinz auf die Liebe seines Lebens. Zudem wird er mit ungewöhnlichen zivilrechtlichen Streitigkeiten konfrontiert. Diese kurios anmutenden Gerichtsverfahren beruhen auf wahren Begebenheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Das Amtsgericht Waldeck ist Fiktion. Die Stadt Waldeck beherbergte zu keiner Zeit ein Gericht. Der Historie ist zu entnehmen, dass vor Ort Scharfrichter zur Vollstreckung von Todes- und Leibesstrafen ansässig waren. Zudem wurde ab dem 18. Jahrhundert ein Zucht- und Arbeitshaus unterhalten. Wer unter den Zwangsmaßnahmen zu leiden hatte, wurde indessen andernorts bestimmt.
Mein Buch ist auch kein autobiographischer Roman. Ich erzähle von der schiefgelaufen Karriere eines Prädikatsjuristen, der letztlich seinen Weg zum Glück findet. Hierbei muss er sich von lieb gewordenen Gewohnheiten trennen und sich mit ungewöhnlichen zivilrechtlichen Angelegenheiten befassen. Jede dieser Episoden hat aber einen authentischen Kern, der Gegenstand eines von mir verhandelten Rechtsstreites war. Jedoch entspringen alle in diesem Buch agierenden Protagonisten sowie deren Milieu meiner Phantasie. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
Die Kontrahenten in einem Zivilrechtsstreit werden Prozessparteien genannt. Um deren vollständige Anonymisierung sicherzustellen, habe ich mich dazu entschlossen, diese Personen nur mit von mir frei gewählten, kursiv gedruckten Vornamen zu bezeichnen. Die Parteien, die von ihrem Gegner etwas verlangen, nennen wir Kläger, so dass deren Rufnamen generell mit dem Buchstaben ›K‹ beginnen. Die Personen gegen die Klage erhoben wird, heißen vor dem Zivilgericht Beklagte. Deren Vornamen haben dementsprechend am Anfang ein ›B‹.
Inhalt
1. Kapitel Die Stadt und das Gericht
2. Kapitel Der Waldecker Landbote
3. Kapitel Der Landgasthof Stein
4. Kapitel Der Amtsrichter
5. Kapitel Die Amtseinführung
6. Kapitel Die ersten Tage
7. Kapitel Forever
8. Kapitel Kopf an Kopf
9. Kapitel Schlachtfest
10. Kapitel Die Blutgrätsche
11. Kapitel Der Knall
12. Kapitel Hundeübungsplatz
13. Kapitel Tischtennis
14. Kapitel Sonnenanbeter
15. Kapitel Hektor
16. Kapitel FKK
17. Kapitel Der Mops
18. Kapitel Der Hai
19. Kapitel Kirmes
20. Kapitel Schwestern
21. Kapitel 600 PS
1. Kapitel
Die Stadt und das Gericht
Die Geschichte der Stadt Waldeck ist eng mit derjenigen der Burg mit gleichem Namen verbunden, deren Ursprünge bis heute noch nicht vollständig erforscht sind. Fest steht, dass dieses Felsennest, das sich im Nordwesten des heutigen Bundeslandes Hessens befindet, durch Heirat in den Besitz eines Grafen von Schmalenberg geriet, dessen Linie sich ab dem Jahre 1228 ›von Waldeck‹ nannte. Über viele Jahre hinweg war Waldeck der Mittelpunkt dieser selbstständigen Grafschaft.
Wissenswert ist, dass die Grafschaft im Jahre 1712 zum Fürstenturm Waldeck und Pyrmont mit der neuen Resistenzstadt Arolsen emporstieg, das Hofgericht allerdings in Waldeck verblieb. Diese über Jahrhunderte bestehende Eigenständigkeit einer Waldecker Justiz führte letztlich dazu, dass man auch im heutigen Bundesland Hessen nicht umhinkonnte, Waldeck weiterhin als Gerichtsort zu belassen, indem in diesem Städtchen das kleinste Amtsgericht Deutschlands eingerichtet wurde. Von nur einem Richter sind dort die allgemeinen Zivilsachen zu verhandeln, die in dem heutigen Altkreis Waldeck ihren Ursprung gefunden hatten. Gemeinhin handelte es sich damit um eine relativ stressarme richterliche Tätigkeit, sodass es nach der Pensionierung eines amtierenden Amtsrichters nie an neuen Interessenten mangelte, die um einen Wechsel nach Waldeck ersuchten. Die jeweiligen Stellenanwärter befanden sich meist in einer freudlosen Dienstposition, die jedem Staatsbediensteten unter dem Namen ›EDEKA‹ bekannt ist (Ende der dienstlichen Karriere). Sie kamen an den Edersee mit dem Ziel – gleich den dort treibenden Segelschiffen – auf einer ruhigen Position in den Ruhestand zu gleiten. Denn man ist als Richter in Waldeck allein geographisch gesehen an dem höchsten Gericht Hessens tätig. Folglich geht mit der Versetzung kein Anstieg der Besoldung einher. Aber es eröffnen sich weitaus mehr zeitliche Freiräume als andernorts, verbunden mit der Möglichkeit, Tag für Tag einen fantastischen Ausblick auf den Edersee zu genießen.
Das Gerichtsgebäude ist unweit des Ensembles der noch gut erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkgebäude in einem am Marktplatz gelegenen Haus untergebracht. Es handelt um ein relativ neues Bauwerk, dessen erster Stock von archetektonisch fremdartig anmutenden sechseckigen Säulen gestützt wird, so dass an der Gebäudefront ein einseitig offener Bogengang entstand. Innerhalb dieser Arkade befindet sich der Eingangsbereich des Amtsgerichts. Ebenso wird von dort aus – nur eine Tür nebenan – die im ersten Stock befindliche Redaktion des Waldecker Landboten betreten.
Der Gebäudeteil, der das Gericht beherbergt, ist das Parterre. Als Gerichtssaal dient das im Gelsenkirchner Barock eingerichtete Büro des Amtsrichters. Bis Anfang März 2010 amtierte dort Amtsrichter Carl Schmidt. Just in dem Moment, als dieser an seinem schweren Schreibtisch aus massiver Eiche Recht sprechen wollte, verstarb er unvorhergesehen an einem Schlaganfall. Böse Zungen behaupteten, seine Mitgliedschaft im örtlichen ›Bourbon Club‹ sei die Ursache seines vorschnellen Ablebens gewesen.
Da das Justizministerium mit raschem Ersatz rechnete, wurde vom Landgericht Kassel lediglich für zwei Wochen eine Proberichterin nach Waldeck abgeordnet, deren einzige Aufgabe darin bestand, die bereits terminierten Sachen zu verlegen und – soweit ihr zeitlich möglich – neue Eingänge auf den Terminplan zu setzen. Etwaige Eilfälle sollten – wie an Wochenenden und Feiertagen ohnehin vorgesehen – in der Zeit der Vakanz von dem Amtsgericht Korbach bearbeitet werden.
Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs blieb nach wie vor Frau Sabine Blume verantwortlich. Sie ist Rechtspflegerin und übt in dieser Funktion in Waldeck die formale Geschäftsleitung aus. Es handelt sich um eine sehr attraktive vollschlanke Frau Anfang 40, die ihr schulterlanges strohblondes Haar meist als Pferdschwanz trägt. Ihre Stupsnase, auf der sich in der warmen Jahreszeit die von ihr ungeliebten Sommersprossen bilden, wird von zwei leuchtend blaugrünen Augen flankiert. Als Geschäftsleiterin obliegt ihr die bürokratisch korrekte Abwicklung aller nichtrichterlichen Tätigkeiten zu überwachen bzw. selbst sicherzustellen. Insofern hat sie in Person die Eintreibung und Abrechnung der Gerichtskosten, sowie die exakte Festsetzung der Rechtsanwaltskosten zu gewährleisten. Aufgrund des Formats des Gerichts handelt es sich nur um eine mit 50 % der Arbeitskraft zu besetzende Stelle. Gerade dies, verbunden mit der räumlichen Nähe zu ihrer Wohnung im Waldecker Stadtteil Netze, hat die alleinerziehende Mutter eines mit nunmehr 15 Jahren immer noch pubertierenden Sohnes dazu bewogen, diese Anstellung anzutreten. Hier hat sie nicht nur die von ihr benötigte Freizeit, sondern kann in Fragen der Kindesbetreuung auch auf die tatkräftige Unterstützung ihrer noch sehr rüstigen Eltern bauen.
2. Kapitel
Der Waldecker Landbote
Der Waldecker Landbote ist keine Zeitung im herkömmlichen Sinn. Es handelt sich vielmehr um ein Wochenblatt mit einem eher geringen redaktionellen Teil. Der überwiegende Inhalt besteht aus Vereinsmeldungen, kirchlichen Nachrichten, Veranstaltungshinweisen und Anzeigen aller Art. Beigefügt wird jeder Ausgabe das Amtsblatt der Stadt Waldeck sowie zahlreiche Werbeprospekte, so dass sich die Finanzierung des Landboten problemlos gestaltet. Dementsprechend kann die Gazette jedem im Stadtgebiet befindlichen Haushalt gratis zugestellt werden und gestattet ihrem Herausgeber einen auskömmlichen Lebensstandard. Verleger in Dritter Generation und einzig fest angestellter Redakteur ist Herr Walter Kleemann, ein kleiner Mann mittleren Alters, der zur Kaschierung seiner Glatze stets einen schwarzen Borsalino Hut trägt. Udo Lindenberg lässt grüßen! Neben der Erstellung des Layouts fließen aus Walters Feder vor allem Beiträge aus dem Lokalsport in den redaktionellen Teil ein. Weitere Artikel werden von diversen freien Mitarbeitern beigesteuert.
Einer von diesen ist Friedrich Maurer, ein – trotz einer Körpergröße von über 1,90 m – infolge seines schütteren Haars und blässlich grauen Teints, eher unscheinbar wirkender Junggeselle. In erster Linie ist er als Justizangestellter beschäftigt. Seit langer Zeit hat er bei dem Amtsgericht Waldeck die Funktion des Geschäftsstellenbeamten. Er fungiert gewissermaßen als Sekretär des Amtsrichters. Ferner ist er für die Aufbewahrung und die Pflege der Akten zuständig und hat bei Bedarf anlässlich von Gerichtsverhandlungen das Protokoll zu führen. Aufgrund einer nahezu unmerklichen Behinderung im Bereich der Lendenwirbelsäule und der tatkräftigen Hilfestellung seines Hausarztes ist es Friedrich Maurer bereits vor einigen Jahren gelungen, bei vollem Lohnausgleich dienstlich nur 50 % seiner Arbeitskraft einbringen zu müssen. Obwohl also kein Freund von Arbeit, lässt er zur Aufbesserung seiner von ihm als zu karg empfundenen Besoldung unter der allseits beliebten Rubrik ›Neues vom Amtsgericht Waldeck‹ in unregelmäßigen Abständen Herrn Kleemann Gerichtsreportagen zukommen. Maurer weiß aufgrund seiner Tätigkeiten relativ genau, welche der neu eingehenden Fälle die Öffentlichkeit interessieren könnten. Unter diesem Aspekt beachtet er exakter als bei Geschäftsstellenbeamten Usus den Inhalt der eingereichten Klageschriften. Kommen die von ihm für interessant gehaltenen Rechtsstreite zur Verhandlung, ist er stets bemüht, als Protokollführer eingesetzt zu werden. Anfangs hatte er sich, noch bevor ein verkündetes Urteil schriftlich niedergelegt worden ist, in der Lage gesehen, die Öffentlichkeit allein anhand seiner Mitschriften zu informieren. Nachdem er auf diese Weise das eine oder andere Mal nicht ins Schwarze getroffen hatte, wartete er lieber darauf, bis das Urteil von einem Richter der Geschäftsstelle übergegeben wurde. Im Tatsächlichen ausgeschmückt, juristisch simplifiziert und mit einer knackigen Überschrift versehen fabrizierte er aus dem Urteilstatbestand und den Entscheidungsgründen seine Zeitungsartikel.
Bereits Anfang April stand fest, dass zum 3. Mai in Waldeck ein neuer Richter ernannt werden wird. Nachdem Maurer aus erster Hand von dieser erfreulichen Nachricht erfahren hatte, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als durch die Tür nebenan Kleemann zu besuchen, um diesen von der Neuigkeit ins Bild zu setzen. Es war ein kalter Tag. Zudem regnete es in Strömen. Gut, dass man unter den Arkaden wenigstens trockenen Fußes in die Räume des Landboten gelangen konnte.
Kleemann saß an seinem Schreibtisch und telefonierte. Er deutete Maurer an, gegenüber Platz zu nehmen. Dieser verfolgte sodann die soeben stattfindende Aufnahme einer Todesanzeige. Wie immer sollte die Anzeige so repräsentativ und gleichzeitig auch so billig wie möglich sein. Nach einigem Hin und Her wurde man sich handelseinig.
Kleemann bot Maurer eine Zigarette an, die dieser als passionierter Kettenraucher sehr gerne entgegennahm. Da er schon seit langer Zeit mit Maurer per Du war fragte er diesen: »Na Fritz, was führt dich hierher? Wolltest du nur im Warmen eine rauchen?« Maurer, der das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden abgrundtief hasste, entgegnete: »Bei dem Sauwetter ist es in der Tat nicht schön draußen zu smoken, aber ich habe etwas zu berichten.« »Wie das? Ohne Richter ist ja bei euch in letzter Zeit nichts los!« »Jetzt schon!«, sagte Fritz, »Zum 3. Mai bekommen wir einen neuen Amtsrichter, soweit ich weiß, soll es sich dabei um einen ›harten Hund‹ handeln, der sich vom Landgericht Frankfurt hierher versetzen lässt. Er soll ›Rhein‹ oder so ähnlich heißen. Sobald ich den genauen Familiennamen herausbekommen habe, rufe ich dich an.« »Sehr schön«, sagte Walter, »wenn du den Namen des Neuen konkret weißt, haben wir einen Aufmacher für den nächsten Landboten!«
Der neue Richter hatte den Namen ›Dr. jur. Gerd Bein‹.
3. Kapitel
Der Landgasthof Stein
Der Waldecker Stadtteil Sachsenhausen wird vom Tourismus kaum behelligt. Dort hat aber die Stadtverwaltung von Waldeck ihren Sitz. Neben den im ausreichendem Umfang vorhandenen Geschäften für den täglichen Bedarf gibt es etwa eine Hand voll Gaststätten, die in der Regel jedoch nur von der einheimischen Bevölkerung frequentiert werden. Als Nordhesse bleibt man ohnehin gerne unter sich. Besonders beliebt ist der Landgasthof Stein, weil die Familie Stein im gleichen Hause eine Metzgerei betreibt. Die von den Ortsansässigen besonders geschätzten großen Portionen Hausmannskost sind damit garantiert.
Jeden letzten Freitag eines Monats (Punkt 19:00 Uhr ist vereinbart, was aber zeitlich so gut wie nie gelingt) treffen sich bei den Steins diejenigen Rechtsanwälte, die den Löwenanteil der Rechtsstreite betreuen, die vor dem Amtsgericht Waldeck verhandelt werden. Dies liegt nicht unbedingt an einer besonderen fachlichen Qualität, sondern vor allem an der Abgeschiedenheit des Gerichtsortes sowie der Höhe der Streitwerte, den die in Waldeck anhängigen Verfahren haben. Dazu muss man wissen, dass Zivilprozesse, Ausnahmen bestätigen diese Regel, deren Streitwert den Betrag von 5.000,00 € übersteigen, vor einem Landgericht zu verhandeln sind. Mithin ist es für Anwälte aus der Ferne kaum lukrativ, über kurvige Landstraßen an den Edersee zu reisen, ist doch die Stattlichkeit des Anwaltshonorars mit der Höhe des Streitwertes verknüpft.
Zum Anwaltsstammtisch gehören – quasi als Gründungsmitglieder – die Rechtsanwälte Dirk Schlau und Horst Fröhlich. Es handelt sich um zwei alte Hasen, die seit längerem die 50 überschritten haben. Wüsste man es nicht besser, könnte man die beiden glatt für Brüder halten. Abgesehen von der Haarfarbe, bei Dirk ist noch eine Spur von dunkelbraun vorhanden, während man bei Horst noch erahnen kann, dass er früher mal hellblond gewesen sein muss, haben sich die Herren mit den Jahren in Figur, Gestik und Mimik wechselseitig angepasst. Sie hatten sich in ihrer Studienzeit an der Universität Gießen kennengelernt. Nach dem Absolvieren des ersten Staatsexamens und dem Referendariat entschlossen sie sich in Heimatnähe, dem Waldecker Land, eine Sozietät aufzubauen. Ihre Wahl fiel dabei auf den Stadtteil Sachsenhausen.
Aktuell gehören ferner Rechtsanwalt Michael Kernig sowie die mit diesem in einer Bürogemeinschaft tätige Rechtsanwältin Marion Keck zum monatlichen Anwaltsstammtisch im Landgasthof Stein. Das Anwaltsbüro ›K&K‹ hat seinen Sitz in der etwa 10 Kilometer von Sachsenhausen entfernten Gemeinde Vöhl. Beide Anwälte von ›K&K‹ sind Anfang 40 und nach dem Abschluss des zweiten Staatsexamens, anstelle ihrer Väter, nicht nur in deren ehemalige Bürogemeinschaft eingetreten, sondern haben gleichzeitig auch deren Plätze am Anwaltsstammtisch eingenommen. Die geschiedene Marion ist eine schwarz gefärbte Grazie, die auch an weiteren Körperstellen der Natur mittels Silikon und anderen Mittelchen nachgeholfen hat. Sie ereifert sich, in Aussehen und Kleidung ihrem stilistischen Vorbild, der amerikanischen Schauspielerin Demi Moore, anzunähern. Sie und Michael Kernig, ein stets gebräunter dunkelblonder Mann mit einem ungewollten Hang zu einem Bauchansatz, der sich ebenfalls neuen Trends gegenüber aufgeschlossen zeigt, wirken auf den ersten Blick wie ein ideales Paar, sind aber wegen dessen bisher nicht publik gemachter Homosexualität meilenweit hiervon entfernt. Marion hat Michael zwar schon häufiger zu einem Comingout ermutigt. Weil er einen Rückgang an Mandaten befürchtete, hatte dieser aber stets abgewunken. Schließlich sei man in der Provinz und nicht in einer größeren Stadt niedergelassen.
Das monatliche Anwaltstreffen im Landasthof dient den vier Berufsträgern weniger zu einem beruflichen Erfahrungsaustausch. Verbunden mit einem gemeinsamen Abendessen geht es den Kollegen vor allen Dingen darum, gemeinsam Doppelkopf zu spielen. Doppelkopf ist ein unter Juristen sehr populäres Gesellschaftsspiel, das man in der Regel spätestens in der Cafeteria einer Universität erlernt, so man denn Interesse am Spielen hat. Es handelt sich um ein Kartenspiel, an dem vier Personen teilnehmen. Ein Blatt besteht aus 48 Karten. Von den Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo sind jeweils 12 Karten vorhanden. Jede der Spielkarten (9, 10, Bube, Dame, König und As) gibt es zweimal. Der Clou des Spiels liegt unter anderem darin, dass (ausgenommen es wird ein Solo angesagt) jeweils zwei der Teilnehmer zusammen gegen die anderen beiden spielen, sich aber erst im Verlaufe einer Runde durch den jeweiligen Besitz der Kreuzdamen aufklärt, wer Freund und wer Feind ist. Gewonnen hat die Partei, die 121 Punkte erlangt hat.
Am Freitag dem 30.4.2010 saßen ›K&K‹ bereits seit über 15 Minuten auf ihren angestammten Plätzen. Dirk Schlau und Horst Fröhlich fehlten. Marion sagte daraufhin zu Michael: »Das ist ja wieder mal typisch, obwohl die beiden nur 5 Minuten Fußweg haben, sind sie wieder mal nicht in der Lage, wenigstens das akademische Viertel einzuhalten. Ich schlage vor, die erste Runde geht auf sie.« Michael nickte zustimmend.
Wie aufs Stichwort betraten Dirk und Horst den Gastraum. Horst rief ihnen schon von weitem zu: »Ja, ich weiß, wir sind zu spät! Ja, ich weiß, die erste Runde geht auf uns.« Dirk bat indessen die Kellnerin um die Speisekarten und fragte in die Runde: »Habt ihr schon bestellt? Kommt ihr alle zur Amtseinführung von dem Dr. Bein? Kennt den jemand persönlich?«
Marion antwortete kurz: »Nein, Ja, Jein.«
»Ich bitte doch um etwas mehr Präzision Frau Kollegin‹ sagte Dirk scherzhaft. Marion entgegnete: »Da kommt die Kellnerin, wir geben erst unsere Bestellungen auf und während wir auf das Essen warten erkläre ich euch, was ich genau meine.« Bis auf Michael, der wieder mal – wahrscheinlich erneut erfolglos – abnehmen wollte und deshalb lediglich einen Salat mit Putenbruststreifen auswählte, entschlossen sich die Übrigen die Spezialität des Hauses zu ordern: Das Rumpsteak Willi (300 g) mit Pommes Frites und Salat.
Marion sprach zur Runde: »Nachdem nun bestellt worden ist, muss ich euch ja nur noch erklären, was das ›Jein‹ vorhin bedeuten sollte. Ich kenne den neuen Richter nicht persönlich, habe aber vor ein paar Tagen mit meinem Ex telefoniert.« Sie kommunizierte, dass sie von ihrem geschiedenen Mann, seines Zeichens Vorsitzender Richter am Landgericht Gießen, erfahren hatte, dass Dr. Bein ein netter Kollege sei, der aber mit der Justizverwaltung diverse Schwierigkeiten gehabt habe, mit dem Ergebnis, dass alle seine Bewerbungen, zum Vorsitzenden Richter am Landgericht befördert zu werden, erfolglos gewesen seien.
»Besteht denn eine persönliche Bekanntschaft zu deinem Geschiedenen?« fragte Dirk. »Nein«, antwortete Marion, das gerade nicht. Er meinte, er habe Dr. Bein mal auf einer Richtertagung zum Thema ›Referendarausbildung‹ getroffen, er sei sich nach so langer Zeit aber nicht ganz sicher. Im Übrigen habe er seine Informationen aus dem üblichen Tratsch, den es nicht nur unter uns Anwälten, sondern auch unter den Richtern gibt.«
Nach dem Essen, bei dem am Rande doch noch diverse Rechtsfragen andiskutiert wurden, bestellte Horst die versprochene erste Runde. Unisono wurde ein doppelter Ramazzotti gewünscht. Michael teilte die Karten aus und bemerkte: »Gleich ist aber Schluss mit der ›Juristerei‹ und es wird gezockt. Nur noch eins: Ich war heute auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts. Bei der Abgabe einer Fristensache hat mir der Friedrich Maurer ebenfalls verraten, dass es sich wieder um einen älteren Richter handeln würde, der seinen Weg nach Waldeck gefunden habe. Ich gehe damit davon aus, dass wir erneut ein ›Auslaufmodell‹ ohne weitere berufliche Ambitionen bekommen werden, das sich nicht auf unseren Rücken profilieren muss.«
»Dann wird sich wohl für uns auch atmosphärisch wenig ändern«, bemerkte Horst, »aber sofort an eurem Punktestand. Ich spiele gleich mal einen Damensolo sage auch sofort ›Re‹ und ›Keine 90‹ an.«
4. Kapitel
Der Amtsrichter
Der 1.Mai war ein Samstag. Dr. Gerd Bein war am Vortag nach Frankenberg an der Eder gereist, um vor seinem beruflichen Neustart ein langes Wochenende im Hotel ›Die Sonne‹ zu verbringen, einem feinen Wellnesshotel mit Sternerestaurant und Spa. Gestern hatte er sich seit längerer Zeit wieder mal ein dreigängiges Menü gegönnt. Nach dem Frühstück und einem Morgenspaziergang mit seinem Dackel Justus kam der Hund zum Ruhen in das mitgeführte Körbchen, während Gerd zum gleichen Zweck den Hamam bevorzugte.
Gerd war ein Mann im Alter von nunmehr knapp über Fünfzig und vom Typ her eher ein introvertierter Mensch. Sein hellbraunes glattes Haar, das er streng zurückgekämmt trug, war noch weitgehend voll, inzwischen aber von diversen Grautönen durchsetzt. Zudem hatten sich im Stirnbereich deutlich sichtbare Geheimratsecken gebildet. Sein eher rundes Gesicht zierte eine dicke Hornbrille, durch die seine blauen Augen blitzten. Über die Brillenränder ragten sehr buschige Augenbrauen hinaus. Seit einiger Zeit trug Gerd einen Vollbart, der etwas grauer als sein Kopfhaar war und seinem Aussehen wenig schmeichelte. Bezogen auf seine Körpergröße von lediglich 1,70 m war Gerd immer noch zu korpulent. Seine Körpermitte zierte ein Vollbauch, im Volksmund verächtlich auch als Wampe bezeichnet. Wären ihm durch sein Übergewicht nicht bereits einige gesundheitliche Probleme entstanden, hätte er seinem Aussehen wohl keine Bedeutung beigemessen. Seine Blutwerte waren aber alles andere als zufriedenstellend. Auf dringenden ärztlichen Rat und mit Hilfe von Justus war es ihm inzwischen gelungen, wenigstens einen leichten Bewegungsdrang zu entwickeln.
Als er den Spa-Bereich betrat, war er für sich alleine. Am heutigen Vormittag herrschte gähnende Leere. Wahrscheinlich lagen die meisten Hotelgäste noch in den Federn, gab es doch gestern in der Sonne eine Sonderveranstaltung bestehend aus einem Sechs-Gänge-Menü-Surprise verbunden mit anschließendem geselligem Beisammensein in der Bar unter dem Motto ›Tanz in den Mai‹. So etwas war gar nichts für Dr. Bein. Er schien vom Typ her wohl eher der geborene Junggeselle zu sein. Entgegen seiner beim Einchecken aufgekommenen Befürchtung wurde er indessen nicht von dem Geräuschpegel der Tanzveranstaltung gestört, hatte er doch, weil er seinen Hund mitgebracht hatte, ein Zimmer nach hinten raus zugeteilt bekommen. Auch jetzt schätzte er die Ruhe, die ihn umgab. Er hätte es grauenvoll empfunden, wenn er von einer Damengruppe umlagert worden wäre, welche die allerorts aufgestellten Schilder, ›Wir bitten Sie im Spa-Bereich unbedingt Ruhe einzuhalten‹, geflissentlich ignoriert hätte.
Gerd verspürte langsam eine gewisse Vorfreude auf den übernächsten Tag, an dem er sein neues Amt antreten würde. Er dachte daran, wie oft ihn bislang das Glück des Tüchtigen verschmäht hatte. Seine bisherige berufliche Laufbahn verlief in toto nicht so erfreulich, wie er und andere es erwartet hatten.
*
Gerd wuchs auf dem Land auf. Er stammte aus recht einfachen Verhältnissen, hatte es aber zum ersten Akademiker in der Familie Bein gebracht. Zu verdanken war dies nicht nur seinem Intellekt, sondern auch dem Ehrgeiz seiner Mutter Gerlinde. Sie war Sekretärin im Vorzimmer des Bürgermeisters von Alsfeld, einer Stadt am Rand des Vogelsberges. Ihr Chef hatte Karriere gemacht, obwohl ihm ein derartiger Aufstieg nicht in die Wiege gelegt worden war. Er wuchs in einem landwirtschaftlichen Kleinstbetrieb auf und konnte erst auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur machen. Als studierter Jurist – und nicht zu vergessen auch wegen seiner Mitgliedschaft in der ›richtigen‹ Partei – gelangte er schließlich in das Bürgermeisteramt. Dieser Werdegang imponierte Gerds Mutter. Während sein Vater, der in der gleichen Gemeinde als Arbeiter im Bauhof tätig war, nicht sonderlich daran interessiert war, dass sein Sohn eines Tages eine Universität besuchen würde. Ihm erschien das Budget der Familie Bein für ein solches Unterfangen viel zu knapp. Schließlich war noch das Haus abzuzahlen. Finanziell war ein Auslandsurlaub sowieso nicht drin, nur alle paar Jahre Campingferien am Edersee.
Mutter Bein, die in der Familie das eigentliche Sagen hatte, hatte jedoch beschlossen, dass ihr einziges Kind es einmal besser haben müsse als seine Eltern. Sie hatte durchschaut, dass eine gute Ausbildung das A und O einer Karriere ist. Die von ihr gewählten Erziehungsmethoden waren indessen fragwürdig. Völlig unnötig wurde Gerd schon in der Grundschule im Übermaß zum ständigen Lernen und Repetieren gezwungen. Für Sport, Spiel und Spaß ließ sie ihm zu wenig Raum. Ihre Ambitionen führten schließlich soweit, dass Gerd, weil seine Mutter die örtliche Gesamtschule als weiterführende Bildungsanstalt für unzureichend erachtete, nach Abschluss des vierten Schuljahrs als einziges Kind seiner Klasse ein traditionelles, aber verkehrstechnisch ungünstig gelegenes städtisches Gymnasium zu besuchen hatte. Damit wurde er zu früh von seinem heimatlichen Umfeld, insbesondere seinen dörflichen Spielkameraden, isoliert.
Plötzlich war Gerd in einer neuen Umgebung unvorbereitet ganz auf sich alleine gestellt. Er war zwar geistig, nicht aber körperlich dem ungewohnten Umfeld gewachsen. Der viel kleiner als seine gleichaltrigen Klassenkameraden gediehene Gerd strotzte zudem nicht gerade mit Kontaktfreude. Da Süßigkeiten aller Art zeitlebens sein Verderben waren, war er überdies für sein Alter zu fettleibig. Dass er schnell zum Klassenbesten aufstieg, freute zwar seine Mutter, aber die genannten Umstände hatten, im Gegensatz dazu bei seinen Mitschülern zur Folge, dass er rasch unbeliebt wurde. An sportlichen Aktivitäten, durch die sein Dilemma vermutlich besser in den Griff zu bekommen gewesen wäre, hatte Gerd keinerlei Interesse. Er konnte mit Ach und Krach Radfahren und Schwimmen. Im Übrigen besorgte er sich – mit Hilfe seiner Mutter – ärztliche Atteste, um, soviel wie möglich, vom Sportunterricht befreit zu werden. Den als Folge seiner Unsportlichkeit zu befürchtenden unmittelbaren Spötteleien konnte er sich damit zwar entziehen, er war aber nach wir vor gut dazu geeignet, seinen Mitschülern als Mobbingopfer zu dienen. Kinder können eben auch grausam sein. Gerd blieb bis zum Abitur als plumper Streber unpopulär. Nach der Pubertät startete er zwar gelegentlich Versuche, zum weiblichen Geschlecht Kontakte zu knüpfen, die indessen nie auf Gegenliebe stießen. Selbst als er im Alter von 18 Jahren das Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen hatte, war es ihm bis dahin nicht gelungen, eine Frau zu küssen oder gar mit ihr intim zu werden.
Daran änderte sich auch während seiner Studienzeit in Frankfurt am Main anfangs wenig. Seine Mutter hätte es ohnehin lieber gesehen, wenn er zu Hause in Mücke wohnen geblieben wäre und in Marburg oder Gießen Jura studiert hätte. Sie wollte nämlich nicht die Kontrolle über ihren Sohn verlieren. Gerd hatte jedoch nach dem Abitur den Entschluss gefasst, sich endlich abzunabeln. Er trug sich deshalb zum Studiengang Rechtswissenschaften an der Goethe Universität ein. Die finanziellen Bedenken seines Vaters konnte er zerstreuen, nachdem ihm BAföG zum Höchstsatz bewilligt worden war.
Gerd hatte große Freude am Studium, war aber bei seinen Kommilitonen sehr rasch, aber völlig zu Unrecht, als Arschkriecher verschrien, nur weil er in den Hörsälen – in alter Gewohnheit – stets in der ersten Reihe Platz nahm, sich von Anfang an um den Erwerb profunder juristischer Kenntnisse bemühte und sich ferner traute, alsbald fachliche Diskussionen mit seinen Professoren zu führen. Von den Studentenkneipen und dem Universitätssport hielt er sich fern. All das kam bei den übrigen Erstsemestern nicht gut an und führte erneut zu einer Ausgrenzung, die darin gipfelte, dass ihm der Spitzname ›Sartorius‹ verpasst wurde.
Beim Sartorius handelt es sich tatsächlich um eine Gesetzessammlung in der die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Normen in einem charakteristischen roten Einband aus Plastik eingeheftet worden sind. Der Name geht auf den Begründer dieses Werkes, Carl Sartorius, zurück. Die Gesetzessammlung wird aufgrund von Farbe und Form sowie eines Gewichtes von nahezu 2,5 kg von den Studenten oft auch als Ziegelstein bezeichnet. Da Gerd Bein ebenfalls sehr unförmig war, fanden seine Kommilitonen diesen Necknamen für ihn mehr als passend. Dass die Studiengenossen ihn als Sartorius bezeichneten, kam Gerd erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Ohren. Er ärgerte sich, war aber froh, bisher nicht auf diese Weise persönlich angesprochen worden zu sein. Da sein Schwerpunkt bekannterweise im Zivilrecht lag, war der Name ohnehin deplatziert. Wenn sie ihn unbedingt ärgern wollten, wäre eher ›Schönfelder‹ richtig gewesen. Denn dieses Werk enthält die wichtigsten zivil- und strafrechtlichen Normen nebst dem jeweiligen Verfahrensrecht. Der Name geht auf den Begründer dieses Werkes, Heinrich Schönfelder, zurück.
Von seinen Professoren wurde Gerd Bein dagegen sehr geschätzt. Als er bereits nach drei Semestern alle kleinen Scheine in den Pflichtfächern Bürgerliches Recht, Strafrecht und Öffentliches Recht mit Prädikat bestanden hatte, wurde er von Prof. Dr. Olaf Sack als Tutor und zwei Semester später als wissenschaftliche Hilfskraft an dessen Professur für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte geholt.
Das war für Gerd eine Art von Reinkarnation. Die ihm nunmehr obliegenden Aufgaben und seine ihm scheinbar angeborene Gabe, Wissen nachvollziehbar zu vermitteln, führten erstmals auch zu einer positiven Wahrnehmung seiner Person bei den Kommilitonen. Denn er nahm sich für schwächere Mitstudenten mehr Zeit als bezahlt, um diesen auf die Sprünge zu helfen. Aus dieser Funktion heraus gelang es ihm schließlich auch, mit einer Studentin eine Beziehung aufzubauen.
Sie hieß Karin Mayer zu Kaisersdorf und war die Tochter eines Rechtsanwaltes aus Düsseldorf. Dieser war Senior-Chef einer sehr großen Kanzlei und verdiente Geld wie Heu. Karins Weg in eine sorglose Zukunft war damit greifbar nahe, sie musste dazu ›nur‹ irgendwann einmal das erste Examen bestehen. Davon war sie jedoch weit entfernt. Sie hatte zwei Semester vor Gerd mit dem Studium begonnen, hatte allerdings, im Gegensatz zu diesem, noch keinen der für eine Zulassung zum Examen erforderlichen großen Scheine erworben. Karin war zwar nicht extrem reizvoll, aber infolge ihrer blond gefärbten Haare sowie einer barocken Figur wirkte sie auf viele ihrer männlichen Kommilitonen recht anziehend. Mit ihrem großen Busen und dem auffallend dicken Hinterteil passte sie rein optisch gut zu Gerd. Für beide wurde die Beziehung zu einer Win-win-Situation. Die in sexuellen Dingen sehr erfahrene Karin führte Gerd in eine in dieser Hinsicht für ihn völlig neue Welt ein. Endlich fand er eine Bewegung, die ihm große Freude bereitete. Während Gerd in Karin, die er mit Kosenamen ›Ferkel‹ nannte, unsterblich verliebt war, hatte diese den Kontakt zu ihm mehr aus Gründen der Zweckmäßigkeit aufgenommen. Und dies im Ergebnis zu Recht: Gerd, dem sie den Namen ›Pummel‹ gegeben hatte, wurde zu ihrem privaten Repetitor, so dass sie das erste Examen – wider Erwarten – sogar mit einem ›befriedigend‹ absolvieren konnte. Die eingereichte Hausarbeit stammte – illegaler Weise – im Wesentlichen aus der Feder von ›Pummel‹.
Zu dessen Unbehagen ging das Verhältnis aber kurze Zeit nach dem bestandenen ersten Examen in die Brüche, weil Karin das Referendariat nicht in Hessen, sondern in Nordrhein-Westfalen in der Hoffnung antreten wollte, um dort – nunmehr auch über die Connections ihres Vaters – ohne größeren Aufwand weitere Pluspunkte zu ergattern. Gerd hatte zu diesem Zeitpunkt sein Referendariat beinahe beendet und von Prof. Sack die Zusage erhalten, nach dem bestandenem Zweiten Examen von ihm für zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt zu werden verbunden mit dem Versprechen, in dieser Zeitspanne zugleich promovieren zu können. Dieses Angebot zog Gerd der vagen Aussicht vor, die Beziehung doch noch aufrecht erhalten zu können und dazu mit Karin nach Düsseldorf zu ziehen. Überdies dämmerte es ihm langsam, dass er für diese Lady mehr Mittel zum Zweck war. Von da ab gingen ›Ferkel‹ und ›Pummel‹ auf getrennten Wegen. Aufgrund seines geschwundenen Vertrauens in die Lauterkeit der Frauenzimmer entschloss sich Gerd in punkto Beziehungen zu erneuter Abstinenz. Sexuelle Bedürfnisse ließen sich in der allergrößten Not mit etwas Geld unschwer auch im Frankfurter Rotlichtmilieu befriedigen.
Gerd, der bei seinem Berufseintritt zwei Prädikatsexamen vorweisen konnte, kam schnell darauf, dass er von Professor Sack vor allem deshalb als Assistent ausgewählt worden war, damit er einen Großteil der eigentlich diesem obliegenden Arbeit übernehmen könne. Der Professor fiel in die Kategorie Mensch, die in Bayern gerne auch als ›Bazi‹ bezeichnet werden, weil ihnen etwas Durchtriebenes anhaftet. Wegen seines von ihm gepflegten bayrischen Tonfalls war dieser Begriff auch der unter den Studenten geläufige Spitzname des Professors.
Professor Sack wohnte nicht in Frankfurt, sondern lebte in seiner Heimatstadt München. Er hatte stets gehofft, einen ›Ruf‹ von der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität zu erhalten, also ein Angebot, an dieser Hochschule künftig eine planmäßige Professur übernehmen zu können. Soweit er auch in Frankfurt das Fenster öffnete, er hörte aus Bayern niemanden nach ihm rufen. Also pendelte er nach wie vor einmal wöchentlich mit der Bahn von München nach Frankfurt und zurück. Als ordentlicher Professor hatte er lediglich 8 Vorlesungsstunden pro Woche zu halten. Überdies dauert eine Vorlesungsstunde, gleich einer Schulstunde, lediglich 45 Minuten. Seine Pflichtveranstaltungen hatte Prof. Sack zudem so geschickt gelegt, dass er nur eine Nacht im Hotel Frankfurter Hof zu verbringen hatte. Dazu startete er – und dies natürlich nicht in der vorlesungsfreien Zeit von immerhin 5 Monaten im Jahr – an jedem Dienstag um 6:15 Uhr mit dem ICE von München in Richtung Frankfurt. Bei planmäßiger Ankunft um 9:40 Uhr verblieb ihm genügend Zeit, die erste Vorlesung von 11:15 Uhr bis 12.45 Uhr zu absolvieren. Nachmittags hielt er eine zweite Vorlesung von 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr, um sich sodann bis in den späten Abend dem administrativen Teil seiner Professur zu widmen. Die insofern anfälligen Arbeiten hatte sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, also Gerd, akribisch vorzubereiten. Am folgenden Mittwoch hielt Professor Sack vormittags noch zwei weitere Doppelstunden Vorlesung, um anschließend die erforderlichen Tätigkeiten, die in der kommenden Woche in Frankfurt ausgeführt werden sollten, so zu delegieren, dass er auf jeden Fall den letzten ICE erreichen konnte, der Frankfurt um 22:30 Uhr in Richtung München verließ.
Damit verblieb für Gerd zu wenig Zeit, sich an seine Promotion zu setzen. Er hatte schließlich sämtliche praktische Übungen, die den Studenten zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes angeboten werden mussten, zu übernehmen. Außerdem waren von ihm alle Klausuren und Hausarbeiten, die von den Studierenden zur Erlangung der kleinen und großen Scheine im Zivilrecht geschrieben werden mussten, zu korrigieren. Schließlich war der Professor qua Funktion auch in Examensprüfungen eingebunden. Auch dort gab es Hausarbeiten und Klausuren zu bewerten, die von Gerd, damit es der Professor leichter hatte, vorzukorrigieren waren. Folge hiervon war, dass seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht die angedachten zwei, sondern insgesamt sechs Jahre dauerte. Gerd hatte zwar große Freude an der Lehrtätigkeit und erhielt auch ein auskömmliches Einkommen, aber im Vergleich zum Umfang seiner Arbeit war dieses alles andere als angemessen. Zudem ging ihm die Zeit, die er infolge des relativ schnellen Abschlusses seines Studiums gewonnen hatte, wieder verloren.
Zu seinem Glück hatte Gerd sich ein rechtsgeschichtliches Thema ausgewählt, so dass er zu guter Letzt nicht noch von einer Gesetzesnovelle, die seine Arbeit ganz oder zum Teil obsolet hätte machen können, überrollt werden konnte. Am Ende seiner universitären Laufbahn erhielt er für seine Dissertation die höchste Auszeichnungsstufe ›Summa cum laude‹ (zu Deutsch: Mit höchstem Lob). Sein Thema: ›Der Einfluss des römischen Rechts auf das teutonische Recht‹ hatte allerdings nur für den überschaubaren Kreis der deutschen Hochschullehrer der Rechtsgeschichte Bedeutung, so dass kein juristischer Verlag bereit war, auf eigenes Risiko den Druck seines Werkes zu übernehmen. Gerd ließ daher die für den Erhalt der Promotionsurkunde erforderlichen 100 Pflichtexemplare von einem Kopierstudio fertigen. Nachdem er wenige hiervon für sich zurückgelegt hatte, verschwand der verbleibende Rest im Seminarkeller der Goethe Universität, wo er wahrscheinlich noch heute auf einem stillen Plätzchen trocken gelagert wird.
*
»Darf ich dem Herrn etwas servieren?«, mit diesen Worten wurde Gerd von einem Kellner jäh seiner Träumerei entrissen.
»Ja sehr gerne«, antwortete Gerd, der schon einen ganz trockenen Hals hatte. »Was gibt es denn?« »Im Spa-Bereich darf ich ihnen zur Vermeidung jeglicher Gefahren leider nur warme Getränke und nicht alkoholische Kaltgetränke in wiederverwertbaren Kunststoffbechern servieren. Ferner kann ich ihnen in begrenztem Umfang Fingerfood anbieten.« Gerd bestellte einen großen Latte Macchiato ohne Zucker nebst einem Selterswasser sowie zwei mit Frischkäse gefüllte Wraps, nach deren Genuss er wieder die Augen schloss und alsbald die Stimme von Prof. Sack wahrzunehmen glaubte.
*
»Gratuliere lieber Herr Dr. Bein! Und wie soll es nun weitergehen? Ich würde es ja begrüßen, wenn sie bei mir auch habilitieren würden.« Gerd, der keine Lust verspürte sich weiter ausbeuten zu lassen, entgegnete, dass er dazu Bedenkzeit brauche, um zwei Tage später seinem Doktorvater mitzuteilen, dass er den Elfenbeinturm lieber für immer verlassen wolle.
Zwei der zahlreichen in der NJW (Neuen juristischen Wochenzeitschrift) veröffentlichten Stellenausschreibungen von Frankfurter Großkanzleien hatten sein Interesse geweckt. Da er sich inzwischen in Frankfurt heimisch fühlte und vor Ort bleiben wollte, setzte Gerd bereits am nächsten Tag passende Bewerbungsschreiben auf und richtete – rein vorsorglich – ein weiteres an das Hessische Ministerium der Justiz.
Schon eine Woche später bedankte sich die Rechtsanwaltsgesellschaft PPMM GbR artig für sein Bewerbungsschreiben mit der gleichzeitigen Mitteilung, sich bereits anderweitig entschieden zu haben.
Nach weiteren zwei Tagen erhielt Gerd die Einladung zu einem Interview in der Frankfurter Niederlassung der weltweit operierenden Kanzlei Mac. Durban Inc. Es fand am kommenden Samstag statt.





























