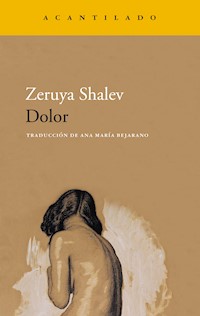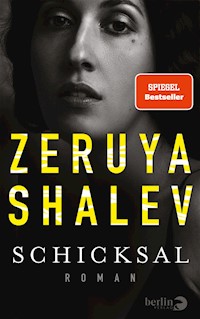19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wer weiß schon, was der Erzählerin in diesem halben Jahr wirklich geschah. Die junge Frau, die noch nicht einmal ihren Namen verrät, tischt uns eine Geschichte nach der anderen auf. Nur eins scheint klar: Sie hat Mann und Tochter für ihren Geliebten verlassen und nun zerbricht sie daran. Der Spiegel, den sie sich erzählend vorhält, scheint in Stücke gesprungen und in jeder Scherbe schillert eine andere Version. Trauer, Verlassenheit, Angst und Wut lassen sie die Welt als Apokalypse des Schmerzes erleben … Als dieser provokante wie hochliterarische Klagegesang erschien, rief er in Israel wütende Empörung hervor. Erst jetzt, fast 30 Jahre später, scheint endlich die Zeit reif für dieses frühe literarische Meisterwerk einer Weltautorin. »Erst als ich ›Schicksal‹, meinen 7. Roman, geschrieben hatte, wagte ich, mein Debüt wieder zu lesen. Endlich spürte ich die Bereitschaft, ihn als Teil von mir anzunehmen, auch wenn er Nicht ich ist ... Ich konnte meine wilde und gebeutelte Heldin ins Herz schließen und Mitgefühl für sie empfinden. Als ich begann, den Roman für Sie, mein treues deutsches Publikum, vorzubereiten, spürte ich, dass es nötig war, ihm ebenjene mütterliche Zuwendung zukommen zu lassen, die ich ihm vor dreißig Jahren nicht hatte geben können. Ich tauchte noch einmal in seine Welt ein und versuchte, auf dem Zeitstrahl zurückzukehren und der jungen Autorin, die ich damals war, die Hand zu reichen.« Zeruya Shalev
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer
© 1993, 2024 Zeruya Shalev. Titel der hebräischen Originalausgabe: »Dancing, Standing Still«, Keter Publishing House, Jerusalem 1993
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Stocksy / Irina Efremova
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort der Autorin
Genau sieben Monate …
Wie konnte das passieren, …
Indessen beginnt …
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort der Autorin
Es war ein überraschend warmer Dezembermorgen im Jahr 1991, lang bevor man überhaupt von der globalen Erderwärmung sprach. Ich saß im Café des YMCA in Jerusalem draußen an einem Tisch, nachdem ich meine kleine Tochter in ihrem Kindergarten auf der obersten Etage abgegeben hatte. Ich holte das Manuskript eines Schriftstellers, den ich damals lektorierte und mit dem ich verabredet war, aus der Tasche und wartete.
Zum Glück gab es damals noch keine Mobiltelefone. Er konnte mir nicht mitteilen, dass er sich verspätete, und ich konnte meine Zeit nicht mit all den heute üblichen Ablenkungen verschwenden. Da saß ich – tatenlos –, was nur selten vorkam, und betrachtete die Mütter, die eilig ihre weinenden Kinder, die sich nicht trennen wollten, hinter sich herzerrten. Sie sahen dermaßen erschöpft aus. Und der Tag hatte doch erst angefangen.
Ich erinnere mich noch gut an dieses merkwürdig warme Wetter, an die Kinderstimmen, die Chanukkalieder sangen, und an das vertraute Jucken in den Fingern, jene Anspannung, die die Wörter erzeugen, wenn sie sich zusammenfinden, und so drehte ich, während ich auf meinen Autor wartete, die erste Seite seines Manuskripts um und beschrieb die leere Rückseite.
Ich nahm an, es würde ein Gedicht, denn ich schrieb damals hauptsächlich Lyrik, doch zu meiner Überraschung zogen sich die Zeilen immer mehr in die Länge. Der Autor erschien mit einer Stunde Verspätung zu unserer Lektoratsbesprechung, und da hatte ich bereits zehn beschriebene Seiten. Nicht nur beschriebene, sondern brennende Seiten. Als ich sie am Ende des Tages wieder las, erschrak ich. Das war so anders als die Gedichte, die ich damals schrieb, und auch ganz anders als die wenigen Kurzgeschichten, die in meiner Schublade lagen.
Zu diesem Zeitpunkt war ich 32, verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter. Ich hatte, wie es in Israel in jenen Jahren üblich war, ziemlich früh eine Familie gegründet. Die meisten meiner Freundinnen hatten das sogar noch früher getan. Familie, Mutterschaft, Verantwortung, all diese Begriffe waren für mich noch ganz frisch und weckten zwiespältige Gefühle. Es war die stürmische Übergangszeit vom Ende der Jugend in die Welt der Erwachsenen, eine Zeit dramatischer Veränderungen von einer ungebundenen, primär auf sich selbst bezogenen Persönlichkeit zu einem Wesen, das Glied eines Familienkörpers wurde, der plötzlich, gleichsam aus dem Nichts entstand. Eine Zeit extremer Umwälzungen der Seele, die sich nach Harmonie sehnte, aber in ein bedrohliches Chaos geriet. Vor lauter Zweifeln hatte ich manchmal das Gefühl, alles breche auseinander.
Ich war entsetzt, blieb aber dran, schrieb weiter und gab mich mit Neugierde und Schmerzen dieser Figur hin, die aus mir herausschrie, dieser wilden jungen Frau, die sich gegen ihre Mutterpflichten auflehnt, die Konventionen durchbricht und der zum Schluss von allen ihren Beziehungen nichts bleibt. Einer Figur, die über ihr Leben und ihre verschiedenen Verluste widersprüchliche Versionen erzählt, eine absurder als die andere.
Sie war nicht ich, aber sie schrie, wie gesagt, aus mir heraus, in einem wilden und gnadenlosen Monolog, einer Art Seelenstrip oder Stand-up-Tragödie, mal klagend, mal anklagend, mal Liebe erflehend, mal ihre Geliebten verhöhnend – voller Ungereimtheiten; sie griff das Publikum an, und sie attackierte sich selbst.
Etwa anderthalb Jahre lang schrieb ich über sie, und an deren Ende zerbrach auch meine Familie. Ich hatte den Roman mit der Hand geschrieben, mit Bleistift und Radiergummi, manchmal auch eine Schere verwendet. Dabei lernte ich, schöpferische Einfälle und Inspiration mit Reflexion und Planung zu verbinden, poetische mit gesprochener Sprache zu verweben. Ich hatte mich zum ersten Mal auf den geheimnisvollen Weg des Romanschreibens begeben. Aufgewühlt, besorgt und voller Erwartung.
Als das Buch im August 1993 erschien, erwartete mich eine böse Überraschung. Anscheinend reagierte man auf meinen stauchenden Monolog, indem man mich zusammenstauchte, und auf die Aggressivität der Figur primär mit Gegenaggression. Es war wohl die mangelnde Empathie meiner Figur, die mangelnde Empathie mir gegenüber auslöste; die Ambivalenz der Heldin weckte vor allem Ablehnung und Verriss. Anders als mein einige Jahre vorher erschienener Gedichtband wurde mein Erstlingsroman mit Wut und Unverständnis aufgenommen.
Diese Reaktionen ließen mich verwundet und verängstigt zurück. Womöglich würden die Autoren des Verlags mir nun nicht mehr vertrauen, ich würde als Lektorin keine Arbeit mehr finden. Ich verlor den Glauben nicht allein an das Buch, sondern an mich als Schriftstellerin. Ich beschloss, ab jetzt nur noch Lyrik zu schreiben, aber es kamen keine Gedichte. Ab und zu begann ich eine Kurzgeschichte, brachte sie aber meist nicht zu Ende. Hin und wieder hörte ich von Lesern auch, wie sehr sie das Buch mochten, aber das verstärkte mein Gefühl von Enttäuschung nur.
Über zwei Jahre vergingen, dann meldete sich wieder das vertraute Jucken in den Fingern, eben diese Anspannung, die die Wörter erzeugen, wenn sie sich zusammenfinden. Ich erinnere mich, ich nahm ein leeres Heft aus der Schultasche meiner Tochter, die nun schon in die erste Klasse ging und schrieb darauf: Liebesleben. Wieder erlebte ich, wie das Schreiben floss, aber zu meiner Überraschung fühlte ich mich jetzt befreit von allen Befürchtungen und Erwartungen, beinahe gelassen.
Nach dem Erfolg von Liebesleben und den nächsten Romanen hörte ich immer häufiger von Lesern und Kritikern, dass sie mein erstes Buch schätzten. Plötzlich wurden akademische Studien darüber geschrieben, und in Russland, dem einzigen Ausland, in dem es seinerzeit erschienen war, bekam es ausgezeichnete Kritiken. Ich selbst blieb ihm gegenüber jedoch all die Jahre entfremdet. Ab und zu sah ich es im Regal, warf einen kurzen Blick hinein und klappte es schnell wieder zu. Es war eine schlechte Erinnerung.
Erst nachdem ich Schicksal, meinen siebten Roman, abgeschlossen hatte, wagte ich es, meinen Erstling noch einmal zu lesen. Vom Anfang bis Ende. Und nicht nur einmal. Plötzlich spürte ich in mir die Bereitschaft, ihn als Teil von mir anzunehmen, auch wenn er »nicht ich« ist. Zum ersten Mal konnte ich meine wilde und gebeutelte Heldin in der Zerrissenheit zwischen ihrem Mädchen und dem Mädchen in sich ins Herz schließen und Mitgefühl für sie empfinden, ja sie sogar für ihren Mut bewundern.
Als ich begann, den Roman für Sie, mein treues deutsches Publikum, vorzubereiten, spürte ich, dass es nötig war, ihm eben jene mütterliche Zuwendung zukommen zu lassen, die ich ihm damals nicht hatte geben können. Ich tauchte noch einmal in seine chaotische Welt ein und versuchte unter anderem, jene Stellen aufzuspüren, die mehr Vermittlung oder Präzision erforderten, Gedanken, die unverständlich oder rätselhaft geblieben waren. Ich versuchte, auf dem Zeitstrahl zurückzukehren und der jungen Autorin, die ich damals war, die Hand zu reichen, ihr hin und wieder zu helfen, ein Potenzial, das bisher nur zwischen den Zeilen angelegt war, in Worte zu fassen.
Bei dieser aufregenden Reise begleitete mich Anne Birkenhauer-Molad, eine Übersetzerin und Lektorin, wie man sie nur selten findet. Während sie zwischen dem Hebräischen und dem Deutschen vermittelte, gelang es ihr darüber hinaus, ab und zu zwischen mir und zwischen der, die ich damals war, zu vermitteln; ich bin ihr überaus dankbar für ihr weises Herz und ihren scharfen Blick.
Ich danke auch allen Mitarbeitern des Berlin Verlags, der in diesem Jahr sein dreißigstes Jubiläum feiert. Der Verlag, der selbst einige Veränderungen durchgemacht, Besitzer, Lektoren und Werbeleute gewechselt hat, ist für mich immer ein verlässliches und gutes Zuhause geblieben.
Dies ist auch der Ort, meinem Mann, Eyal Megged, zu danken, dessen kompromisslose Unterstützung gerade in jenen Jahren für mich von unschätzbarem Wert gewesen ist.
Genau sieben Monate nachdem ich der Liebe meines Lebens begegnet war, gingen wir, mein Mann und ich, uns heilen lassen. Der Heiler war ein Greis mit zitternden Fingern und einem depressiven Mund. Hättet Ihr uns drei so gesehen, Ihr hättet gedacht, wir seien gekommen, um ihn zu heilen. Wir trugen saubere schwarze Hemden, was unsere weißen und mutigen Gesichter betonte. Wir waren weiß vor Problemen, er blau vor Hoffnung. Heraus kam bei dieser Mischung ein süßlich helles Himmelblau. Sonst nichts. Hellblaue Vorhänge, ein hellblauer Langhaarteppich, hellblaue Kissen. Alles, was ein Mensch durch einen einzigen Fehler verlieren kann. Am Rand saß schweigend ein weiterer glatzköpfiger Mann und schrieb auf hellblauem Papier eine ziemliche Latte zusammen. Ich sagte: »Wie kann das sein? Wie viele Probleme können zwei Menschen denn haben?«
Der Heiler nahm einen Schluck Wasser und schüttete sich das ganze Glas über die Hose. Er schrumpfte vor Scham. Sofort stand mein Mann auf und trocknete ihn ab. Danach gab er ihm löffelweise zu trinken. Ich sagte: »Woher nähme ich das Recht, ihm ein Kind zu verweigern?« Viele Möglichkeiten gab es also nicht. Ich saß da, die ganze Situation war absolut unglaublich. Unten auf der Straße stand jemand, der billig Kreisel verkaufte. Er rief: »Die Preise kreiseln und drehn sich wie verrückt! Die Welt ist aus den Fugen, das ganze Haus steht Kopf!«
Die Operation, die sie vorschlugen, war absolut unzumutbar. War sie wirklich notwendig? Mein Mann und der Heiler beobachteten mich neugierig. Der Heiler setzte sich auf den weichen Schoß meines Mannes und strahlte vor Glück. Er sagte: »Schauen Sie, einen defekten Kopf muss man operieren. Einen Kopf, der in Ordnung ist, muss man nicht operieren.« Er holte einen riesigen Spiegel aus der Schublade und stellte ihn vor mich hin: »Entscheiden Sie, ob Ihr Kopf in Ordnung ist oder defekt.«
Der Spiegel blendete mich, ich konnte nichts sehen. Ich schaute zu meinem Mann. Schon sieben Jahre und sieben Monate traf er alle Entscheidungen für mich. »Was meinst du?«, fragte ich ihn, und er lächelte brutal. »Eine Frau, die sich von mir trennt, verzichtet auch darauf, meine Meinung zu hören.« Ich schaute zu dem Heiler. Er meinte: »Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin vor Alter blind.« Ich ging hinunter auf die Straße und rief den Kreiselverkäufer. Der sagte: »Tut mir leid, aber alles, was nicht die Form eines Kreisels hat, sieht für mich defekt aus. Kommen Sie, ich kleb Ihnen einen Kreisel an den Kopf; das löst alle Ihre Probleme.«
Im Kindergarten des Mädchens sangen sie bereits Chanukkalieder, aber geregnet hatte es noch nicht, und es war heiß. Im Radio sprach man von den Gefahren, die bei Chamsin-Wind von brennenden Kerzen ausgingen, und empfahl, die Chanukkaleuchter auf Eiswürfel zu stellen. Die Kreisel aus Blei zerschmolzen den Kindern in den Händen. Wenn Ihr auf der Straße ein Kind mit verbundenen Händen saht, wusstet Ihr gleich, warum. Man sah kaum noch Kinder ohne Verband. Deshalb streckte mein Mann plötzlich den Kopf aus dem Fenster und rief herunter: »Dass du es nicht wagst, bei dem einen Kreisel zu kaufen.«
Ich entschuldigte mich eilig und ging zurück ins Zimmer des Heilers. Ich sah, der Mann am Rand hatte schon lange Zahlenreihen geschrieben. Mein Mann wiegte den Heiler in seinen Armen. Er sagte zu ihm: »Schon immer wollte ich stillen, und noch mehr wollte ich Kinder kriegen.« Der Heiler kicherte genüsslich. Er versprach: »Das können wir heute alles lösen.«
Als wir bei ihm rausgingen, war mein Mann schwanger und ich ohne Gebärmutter. »Es gab keine andere Wahl«, hatte der Heiler sich entschuldigt. »Solange Sie noch verheiratet sind, sind Sie eine Einheit. Was ich ihm gegeben habe, musste ich bei Ihnen wegnehmen.« Ich sagte zu meinem Mann: »Konntest du damit nicht warten, bis wir geschiedene Leute sind? Ausgerechnet meine Gebärmutter wolltest du haben?« Sein Bauch schwoll schon an. Nacheinander sprangen die Knöpfe seines Hemdes ab.
»Na schön.« Ich gab klein bei. »Ich geb dir auch meine Umstandskleider, die brauchst du jetzt nötiger als ich.« Auf einen Schlag war meine Wut vorüber, sie schlug sogar um, in Mitleid. Keiner außer mir wusste es, aber in meiner Gebärmutter lag schon ein kleines, bösartiges Geschwulst. Nun bekam mein Mann von mir als Scheidungsgeschenk die Gebärmutter und dazu gleich noch das Geschwulst.
Als wir runtergingen, sahen wir den Kreiselverkäufer weinend vor einer Pfütze aus kochendem Brei sitzen. »Alle Kreisel sind auf einen Schlag geschmolzen«, jammerte er, »ich steh da und rufe noch: ›Die Welt ist aus den Fugen, das ganze Haus steht Kopf!‹, und indessen zerschmilzt mir das eigene Haus vor den Augen. Was mach ich denn jetzt?«
»Sehen Sie, mein Freund«, sagte mein Mann zu dem Kreiselverkäufer, in seinen schwarzen Augen glänzte religiöser Eifer, »dort oben wohnt der Heiler, der löst alle Ihre Probleme. Gehn Sie zu ihm hoch, er wird schon wissen, welche Operation die richtige für Sie ist.« – »Eine Operation?!«, schrie der Kreiselverkäufer. »Mir schmilzt das Haus weg! Was für eine Operation kann da noch helfen?«
Genau darauf hatte mein Mann gewartet. »Die Operation«, erklärte er geduldig, »wird Ihnen helfen, das Haus in Ihnen selbst zu finden. Er wird Ihnen ein Haus einpflanzen, dann brauchen Sie keine Häuser mehr aus gegossenem Blei.«
Das geschah, nur einen Monat bevor das Mädchen in Gefangenschaft geriet. Mein Mann war davon überzeugt, ich hätte sie ihnen ausgeliefert, aber es gibt drei Zeugen, die unter Eid aussagen können, dass sie entführt wurde. Die haben gesehen, wie die Soldaten sie in ihrem Tanzröckchen vom Spielplatz wegholten und über die Grenze brachten. Bei ihren Verhören sagte das Mädchen: »Ich habe keinen Vater, ich habe keine Mutter, ich habe keinen Bruder, ich habe keine Schwester«, doch sie glaubten ihr nicht.
Ihr könnt es glauben oder nicht, Hauptsache, endlich war etwas passiert. So hatte es nicht mehr weitergehen können.Ich hatte schon seit Jahren einen deprimierenden Tageslauf. Mein Mann wunderte sich, dass ich morgens nicht aufstand, und ich antwortete ihm: »Dich möcht ich sehen, wie du mit einem so deprimierenden Tageslauf morgens aus dem Bett kommst.« Also weckte er das Mädchen immer, zog ihr ein geblümtes Kleidchen an, putzte ihr die Zähne und fütterte sie mit Haferbrei, flocht ihr zwei Zöpfe und setzte ihr den kleinen Rucksack auf. So, mit den zwei Zöpfen und der Tasche auf dem Rücken, kam sie sich bei mir verabschieden.
Ein Mädchen, um das du dich nicht kümmerst, sagte ich mir, wirst du nicht lieben. Ein Mädchen, dem nicht du die Zöpfe geflochten hast, ist nicht deine Tochter. Wie Besuch, der nur kurz hereinschaut, kam sie in mein Zimmer, gab mir einen kleinen Kuss und sagte: »Steh endlich auf.« Ich musste mich schützen. Ich wusste nicht, wozu sie noch fähig war. Es heißt, die harmlosesten Gesichter verbergen die entsetzlichsten Gedanken, und sie, sie hatte das argloseste Gesicht, das man sich vorstellen kann.
Sie war eine Puppe, die man verzaubert hatte, sodass sie plötzlich zu atmen begann. Ich wusste nicht, wie lang ihr Motor laufen würde. Manchmal, wenn sie nachts aufwachte und weinte, sagte ich zu meinem Mann: »Schalt sie endlich aus. Wie lang soll das noch so gehen?« Schockiert sah er mich an und nahm sie in den Arm. Ich wusste, er würde sie entführen und bei der ersten Gelegenheit in ein Flugzeug setzen. In einem Puppenkarton wäre niemand draufgekommen, dass sie lebt. Als Geschenk war sie makellos, aber mir war klar, sie wusste zu viel.
Was hätte ich dann machen sollen? Jahre auf einen Anruf von ihm warten, dass er mir sagt: »Heut sind wir in Uruguay, morgen in Paraguay«, und das Mädchen mich mit fremdem Akzent ermahnt: »Steh endlich auf«? Dieses Leben ist nichts für mich. Jeder, der mich kennt, sagt mir: »Also du, du musst ja auf einem Fluss treiben und brauchst jemanden, der dir mit dem Fächer die Fliegen verjagt.«
Am Tag, an dem mein Mann auszog, rief ich ihn in seiner neuen Wohnung an und sagte: »Du hast hier eine Socke vergessen.« Er fragte: »Welche Socke?« Ich sagte: »Die weiße mit dem Loch.« Er sagte: »Wirf sie weg.« Ich sagte: »Einfach so wegwerfen? Jahre hast du auf ihr rumgetrampelt, und jetzt willst du sie wegwerfen?« Er sagte: »Jahre hast du auf mir rumgetrampelt, und jetzt wirfst du mich weg?« Ich sagte: »Ach, endlich höre ich mal was Interessantes von dir.« Wir lachten freundschaftlich.
Ich wünschte ihm viel Erfolg bei der Geburt und alldem. »Wenn du einen Rat brauchst, ruf an. Ein Glück, dass du bei meiner Entbindung dabei warst, so weißt du mehr oder weniger, wie es geht.« Er sagte: »Alles, was ich von deiner Entbindung noch weiß, ist, dass du dich in den Geburtshelfer verliebt hast und dich dann nichts anderes mehr interessiert hat.« Ich sagte zu ihm: »Wieder hast du recht. Auch ich kann mich an nichts anderes erinnern.« »Was machen wir dann?«, fragte er. »Geh in einen Geburtsvorbereitungskurs wie alle andern auch.«
Eine Stunde später rief er an: »Solltest du die zweite Socke noch finden, nehm ich sie vielleicht doch. Jetzt, mit dem Unterhalt und so, bleibt mir kein Geld für Socken.« Ich sagte zu ihm: »Die andere Socke haben wir vor sieben Jahren und sieben Monaten verloren, erinnerst du dich nicht?«
Er wechselte das Thema. »Vielleicht sollten wir dem Mädchen ein Paket von uns beiden in die Gefangenschaft schicken, damit sie nicht erfährt, dass wir uns haben scheiden lassen?« Ich sagte: »Du Idiot, sie behauptet bei den Verhören doch, sie hätte keine Eltern, und dann bekommt sie von ihnen plötzlich ein Paket?« »Dann schreiben wir, es sei von ihrem Bruder und ihrer Schwester.« Ich sagte: »Du Idiot, sie sagt auch, sie habe keine Geschwister.«
Da ich ohnehin am Telefon saß, rief ich den Ex-Liebhaber an. Er meldete sich mit knarzender Stimme. Ich sagte zu ihm: »Ich glaube, du hattest den stehendsten und längsten Schwanz, den ich je gesehen habe, und jetzt höre ich, dass ausgerechnet er schon bald begraben werden soll. Wie das?«
»Du hast recht. Die Ärzte prophezeien mir eine Lebenserwartung von sieben bis zehn Tagen.« Ich sagte: »Ich spreche von ihm, nicht von dir. Ich gehe davon aus, dass mit jedem Mann, der stirbt, auch ein Schwanz aus der Welt verschwindet, aber in deinem Fall ist das besonders betrüblich.«
»Lass dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen. Mein Schwanz war nur wegen meiner Krankheit so groß. Wegen des Fiebers hatte ich dauernd diesen Ständer. Frag nicht, das war ein Albtraum.«
»Einige haben das bestimmt sehr genossen«, sagte ich und grinste vor mich hin, »zum Beispiel deine französische Konkubine. Apropos, wie geht es ihr denn?«
»Frag nicht«, sagte er zerknirscht, »die Ärzte vermuten, dass ich sie angesteckt habe. Jetzt liegt ihre Fotze in der kalten Erde, und glaub mir, das betrübt mich sehr.«
»Kann ich mir denken. Dann ist sie mir also auch diesmal zuvorgekommen, diese französische Hure! So wie sie auch immer vor mir in dein Bett kroch, um ihn zu bekommen.«
»Ich wollte dir wirklich sagen, du solltest dich testen lassen«, sagt er, »ich entschuldige mich, falls ich dir da etwas angehängt haben sollte, aber was kann man machen. Man lebt nur einmal.«
»Und auch das nur mit Mühe«, sage ich, »vielleicht willst du heut Abend mit mir feiern?«
»Was denn?«, fragt er erstaunt.
»Meine Scheidung, den Tod der französischen Konkubine, deinen nahenden Tod, die Schwangerschaft meines Ex-Mannes. Und heute früh sind mir zudem auf einen Schlag alle Haare ausgefallen. Hattest du je einen besseren Grund zum Feiern? Lass uns mit einem Glas Flüssignahrung anstoßen, ich habe ja gehört, kauen kannst du nicht mehr. Lass uns von den schönen Zeiten reden, als mich nichts außer deinem Schwanz interessierte und dich nichts außer der französischen Konkubine.«
»Tut mir leid«, sagt er, »ich hab nicht die Kraft für so viel Feiern. Ruf in zehn Tagen noch mal an.« Er legt auf.
Zehn Tage später rief ich ihn an. Seine Stimme war kaum noch zu hören. Ich sagte: »Du brauchst dich nicht anzustrengen, diesmal rede ich. Schuld an allem sind du und mein Vater. In dieser Reihenfolge. Er hat früher angefangen, aber du hast mir den entscheidenden Schlag verpasst. Er hat wenigstens Ausreden, ich weiß nicht genau, welche, aber das werd ich bald erfahren. Beim Prozess. Ich habe gehört, er hat eine ganze Batterie von Anwälten angeheuert. Hörst du? Eine ganze Batterie von Anwälten beschäftigt sich mit diesem Fall! Und was wirst du tun?«
»Ich werde umschwirrt von meinen Dienstengeln erscheinen«, flüstert er.
»Dienstengel?!« Ich spucke das Wort in den Telefonhörer. »Noch nicht einmal die Engel der Zerstörung wagen sich in deine Nähe! Kein anderer Mann hat mich so angeekelt wie du. Alle Kleider, die du berührt hast, hab ich verbrannt. Nur die Stellen an mir, die du berührt hast, hab ich mich nicht getraut zu verbrennen.«
»Ich hab es schon immer gewusst, du bist nicht mutig genug«, röchelt er. »Nimm zum Beispiel die französische Konkubine. Am Tag, als sie erfuhr, dass ich krank bin, hat sie sich zusammen mit ihren Kindern angezündet. Sie sagte: ›Die Welt ist ohne seinen Schwanz nicht lebenswert.‹ So etwas hätte ich auch von dir erwartet.«
»Dann ist es höchste Zeit, dass du deine Erwartungen runterschraubst. Aber da wir ihn nun schon wieder erwähnen und du ja auch noch am Leben bist – was hältst du davon, dass ich ihn noch mal besuche? Nur einen kurzen Abschiedsbesuch. Du musst dich nicht verausgaben.«
»Bitte«, sagt er, »nur beeil dich, das ist mein letzter Tag. Weißt du noch, wo du ihn findest?«
An ebendiesem Tag hatte ich aufgehört zu laufen. Meine Beine waren schwach, mein Körper war schwer. Ich rief den Geliebten an und flehte ihn an: »Bitte, fahr mich zum Haus des Ex-Liebhabers.« Der Geliebte gähnte. Auch diesmal weckte ich ihn aus tiefem Schlaf. Am Tag, an dem mein Mann schwanger wurde, war der Geliebte eingeschlafen und war sieben Tage lang nicht wach zu kriegen. In der zweiten Woche betrug die längste Zeit, die er wach bleiben konnte, genau eine viertel Stunde.
»Wie sollen wir das alles in einer viertel Stunde schaffen?«, fragte er verschlafen. »Beeil dich«, sagte ich, »dann bist du in fünf Minuten bei mir. Du trägst mich ins Auto, denn ich kann nicht mehr gehen. Wenn du schnell fährst, sind wir in fünf Minuten beim Haus des Ex-Liebhabers. So schaffen wir alles in einer viertel Stunde.«
»Aber wie komm ich zurück in mein Zimmer?«, fragte der Geliebte verzweifelt. »Wo ich doch genau nach einer viertel Stunde wieder einschlafe.«
»Dann schläfst du eben im Auto«, antwortete ich ungeduldig, »und wenn ich mein Ding mit dem Ex-Liebhaber fertig habe, weck ich dich.«
Der Geliebte ist zu müde, um eifersüchtig zu sein. Früher war beim Namen des Ex-Liebhabers sein ganzer Körper zusammengezuckt. Jetzt höre ich, wie er sich streckt und seufzt: »Ich bin gleich da. Sei dann fertig.«
In allem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Seit mir die Haare ausgefallen sind, bin ich immer rechtzeitig bereit. Früher ging bei mir der ganze Morgen mit Frisieren drauf. So einen Pferdeschwanz oder einen andern oder flechten, und wenn, wie? Oder doch lieber nicht? Jetzt zieh ich mir die Strickmütze über die Glatze, binde den Kittel mit einem Gürtel enger und bin fertig.
Der Geliebte kam angerannt und trug mich auf Händen. Ich wusste, er würde es mir nicht verweigern. Der Geliebte hat mir noch nie etwas verweigert, und deshalb verweigerte ich mich ihm. Während er fuhr, streichelte ich seine Wimpern und schaute auf die Uhr. In drei Minuten würde er einschlafen. Und wir waren noch weit vom Haus des Ex-Liebhabers entfernt. An welcher Kreuzung würde ihn wohl der Schlaf übermannen? An der Kreuzung, an der wir uns immer verabredet haben, oder an der, wo wir uns immer verabschiedeten? An der Kreuzung, an der wir immer über die Vergangenheit redeten, oder an der, wo wir über die Zukunft sprachen?
Ich sah, wie er seinen schönen Kopf resigniert hin- und herwiegte und immer und immer schneller fuhr. Ich versuchte, seine Augenlider festzuhalten, aber genau eine viertel Stunde nachdem mein Anruf ihn geweckt hatte, blinkte er, fuhr rechts ran, legte den Kopf aufs Steuer und schlief ein. Der Geliebte, Hoffnung all meiner Hoffnungen, Grund aller Gründe, liegt blind, taub und stumm hier neben mir, zu nichts mehr nütze, auch nicht mehr schädlich, nicht lebendig, nicht tot, betrügt nicht und ist nicht treu, nicht Liebhaber, nicht Ehemann.