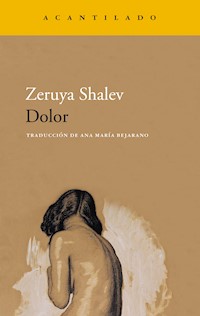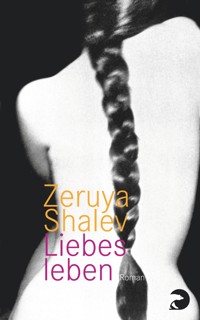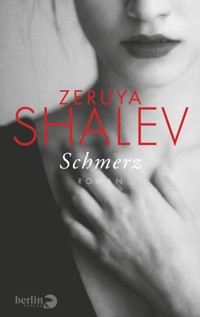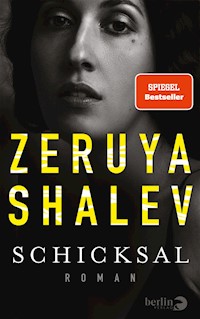
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Endlich – der neue Roman von Zeruya Shalev: Der SPIEGEL-Bestseller der israelischen Star-Autorin! Ein Generationenroman mit aktuellen politischen Anklängen, ein großes Beispiel moderner Frauenliteratur, die zugleich Weltliteratur ist. Atara ist zum zweiten Mal verheiratet, mit ihrer großen Liebe, doch neuerdings scheint Alex sich immer weiter von ihr zu entfernen. Noch größere Sorgen macht ihr der gemeinsame Sohn, ein Elitesoldat, der nach dem letzten Einsatz kaum mehr das Haus verlässt. Vielleicht um ihre Familie besser zu verstehen, vielleicht um ihr zu entkommen, sucht Atara Rachel auf, die erste Frau ihres Vaters, das große Tabu in Ataras Kindheit ... Die Idealistin Rachel scheint die Vergangenheit zu verkörpern - sie kämpfte mit dem Vater in der Untergrundmiliz gegen die Engländer und für einen israelischen Staat. Doch die Begegnung der beiden Frauen mündet in eine Katastrophe in der Gegenwart ... »Zeruya Shalev hat einen großen, hellsichtigen Roman geschrieben.« ttt Ihr lang erwarteter Roman "Schicksal" katapultierte Zeruya Shalev direkt auf die deutsche Bestsellerliste und löste einen Kritikersturm der Begeisterung aus. Denn "Schicksal" verwebt Familiengeheimnisse und politische Zeitgeschichte zu einer komplexen Betrachtung innerer Zerrissenheit. Ein literarisches Geschenk für Mütter und Freundinnen, das lange nachhallt "Schicksal" lädt zum Diskutieren und Reflektieren ein. Es provoziert Sie zum Widerspruch und zum Hinterfragen. Doch vor allem verführt es Sie zum Lesen in einem Rutsch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Unterstützung ihrer Arbeit.
Die Originalausgabe erscheint 2021 unter dem Titel Pelia beim Keter Verlag, Jerusalem
© Zeruya Shalev 2021
Für die deutsche Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021
Vermittelt durch: The Institute for the Translation of Hebrew Literature
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Virginia Ateh / Trevillion Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Glossar
In Erinnerung an Reuven Katz
Ich danke Anne Birkenhauer,
die mit ihrem scharfen und klugen Blick
während des Übersetzens auch
zur Lektorin und Freundin wurde.
Zeruya Shalev
Erstes Kapitel:
Ich bin’s, Rachel
Schweigend stand sie vor der geschlossenen Tür. Wozu noch klingeln oder klopfen, seine Mutter hat sie ja schon bemerkt. Hinter dem offenen Küchenfenster gewahrte sie den Schatten einer Bewegung, lautlos wie ein Augenzwinkern. Ein riesiger Topf köchelte auf dem Petroleumkocher, bestimmt versteckte sich dahinter die klein gewachsene Frau mit dem Holzlöffel in der Hand und kochte Linsensuppe für ihren geliebten Sohn. Die Dämpfe quollen durchs Fenster zu ihr nach draußen, ließen ihr Gesicht erröten, wurden aufgesogen von ihrem Haar. Kochte sie wirklich für ihn? War er zu Hause?
»Sonja, mach mir auf«, rief sie in Richtung des Topfes und fügte völlig unnötig hinzu, »ich bin’s, Rachel.« Es war, als höre sie regelrecht das Zögern ihrer Schwiegermutter, wie raufende Schatten. Wird die es wagen, sie zu ignorieren, nachdem sie all die Gefahren des Weges auf sich genommen hat?
In diesen Tagen ins belagerte Jerusalem zu fahren, war verdammt gefährlich. Arabische Banden lauerten am Straßenrand und beschossen die Fahrzeugkolonnen. Ihre Freunde in Tel Aviv hatten versucht, sie von der Fahrt abzubringen, doch sie hatte darauf bestanden. Das ist doch Selbstmord, hatten sie immer wieder zu ihr gesagt, aber sie hatte keine Wahl gehabt. Sie hatte ihm einen Brief nach dem andern geschickt, und er hatte nicht geantwortet.
»Sonja, ich muss Meno sehen!«, versuchte sie es wieder. »Ich bin extra aus Tel Aviv gekommen. Ich mache mir Sorgen um ihn, ich verstehe nicht, was passiert ist. Ist er da?«
Die Dämpfe hüllten sich um ihren Körper wie ein aus der Flasche gelassener Geist, und es schien, als würde sie gleich schmelzen und nur eine kleine Pfütze hinterlassen, die ihre Schwiegermutter triumphierend die Treppe hinunterwischen würde. Sie hatte vergessen, wie aggressiv die Jerusalemer Sonne an den ersten Chamssin-Tagen im Frühling sein konnte. Sie brannte genau über ihrem Schädel. »Sonja, ich bin durstig«, rief sie, hielt sich an dem rostigen Fenstergitter fest, »hast du ein Glas Wasser für mich?«
Bei ihrem ersten Besuch in dieser Wohnung vor vier Jahren war sie der schwerfälligen Frau in dem ausgeblichenen Morgenrock genau an dieser Stelle der Treppe begegnet, als die, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Kessel kochend Wasser über den Kindern des Viertels entleerte, die die Wollmispelfrüchte von ihrem Baum pflückten. Ein paar Tropfen davon waren auf ihr rotes Kleid mit den gelben Blumen gespritzt, das sie extra für diesen Besuch angezogen hatte. Sie war auf dem Treppenabsatz stehen geblieben, hatte gesehen, wie die Kinder schreiend auseinanderstoben, und hatte auch das schiefe Lächeln gesehen, das sich auf dem teigigen Gesicht der Frau ausbreitete. Unmöglich, dass das Menos Mutter war. Sie hatte den Rückzug angetreten, sie musste den falschen Aufgang genommen haben, die Häuser hier sahen sich so ähnlich, doch in eben diesem Moment war er bleich und beschämt zu ihr herausgekommen und hatte diese Frau zurückhaltend gescholten. Er hatte immer auf Umgangsformen und gutes Benehmen geachtet, bis er eines Tages aufgestanden und einfach gegangen war, ohne ein Wort zu sagen, ohne einen Brief zu hinterlassen.
Bei diesem Besuch nun waren die Mispeln aus irgendeinem Grund noch grün und zogen außer ein paar Wespen niemanden an. Sobald sie reif sind, werden sie in der belagerten Stadt besonders begehrt sein, aber seine Mutter wird es nicht wagen, das streng rationierte Wasser auf diese Art zu verschwenden. Wie wird sie die kleinen Räuber verjagen, mit Steinen? Und wie wird sie ihre Schwiegertochter vertreiben? Die hatte ihr ihre kostbarste Frucht, ihren Jüngsten, ja bereits vor vier Jahren geraubt.
Sie vernahm ein leises Geräusch aus Richtung des Balkons und wandte den Blick zu dem Wassertank, der dort erst vor Kurzem installiert worden war, ein großer Wassertank aus Blech. Ob sie sich dahinter versteckte? Die Araber hatten die Wasserversorgung in die Stadt unterbrochen, und in einem ihrer Briefe hatte sie geschrieben, sie habe auf dem Balkon einen Tank für Notzeiten anbringen lassen. Sie streue Brotkrumen darauf, die Vögel kämen und pickten sie auf, und am Geräusch des Pickens höre sie, wie viel Wasser noch drin sei.
»Sonja, bist du da?«, versuchte sie es wieder, »mach mir nur für einen Moment auf, ich bleibe auch nicht lang, ich muss zurück nach Tel Aviv.« Was hätte sie sonst noch sagen können, was hatte sie damals tatsächlich noch gesagt, um das Herz dieser Frau zu erweichen? Irgendwann hatte sie gehört, wie sie sich schlurfend der Tür näherte. Widerwillig drehte sich ein Schlüssel im Schloss. Dann erschien ihr aufgedunsenes Gesicht, das fettige Haar, der misstrauische schwarze Blick. Seine Mutter hatte sie noch nie gemocht. Vielleicht hatte sie gefürchtet, dass ihre Schwiegertochter, so schön und umworben, wie sie war, ihrem geliebten Spätling eines Tages das Herz brechen werde?
Aber da hatte sie sich geirrt. Er war es gewesen, er hatte sie plötzlich und ohne ein Wort verlassen. Er war es, der nicht auf ihre Briefe antwortete. Klammheimlich hatte er sein Weggehen geplant, und sie, in ihrer Arglosigkeit, hatte keinen Verdacht geschöpft. Sie hatte wohl gemerkt, dass ihn etwas umtrieb, dass er sich quälte, aber dass er aus ihrer Welt völlig verschwinden würde, damit hatte sie nicht gerechnet.
»Warum bist du hergekommen? Was willst du?«, fragte seine Mutter mit schwerem polnischen Akzent, der sich noch immer nicht abgeschliffen hatte, obwohl seit ihrer Ankunft aus Warschau schon Jahrzehnte vergangen waren. Auch für ihren Akzent und für ihre hartnäckigen Aussprachefehler hatte er sich geschämt. Sein Ivrith dagegen war brillant. Für einen Moment fürchtete sie, sie werde es nie wieder hören. »Was ich will? Meno sehen. Ist er zu Hause?« Und beinah hätte sie hinzugefügt, »und Suppe essen«, denn der Geruch riss in ihrem Magen ein Loch auf, und sie meinte, gleich ohnmächtig zu werden.
»Du kannst ihn nicht sehen«, stellte ihre Schwiegermutter mit sonderbarer Genugtuung fest, »er ist krank. Er hat gesagt, falls du kommen solltest, soll ich dich nicht reinlassen, auf keinen Fall.« Hinter ihr lag das große Zimmer, dunkel wie eine Höhle, dort stand neben dem Fenster mit den runtergelassenen Rollläden sein Bett, und sie strengte ihre Augen an. Sah sie da nicht eine Bewegung unter der Decke? War dies wohl der Fleck seines Kopfes auf dem Kissen?
»Er ist krank? Was hat er?« Ihre Stimme klang resigniert, sie hielt sich am Türrahmen fest, während seine Mutter ungeduldig antwortete: »Rachel, geh zurück nach Tel Aviv und komm nicht mehr hierher. Er kann dich nicht sehen.« – Hatte sie gesagt, er kann nicht oder er will nicht?
Plötzlich scheint es ihr ungeheuer wichtig, sich gerade an dieses Detail zu erinnern, vor allem jetzt, wo sie sich auf das bevorstehende Treffen vorbereitet. Hatte er nicht gekonnt, oder hatte er nicht gewollt? Doch was sie auf einmal noch mehr umtreibt, ist die Frage, warum sie die böswillige Türhüterin vor siebzig Jahren nicht einfach weggestoßen hatte und ins Zimmer gestürmt war. Wo sie doch viel jünger und stärker gewesen war als seine Mutter. Problemlos hätte sie sie überwältigen und sich auf sein Bett stürzen können. Wäre es ihr damals gelungen, zu ihm durchzukommen und mit ihm zu reden, hätte er seine Meinung vielleicht geändert und das schlimme Verdikt abgewendet.
Seitdem hat sie ihn wirklich nicht mehr gesehen, mit Ausnahme der knappen Stunde ein paar Monate später im Rabbinatsgebäude in der Jaffastraße; dort hatte er peinlichst darauf geachtet, in sicherer Entfernung von ihr zu sitzen und nicht ihrem Blick zu begegnen, und nach der demütigenden Zeremonie, als sie ihm noch ein paar Worte zum Abschied sagen wollte, war er mit schnellen Schritten einfach an ihr vorbei- und weitergegangen, und sie selbst hatte schweigend dort gestanden, an derselben Stelle, an der sie geheiratet hatten, und erst da hatte sie auf das Datum geschaut, 29. Tammus 1948, genau der Tag, an dem sie ein Jahr zuvor geheiratet hatten.
So viele Träume waren in jenem Jahr zerbrochen, von so vielen Neuanfängen war nichts geblieben. Sie seufzt, während sie jetzt kalte, glatte Pflaumen für ihre Besucherin wäscht, die sich bereits verspätet. Vor einer Stunde hat das Telefon geklingelt, und als sie die Stimme von Menos Tochter hörte, fürchtete sie einen Moment, sie wolle das Treffen absagen. Nur daran hatte sie gemerkt, wie sehr sie dieser Begegnung entgegenfieberte, einer Begegnung, zu der sie beinah gezwungen worden war und die sie mit allerlei Ausflüchten so lang wie möglich hinausgeschoben hatte.
Aber nicht, um das Treffen zu verschieben, hatte Atara sie angerufen, sondern um ihr zu sagen, dass sie im Stau stehe und sich etwas verspäten werde, und sie, die angespannt auf dem Sofa gewartet hatte, hatte die Pflaumen nach und nach selbst gegessen, und jetzt wusch sie drei weitere, um das kleine Schälchen wieder zu füllen.
Heute verspätet man sich wegen Staus auf der Autobahn, früher wussten wir nicht, ob wir überhaupt ankommen würden, grollt sie plötzlich, als sie sich an ihre Rückfahrt an jenem furchtbaren Tag aus Jerusalem erinnert. Dutzende verängstigter Fahrgäste hatten dicht gedrängt in dem Bus gesessen, die Oberkörper tief runtergebeugt aus Angst vor den arabischen Scharfschützen, die überall am Straßenrand lauern konnten, und nur sie hatte aufrecht dagesessen und auf die Kugel gewartet, die das Fenster neben ihr durchschlagen und sie in den Kopf treffen würde. Eine Kugel hätte gereicht, um sie von ihrem Leben zu trennen, und das erschien ihr damals noch hoffnungsloser als ihr Tod. Was sie nach dem Tod erwartete, wusste sie natürlich nicht, aber nachdem Meno sie verlassen hatte – Meno, Menachem, dessen Name doch immerhin »Tröster« bedeutete –, hatte sie in ihrem Leben keinen Trost mehr zu erwarten.
Doch gerade an diesem Tag waren die Scharfschützen ihnen gnädig gewesen, nicht ein Schuss wurde auf die Wagenkolonne abgefeuert, und als der Bus wohlbehalten in Tel Aviv ankam, fiel es ihr schwer auszusteigen. Sie wollte gleich wieder zurück nach Jerusalem, wieder die Treppen hinaufsteigen, an die Tür klopfen. Erst da begriff sie, sie hätte die Alte mit Gewalt wegstoßen müssen, dies war ihre letzte Chance gewesen. Warum nur hatte sie ihr gehorcht? Sie war so dumm gewesen wie der Mann vom Lande in der Erzählung Vor dem Gesetz, die Meno ihr einmal vorgelesen hatte. Doch niemand wusste, wann die nächste Kolonne wieder nach Jerusalem fuhr, und wie sie noch ratlos dastand, sprach ein junger Mann sie an, dessen Gesicht ihr bekannt vorkam, vermutlich war sie ihm schon mal in einer konspirativen Wohnung ihrer Untergrundgruppe begegnet. Er fragte sie, ob sie Hilfe brauche, und sie, die scheu war und zudem ihren Stolz besaß, hatte den Kopf geschüttelt und war ohnmächtig auf den kochenden Asphalt gesunken, und er hatte sie in die Arme geschlossen und nie mehr losgelassen.
So hatte es das Schicksal gewollt. Es hatte um diese Zeit keinen anderen Weg gegeben, nicht ins eingeschlossene Jerusalem und nicht zu Menos verschlossenem Herzen. Vielleicht hatte es ja auch sein Gutes gehabt, sie würde es niemals wissen. Aber wozu sich jetzt, nach siebzig Jahren, an all das wieder erinnern? Von sich aus wäre sie nie darauf gekommen, wäre da nicht diese Besucherin, die jeden Moment eintreffen musste.
Die fremde Frau hatte sie vor ein paar Monaten im Theater in der Pause bei den Toiletten angesprochen, und als sie ihr sichtlich ergriffen ihren Namen nannte, war es ihr vorgekommen, als sei dies eine Fortsetzung der Vorstellung, die nur irgendwie auf ein anderes Gleis geraten war. Wie haben Sie mich erkannt, hatte sie verstört und verärgert fragen wollen, wie haben Sie überhaupt von mir erfahren? Sie hatte ihren Söhnen ja nie von jener ersten Ehe erzählt, einer unreifen Ehe, bei der nichts herausgekommen und die nach genau einem Jahr geschieden worden war.
»Sie sind Rachel, nicht wahr?«, hatte die fremde Frau sie gefragt, beinah flehentlich. »Ich bin Atara Rubin, Menos Tochter, ich bin so froh, dass ich Sie gefunden habe.« »Meno« hatte sie gesagt, nicht Menachem und auch nicht Professor Rubin, als sei sie, Rachel, eine enge Freundin der Familie geblieben, und während sie sie musterte, staunte sie über den abwegigen Gedanken, dass diese Frau ihre Tochter hätte sein können.
Atara war hochgewachsen und dünn, wie sie selbst, und wirkte noch jung, zumindest viel jünger als ihre beiden Söhne. Meno musste sie in fortgeschrittenem Alter bekommen haben. Vielleicht waren es auch die Kleider und die Frisur, die ihr ein so jugendliches Aussehen verliehen – schwarze lange wilde Locken, enge Jeans, Stiefel –, denn es flimmerten durchaus schon Fältchen um ihre dunklen Augen, und die waren zwar so dunkel wie die ihrer Großmutter, die sie an jenem Morgen so grausam angefunkelthatten, aber angenehmer.
»Mein Beileid«, sagte Rachel schnell. Vor ein paar Monaten hatte sie in den Nachrichten gehört, dass Meno im Alter von einundneunzig Jahren gestorben war, vielleicht war es auch eine kleine Nachricht in der Zeitung über den Tod des angesehenen Wissenschaftlers gewesen, und seine Tochter hatte sich übertrieben herzlich bedankt und sofort gefragt, als wäre mit seinem Ableben bei ihr eine Schranke durchbrochen: »Wären Sie bereit, mir etwas über ihn zu erzählen? Darüber, was zwischen Ihnen gewesen ist?« Es war ihr schwergefallen, dem Drängen dieser Frau, die sie noch nie zuvor gesehen hatte, standzuhalten, und so wiederholte sie bereits nach wenigen Minuten ihre eigene Telefonnummer immer und immer wieder, denn der Kuli schrieb nicht, und das Handy, das sie für die Vorstellung abgeschaltet hatte, ließ sich nicht wieder zum Leben erwecken, so lange, bis Atara schließlich, beim Ertönen des dritten Klingelns, einen leuchtend roten Lippenstift aus der Tasche zog, den Ärmel ihres Pullovers hochschob und sich die Nummer auf ihren langen Unterarm schrieb. Wie Schnitte sahen die Ziffern aus, das hatte in ihr ein Unbehagen geweckt, und sie hoffte, die Nummer, die zu ihr führte, würde schnell verwischen und unlesbar werden, aber das passierte nicht. Bereits am nächsten Tag hörte sie aus dem Hörer Ataras begierige Stimme und erklärte ihr, sie müsse ausgerechnet heute zu einem medizinischen Eingriff, der natürlich auch ein paar Komplikationen machen könne, ins Krankenhaus.
Die Nummer ihres Handys hatte sie ihr nicht gegeben, und deshalb hörte sie erst, als sie nach Hause entlassen wurde, wieder diese Stimme, die sie sofort erkannte, und wieder wich sie aus, mit dem Argument, dass sie noch etwas angeschlagen sei, in der Hoffnung, die Frau würde von ihr ablassen. Was wollte sie von ihr? Warum erinnerte sie sich jetzt plötzlich an sie? Sie selbst hatte kein Interesse daran, sich noch einmal mit dieser alten Geschichte zu beschäftigen. Erst einige Wochen später erklärte sie sich bereit, einen ziemlich fernen Termin zu vereinbaren, und je näher der rückte, desto deutlicher spürte sie überrascht ihre wachsende Sorge, aber auch Hoffnung. Hoffnung worauf? Sorge weshalb? Was sollte sie ihr erzählen: Schweigend stand ich vor der geschlossenen Tür?
Zweites Kapitel:
Ich bin’s, Atara
Schweigend steht sie vor der geschlossenen Tür, wozu noch mal klingeln. Vor weniger als einer Stunde hat sie Rachel angerufen und sich entschuldigt, dass sie sich leider verspäte, und die hatte hörbar verärgert geantwortet, »kein Problem, ich erwarte Sie«, aber jetzt macht keiner auf. Hat die Verspätung sie dermaßen aufgebracht, oder bereut sie es vielleicht plötzlich? Sie hatte ihr das Treffen ja ziemlich aufgedrängt. Oder liegt sie tot hinter der Tür auf dem Boden oder wartet verzweifelt auf Hilfe? In ihrem Alter ist alles möglich. »Rachel!«, ruft sie und drückt aus irgendeinem Grund ihr Ohr an das Guckloch. »Ich bin’s, Atara. Sind Sie da? Alles in Ordnung bei Ihnen?« Wehe, wenn Sie jetzt hier sterben, fügt sie im Stillen hinzu, jetzt, wo ich Sie endlich gefunden habe.
Das Jaulen eines Kranken- oder Streifenwagens kommt näher, sie entfernt sich schnell ein paar Schritte, überquert die Straße und verschwindet im Eingang des gegenüberliegenden Hauses, als habe sie ein Verbrechen begangen – eine Greisin von neunzig Jahren überfallen und in überflüssige Nöte gestürzt, die ihr das Leben verkürzt haben. Zwar hatte Rachel bei ihrer vorgeblich zufälligen Begegnung im Theater alterslos gewirkt, absolut klar und selbstständig, noch nicht mal einen Stock hatte sie dabei und auch keinen Begleiter, doch seitdem sind Monate vergangen, und vielleicht hat sich ihr Zustand verschlechtert. Womöglich hat ja ausgerechnet heute früh, nach ihrem Telefonat, der Todesengel an ihre Tür geklopft und ist ihr um eine Stunde zuvorgekommen.
Das Jaulen entfernt sich wieder, erleichtert tritt sie auf die Straße hinaus, betrachtet die umwerfend schöne Landschaft hier und gleichzeitig dieses höchst unerfreuliche Viertel, das so gar keinen Charme besitzt, als habe ein blinder Architekt es binnen einer Nacht aus dem Boden gestampft. Plumpe, mit Steinplatten verkleidete Häuser stehen auf der rötlichen Wüstenerde, sie haben geschmacklose, völlig unsinnige rote Ziegeldächer, hier wird es garantiert nie schneien, wozu also diese steile Neigung? Und was hat ihr die Fahrt hierher jetzt gebracht? Zweieinhalb Stunden auf der Straße. Sie wird hier einen vollen Arbeitstag verlieren, ganz zu schweigen von den Mühen, die es sie gekostet hat, diese Frau ausfindig zu machen, die auf der Welt kaum Spuren hinterlassen hat – außer in ihrem Leben.
Was soll sie jetzt tun? Sie steigt ins Auto, schaltet die schlappe Klimaanlage an und versucht es noch mal telefonisch. »Papas Rachel« (so hat sie sie in ihrer Kontaktliste abgespeichert) antwortet nicht. Vielleicht ist sie auch nur eingeschlafen, das kommt bei alten Leuten ja vor. Sogar Alex passiert das in letzter Zeit immer wieder, auch wenn er es nicht zugibt. Hast du geschlafen?, fragt sie ihn dann, wenn sie seine schläfrige Stimme hört, doch er streitet sofort ab: Ich? Ich doch nicht. Ja, ihn wird sie jetzt anrufen. Gerade in solchen Situationen kann er sie ganz gut beruhigen. Selbst wenn es schwierig zu definieren ist, was genau solche Situationen sein sollen, wo sie doch noch nie in ihrem Leben in einer solchen Situation gewesen ist. Aber Spannungen, die nichts mit ihm zu tun haben, kann er ganz gut lindern; Probleme, die nicht er geschaffen hat und die nicht er lösen muss. »Sunny, stell dir vor, noch vor einer Stunde hab ich mit ihr telefoniert, und jetzt antwortet sie nicht auf meine Anrufe und macht auch die Tür nicht auf. Meinst du, ihr ist was passiert? Oder dass sie es bereut? Soll ich noch warten oder die Sache aufgeben?«
»Das überrascht mich gar nicht! Warum fragst du mich, wenn du mich dann eh ignorierst? Ich habe dir gleich gesagt, du sollst das lassen, aber auf mich hörst du ja nicht, du hast dich mit dieser Frau da in eine Obsession verrannt und bist nicht mehr zu halten gewesen. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum du sie überhaupt suchst und warum erst jetzt.«
»Was gibt’s da groß zu verstehen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass diese Beziehung für ihn so bedeutungsvoll gewesen ist. Dass diese Frau sein Leben zerstört hat und inzwischen auch meins.«
»Ach, ich dachte, ich hätte dein Leben zerstört.« Er zieht es wie immer vor, das Gespräch in die gewohnten Bahnen zu lenken, und sie lacht bitter. »Klar, zuerst mein Vater, dann du«, und er spielt seinen Part weiter: »Bloß gut, dass es dazwischen genügend Männer gab, die dir Gutes getan haben.«
»Jetzt mach mal halblang, so viele waren es gar nicht.« Sie hört, wie sie sich verteidigt. Wie leicht lässt sie sich von ihm immer wieder dort hinziehen, auf ihren gemeinsamen Tummelplatz halb eingebildeter Verdächtigungen, halb befriedigter Bedürfnisse, halb zerstörter Hoffnungen – lauter zerbrochenes Spielzeug –, und doch der einzige Ort, an dem die Zeit da stehen geblieben ist, wo ihre Leben fest zusammengeschweißt wurden, ihr Verlangen, ihre Schuld, ihre betrogenen Lebenspartner, ihre verwirrten Kinder – er mit seinem Sohn, sie mit ihrer Tochter. Wie jung waren sie gewesen, vor allem sie selbst, noch keine dreißig. Alex war, zugegeben, nicht mehr ganz so jung gewesen, dreizehn Jahre älter als sie und auch als der Mann, den sie für ihn verlassen hat, was seinem Zauber aber keinen Abbruch tat, im Gegenteil. Erst in den letzten Jahren macht ihr dieser Unterschied zu schaffen, denn er wird grimmiger, starrköpfiger und ungeduldiger, aber vielleicht ist er schon immer so gewesen, und sie ernüchtert eben nur ein bisschen spät?
»Du hast genügend Kerle gehabt, aber alle haben dich letztlich aufgegeben, nur ich nicht. Nur ich bin geblieben.« »Mein Beileid, lieber Gatte! Übrigens, die Klimaanlage liegt in den letzten Zügen. Wann bringst du den Wagen endlich in die Werkstatt?« »Ich kann mir nicht die Tage in der Werkstatt um die Ohren schlagen, der Wagen ist zwanzig Jahre alt, Atara! Hättest du nicht das ganze Geld für den Privatdetektiv rausgeschmissen, hätten wir längst einen neuen.«
»Und ich kann das nicht mehr hören. Also, ich bleib dann erst mal hier. So schnell gebe ich nicht auf. Sag, ist Eden schon aufgestanden?« »Das fragst du wirklich? Ist er in letzter Zeit je vor vier Uhr nachmittags aus dem Bett gekommen?« Sie seufzt. »Was ist bloß mit ihm los? Das geht schon bald einen Monat so.«
»Ich habe dir von Anfang an gesagt, dieses Abenteuer wird nicht gut ausgehen«, brummt er, »ich habe gewusst, das ist nichts für ihn. Es passt doch nicht zu ihm, den Ninja zu spielen. Wie könnte eines unserer Kinder ein Ninja sein? Er hat mit dieser Entscheidung gegen seine Intuition gehandelt, und jetzt zahlt er dafür.«
»Hör doch auf mit deinen Provokationen! Im Marinekommando zu dienen, das nennst du ein Abenteuer? Du solltest stolz auf ihn sein!« »Auf ihn bin ich schon stolz, aber nicht auf mich. Ich hätte das verhindern müssen. Verzeih bitte, dass ich bei eurer Vergötterung von Heldentum und heroischen Taten nicht mitmache.«
»Ist ja gut. Die alte Leier«, unterbricht sie ihn, »vielleicht versuchst du trotzdem mal, mit ihm zu reden?« Und er: »Atara, ich will von dir keine Handlungsanweisungen. Ich jage ihm nicht hinterher wie du. Wenn er mich braucht, weiß er, wo er mich findet.«
»Vielen Dank, wirklich, du warst mir eine große Hilfe«, zischt sie. Warum hat sie ihn überhaupt angerufen. Wann hat sie das letzte Mal ein erfreuliches Gespräch mit ihm geführt, und was soll jetzt dieser kritische Ton gegenüber ihrem einzigen gemeinsamen Sohn, ihrem »Garten-Eden-Sohn«, der ihnen vom Tag seiner Geburt an dermaßen viel Freude und Stolz bereitet hat. Auch sie versteht nicht, was plötzlich mit Eden los ist. Nachdem er die schwerste Phase in der Armee hinter sich gebracht und dabei ungewöhnliche und auch unerwartete Zähigkeit bewiesen hatte, nachdem er das aufreibende Training durchgestanden hatte, bei dem jeder Tag schlimmer war als der zuvor, ganz zu schweigen von den Einsätzen, die dann kamen, über die er natürlich nicht reden durfte, und sie haben wirklich nicht das Geringste darüber erfahren, nicht vorher und nicht hinterher, haben manchmal nur an seinem hohlen Blick ahnen können, wo er gewesen war – an einem Ort, an dem es keinen Tag und keine Nacht gab, kein Zweifeln und kein Fragen, an dem einzig und allein die Mission galt, deren Heiligkeit sogar die Heiligkeit seines eigenen Lebens außer Kraft setzte. Ein Ort, an dem dieser geliebte Körper, der in ihrem Leib Zelle um Zelle entstanden und danach begleitet von Hoffnung und Sorge herangewachsen war, zu einer perfekten, gigantischen Kampfmaschine gemacht wurde und trotzdem so verletzlich blieb wie der eines Babys. Diese Verwundbarkeit hatte sie Nacht für Nacht verflucht, in ihren Albträumen hatte sie ihn erschossen auf dem Meeresboden liegen sehen oder zitternd gefangen in einem Fischernetz.
Und nach alldem, nach fast vier Jahren – der Tag seiner Entlassung rückte näher, die Spannung ließ etwas nach, er begann schon, eine große Reise zu planen und an die Zukunft zu denken – war er völlig überraschend eines Tages mitten in der Woche nach Hause gekommen und hatte sich geweigert zu erzählen, was passiert war, und seitdem schließt er sich die meiste Zeit in seinem Zimmer ein, schläft tagsüber und ist nachts wach, weist alle ihre Angebote zurück, darüber zu reden, zuzuhören, ihm zu helfen.
Aber sie ist heute nicht in diese künstliche und umstrittene Stadt im Osten Jerusalems gefahren, um über die Zukunft nachzudenken, sondern weil sie etwas über die Vergangenheit erfahren will, über die Vergangenheit eines Mannes, den sie eigentlich nicht gekannt hat, obwohl sie seinem Samen entstammt und mit ihm in einem Haus gelebt hat. Er hatte ihr am Ende seines Lebens einige wenige Dinge gesagt, die ihr seitdem keine Ruhe lassen und darauf drängen, geklärt zu werden, und es gibt auf der Welt nur eine Frau, die das für sie tun kann. Seit Monaten versucht sie, an sie heranzukommen, und jetzt, wo sie es endlich geschafft hat, findet sie ihre Tür verschlossen.
»Bist du das? Endlich bist du gekommen!«, hatte ihr Vater laut gerufen, als sie an jenem Morgen vor einem Jahr an sein Bett trat, es war eines der wenigen Male, wo sie sich bereit erklärt hatte, für ihre Schwester einzuspringen, die sich mit Hingabe um ihn kümmerte, und er hatte ihr mit einem staunenden und glücklichen Lächeln die Arme entgegengestreckt. »Du hast es geschafft, aus Tel Aviv hierher durchzukommen? Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich habe all die Jahre auf dich gewartet!«
»Ich bin aus Haifa gekommen, Papa«, hatte sie ihn schnell korrigiert, sich auf den Stuhl an seinem Bett gesetzt, und er hatte seine zitternde Hand zu ihrem Gesicht gestreckt, ihre Haut befühlt und gesagt: »Du bist so schön«, und sie hatte überrascht gelacht: »Das hast du mir nie gesagt«, und in ihrer Dummheit auf die Wärme reagiert, die er ausstrahlte.
»Siehe, meine Freundin, du bist schön! Siehe, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead«, hatte er ihr zärtlich zugeflüstert, »ich habe dich nie betrogen, Rachel, ich habe keine andere Frau gehabt, so wie ich es dir versprochen habe«, und erst da begriff sie, zog ihr Gesicht weg und ließ seine Hand in der Luft hängen, angewidert von dem Gedanken, dass ihr Vater sie begehrte, angewidert auch stellvertretend für ihre Mutter, die er ihr Leben lang betrogen hatte, ohne dass sie es wusste.
»Komm näher. Hab keine Angst, du musst dich vor nichts mehr fürchten«, protestierte er, seine Stimme versagte, das hagere Adlergesicht verzog sich enttäuscht, und in seinem feierlichen Ivrith fügte er hinzu: »Alles, was ich habe, ist dein. Alles, was ich nicht habe, ist dein. Verzeih mir, Rachel. Mit meinen eigenen Händen hab ich unser Grab geschaufelt.« Und sie sagte: »Papa, ich bin nicht Rachel, ich bin deine Tochter«, doch er schüttelte den Kopf, wurde dann plötzlich zornig und wetterte: »Lüg mich nicht an!« Seine Stimme schlug um, vom einen ins andere Extrem, seine bohrenden grauen Augen nagelten sie wutentbrannt fest, und diesmal wusste sie nicht, an wen diese Schelte gerichtet war, denn oft hatte er sie verdächtigt, dass sie ihn anlog.
Sie sprang auf, stand an seinem Bett und zögerte, denn ihre alte Neugier war wieder entflammt. Welchen Sinn hatte es, ihn zu korrigieren? War es nicht besser, so zu tun, als ob sie wirklich seine erste Frau war? Und sie näherte sich ihm und nahm seine Hand. »Ich bin zu dir zurückgekehrt, Meno«, sagte sie mit verstellter Stimme, doch da schüttelte er ihre Hand mit überraschender Kraft ab. »Verschwinde«, schrie er sie an und machte eine abwinkende Handbewegung in ihre Richtung, »verlass mich, wenn dir dein Leben lieb ist!«, und sie ging tatsächlich, obwohl sie extra aus Haifa nach Jerusalem gekommen war, um an dem Tag, an dem sein Pfleger freihatte, bei ihm zu sein, und obwohl sie ihrer Schwester versprochen hatte, bis zum Abend bei ihm zu bleiben.
Sie stürmte hinaus, knallte die Tür zu und setzte sich auf den Treppenabsatz unter den Mispelbaum. Schon in ihrer Kindheit hatte sie hier stundenlang gesessen, weil ihr Vater die Tür abgeschlossen hatte und sie nicht reinließ, wenn sie zu spät nach Hause kam oder bei einer Klassenarbeit keine befriedigende Note heimbrachte, wenn er ihr etwas gesagt und sie nicht zugehört hatte, wenn sie nicht absolut still gewesen war, während er arbeitete. Dann hatte sie draußen auf der Treppe unter dem Baum gesessen und gewartet, dass sein Zorn verflog. Manchmal zitternd vor Kälte, hungrig und durstig, hatte sie neidisch die Ameisen betrachtet, die eilig zu ihrem Nest liefen, und die Schnecken, die neben ihr die Steinwand hinaufkrochen, wobei das Haus auf ihrem Rücken schwankte.
Schon sonderbar, bei diesem letzten Besuch hatte sie sich wieder an derselben Stelle befunden wie als Kind, es schien, als habe sich überhaupt nichts verändert. Die Schatten der Blätter ließen die Mauern erzittern, Zypressenwipfel überragten schwarz die Wasserbehälter neben den Sonnenkollektoren auf den Dächern, Gesprächsfetzen, das Knarzen der Wäscheleinen, der graue Eindruck fast identischer Steinhäuser. In diesem Viertel kannte sie jeden Hof und jeden noch so kleinen Weg, jedes Fenster, jeden Vorhang. Stundenlang hatte sie hier gesessen und gewartet, war ab und zu die Treppe hinaufgegangen, hatte an die Tür oder ans Küchenfenster geklopft und ihr Glück versucht. Eines Abends hatte sie ihre Eltern durchs Fenster gesehen, wie sie am Tisch saßen, aber sie schauten nicht zu ihr, während ihre jüngere Schwester mit vollem Mund kauend sich alle Mühe gab, ihr triumphierendes Lächeln zu verbergen.
Widerwillig hatte sie Roni angerufen, um ihr zu sagen, dass sie ging. Sie wusste, eine Moralpredigt war unausweichlich. »Ich hatte keine Ahnung, dass er so verwirrt ist, er hat mich gar nicht erkannt!«, sprudelte es aus ihr heraus, und ihre Schwester sagte: »Merkwürdig, mich erkennt er immer. Hast du ihm seine Medikamente gegeben?«
»Dazu bin ich gar nicht gekommen«, antwortete Atara, »er hat mich gleich angeschrien, da bin ich abgehauen«, und ihre Schwester erwiderte: »Unfassbar! Was kann so ein alter Mann dir schon tun?« Atara seufzte. »Ich kann nicht mit ihm allein sein, meinetwegen wart ich hier auf der Treppe, bis du kommst, aber da geh ich nicht noch mal rein.«
»Du bist doch kein kleines Mädchen mehr! Wie verantwortungslos von dir, ihn so allein zu lassen. Wenn er heute stirbt, dann hast du das auf dem Gewissen«, schimpfte ihre Schwester, und sie sagte: »Keine Sorge, so schnell stirbt einer nicht. Er hat noch eine Menge Kraft in den Armen, richtig weggestoßen hat er mich.« Zu ihrer Überraschung entließ ihre Schwester sie ziemlich schnell: »Okay, dann versuche ich, jemanden zu finden, der dich ablöst.«
»Warte, noch einen Moment, Roni«, unterbrach sie sie, »nicht nur, dass er mich nicht erkannt hat. Er hat gedacht, ich sei seine erste Frau! Wusstest du, dass er sein Leben lang auf sie gewartet hat?« Und ihre Schwester sagte: »Quatsch, wie kommst du denn darauf. Was hat er dir gesagt?«, und Atara wiederholte, noch immer fassungslos, was ihr Vater zu ihr gesagt hatte. »Und es waren nicht nur seine Worte. Das war eine Stimme, die ich noch nie von ihm gehört habe. So weich und liebevoll. Ich wusste nicht, dass er überhaupt lieben kann.«
»Natürlich kann er das«, sagte ihre Schwester, »ich habe nie an seiner Liebe gezweifelt.« Atara konterte spöttisch: »Freut mich für dich, wirklich!«, stand auf und ging eilig zu ihrem Wagen, bevor sie es bereuen würde. Auch zwischen ihr und ihrer Schwester hat sich seit früher nichts verändert. Nacht für Nacht hatten sie in dem gemeinsamen Zimmer Kopf an Kopf gelegen; ihre Schwester hatte sie weinen gehört und die Verständnisvolle gemimt, ihr in Wirklichkeit aber dauernd Gift eingeflößt.
»Vielleicht bist du überhaupt ein Stiefkind«, hatte sie ihr ins Ohr geflüstert, während Atara ihren warmen Atem spürte und den Mentholgeruch der Zahnpasta roch, oder sie hatte mit gespielter Trauer zu ihr gesagt: »Du siehst ja auch ganz anders aus. Wenn du wie Mama und ich aussehen würdest, hätte er dich vielleicht lieber.« Mutter und ihre Schwester waren hell und mollig und hatten glattes Haar, sie dagegen war dunkel, kantig und hatte schwarze Locken. Vielleicht ist das wirklich die Erklärung, hatte sie manchmal gedacht. Tatsache ist, dass er sie bei seinen Wutausbrüchen immer an den Locken packte.
Einmal hatte ihre Schwester ihr nachts erzählt, sie habe gehört, wie ihre Mutter mit Onkel Rubi in der Küche flüsternd über eine Frau geredet habe, die Vater früher mal hatte, und Roni hatte sie beschworen, nie darüber zu sprechen, doch Atara brach ihren Schwur bei der ersten Gelegenheit, als sie mit Mutter alleine zu Hause war. »Wer war die erste Frau von Papa?«, fragte sie ohne Umschweife, und Mutter wurde bleich. »Wer hat dir das erzählt? Das darfst du nicht wissen! Darüber darfst du nicht sprechen, nie wieder!«
»Was weißt du über sie? Wie hat sie ausgesehen?« Sie fragte weiter, ignorierte die Not ihrer Mutter, so wie ihre Mutter ihre Nöte zu ignorieren pflegte. Sie war damals gerade mal dreizehn gewesen, erinnert sich aber bis heute genau an dieses Gespräch. Es hatte im elterlichen Schlafzimmer stattgefunden, das war groß und dunkel wie eine Höhle, und ihre Mutter sagte: »Das erzähl ich dir, wenn du groß bist, das versprech ich dir, aber du musst mir schwören, dass du Papa nichts davon sagst.«
»Das schwöre ich nur, wenn du mir jetzt alles erzählst, was du über sie weißt«, hatte Atara gesagt, »sonst sage ich ihm, dass du mir von ihr erzählt hast, und dann bist du dran!« Ihre Mutter schaute sie entsetzt an, doch dann trat sie ans Bücherregal und holte ein vergilbtes Heftchen heraus, es hieß Die Freiheitskämpfer Israels oder etwas in der Art. Auf jeder Seite war ein Schwarz-Weiß-Foto, und ihre Mutter blätterte schnell, bis sie das richtige fand, und reichte ihr schweigend das Bild eines wunderhübschen jungen Mädchens; es hatte ein langes, aristokratisches Gesicht, dunkles, lockiges Haar und Mandelaugen mit einem sehr ernsten Blick, und Atara betrachtete es wie hypnotisiert und schüttelte verständnislos den Kopf. Diese junge Frau kam ihr bekannt vor, sie war ihr ähnlich, obwohl sie selbst längst nicht so schön war. Wäre sie so schön, würde sie bei Klassenfesten nicht immer am Rand stehen; vielleicht war das eine Schönheit aus schwereren, vergangenen Zeiten, als die Frauen ernst und traurig waren, nicht so wie jetzt, wo man von dir erwartet, locker und fröhlich zu sein.
»Warum haben sie sich scheiden lassen?«, fragte sie, und ihre Mutter sagte: »Keine Ahnung, Papa redet darüber nicht. Onkel Rubi hat mir mal erzählt, sie habe ihn verlassen, und er habe lange gebraucht, darüber hinwegzukommen. Aber was ändert das schon.« Sie klang besorgt und zuckte mit den Schultern, schaute sie dann misstrauisch an und sagte: »Aber kein Wort davon, nicht wahr?«
»Wo ist sie jetzt? Was macht sie?«, fragte Atara weiter, und ihre Mutter schaute ängstlich zur Tür. »Keine Ahnung! Sie hat bestimmt geheiratet und Kinder, so was eben. Vielleicht ist sie auch schon tot. Du wirst ihm nicht sagen, dass ich dir das erzählt habe, nicht wahr?«
»Schau mal, sie ist mir ein bisschen ähnlich«, sagte Atara, »vielleicht hasst er mich deshalb so«, doch ihre Mutter tat diese Beobachtung mit einer Handbewegung ab. »Unsinn, ich sehe da keine Ähnlichkeit, und er hasst dich auch nicht. Du tust einfach nur alles, um ihn zu verärgern. Du musst mehr Rücksicht nehmen.«
»Alles, was ich mache, ärgert ihn«, protestierte Atara, »sogar wenn ich atme.« Und ihre Mutter sagte: »Dummes Zeug, sei einfach vorsichtiger, und du wirst sehen, es zahlt sich aus«, und entriss ihr das Heftchen. »Geh, mach deine Hausaufgaben. Wenn du gute Noten heimbringst wie deine Schwester, wird er sich weniger über dich ärgern.« Atara wartete, bis ihre Mutter rausgegangen war, öffnete die Tür des Kleiderschranks, auf dessen Innenseite ein großer Spiegel hing, und betrachtete sich konzentriert, sie zog sich Schlitzaugen, verteilte die Locken genau so auf ihren Schultern wie auf dem Foto, das sie nie wiedersehen sollte.
Noch am selben Abend ging sie heimlich zu dem Regal und stöberte zwischen den Büchern, aber das Heftchen war nicht mehr dort, und als sie ihre Mutter fragte, tat die überrascht und stritt jede Beteiligung an dessen Verschwinden ab. »Lügnerin«, hatte Vater bei seinen Wutanfällen der Mutter ab und zu entgegengeschmettert, und sie hatte ihn angefleht: »Was willst du von mir, ich schwöre dir bei den Mädchen, dass ich nicht lüge«, doch für sie hatte es so ausgesehen, dass Vater manchmal durchaus recht hatte. Sie zweifelte nicht daran, dass ihre Mutter sie angelogen hatte, vermutlich hatte sie das Heftchen beseitigt, denn auch viele Jahre später, als sie nach dem Tod der Mutter deren Sachen aus dem Haus räumte, konnte sie es nicht finden.
»Willst du zwischen Vater und mir Zwietracht säen?«, hatte Mutter zornig geflüstert, als sie das Thema ein paar Tage später wieder aufbringen wollte. »Soll ich bereuen, dass ich dir das überhaupt erzählt habe? Vergiss es, lass diese Geschichte ruhen, sie hat nichts mit dir zu tun!« Und sie hatte tatsächlich davon abgelassen und die Sache aufgegeben. Heute hat sie den Eindruck, dass ebendieses Gespräch damals ihre Kindheit besiegelt hat; schon bald war sie in die Wogen einer stürmischen Pubertät geraten, hatte sich von den Eltern, so weit sie nur konnte, entfernt und später nie mehr versucht, sich ihnen wieder anzunähern. Nach der Heirat mit Doron hatte sie sich am Technion zum Masterstudium eingeschrieben, war erleichtert aus Jerusalem weggezogen und hatte in all den Umwälzungen ihres Lebens keinen Raum für ihre Eltern gelassen, die sie ohnehin nicht vermissten. Ihr Vater war wie immer in seine Forschung vertieft, ihre Mutter in die Mühsal, an seiner Seite zu überleben; nur als Krankheiten und Alter sie befielen, musste sie sie ab und zu besuchen, doch sie bewahrte eine geradezu förmliche Distanz zu ihnen, auch innerlich.
Erst nach dem Tod ihrer Mutter, als sie der nicht mehr schaden konnte, hatte sie es gewagt, ihren Vater nach seiner ersten Frau zu fragen. Es war am letzten Tag der Trauerwoche, sie warfen gerade das Pappgeschirr und das übrig gebliebene Essen weg, und er hatte sie mit seinem kalten Blick, der einen erstarren ließ, festgenagelt: »Wer hat dir davon erzählt? Das ist eine furchtbare Verleumdung! Ich dulde keine Fragen zu diesem Thema, niemals, hörst du?« Atara hatte stumm genickt, sein Blick verbannte sie im Nu wieder in das Gefängnis ihrer Kindheit, als sie nirgendwohin fliehen konnte vor seinem Zorn, und sie hatte gestaunt, dass ihre Feindschaft ihm gegenüber mit den Jahren nicht abgenommen hatte; sie hatte sie wohl nur an den Rand ihres Lebens gedrängt, ebenso wie die Tatsache der Existenz jener unbekannten Frau, der sie, so hatte es ihr Los gefügt, auf irgendeine unerklärliche Art ähnelte – und vielleicht war das alles überhaupt Einbildung.
Wäre ich doch bei ihm geblieben und hätte weiter so getan, als ob ich Rachel wäre, denkt sie jetzt, wovor hatte sie sich so gefürchtet? Er hatte ihr doch nichts mehr antun können. Wieder kam die Erinnerung an den brennenden Schmerz des Schädels, ein Schmerz, der bei ihr immer das furchtbare Verlangen geweckt hatte, er möge sterben. Das war ihr steter Wunsch gewesen, wenn sie eine Sternschnuppe sah oder die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen ausblies. Sie hatte ein besonderes Gebet, das sie jeden Abend mit gefalteten Händen sprach.
»Guter Gott, nimm ihn zu dir oder lehr’ ihn lieben!« Sie hört, wie sie dieses Gebet am Steuer wiederholt, und hält sich die Hand vor den Mund. Was ist denn mit ihr los? Er ist doch schon tot, schon fast ein Jahr, und er starb nicht, wie du gefürchtet hast, weil du ihm an diesem Tag seine Medikamente nicht gegeben hast. Er ist erst einige Wochen später gestorben, und Roni ist an seiner Seite gewesen.
Sie selbst hatte ihn nicht noch einmal besucht, und er hatte Rachel nicht mehr erwähnt, so als seien seine Worte tatsächlich für sie, seine Erstgeborene, bestimmt gewesen oder eigentlich für jene Frau, nach der sie nun seit seinem Tod sucht.
Jetzt ruft sie Rachel noch ein letztes Mal an, und wenn sie nicht abnimmt, fährt sie nach Hause. Wie lang soll sie noch warten. Schon eine Stunde sitzt sie in dem viel zu heißen Auto, ihre Gedanken wandern zwischen den Zeiten, ihre Augen starren auf die Hausfront, auf die Stelle, wo der nackte Beton an die Steinverkleidung stößt. Schon kehren Kinder in lärmenden Gruppen von der Schule zurück, die Straße belebt sich. Ein Auto, das noch abgewrackter aussieht als ihr eigenes, hält mit quietschenden Bremsen hinter ihr, und ein älterer ultraorthodoxer Mann von großer Statur, der trotz des Chamssin einen langen schwarzen Mantel und einen schwarzen Hut trägt, steigt aus, überquert die Straße und geht eilig die paar Meter zum Eingang des Gebäudes, und sie springt aus dem Wagen, verfolgt, wohin er geht, und sieht, dass er einen Schlüssel aus der Tasche zieht und drinnen problemlos die Wohnungstür öffnet, an die sie vergeblich geklopft hat.
Vielleicht ist er der Rabbiner, den man zur letzten Beichte gerufen hat, überlegt sie in Panik, aber das ist doch gar kein jüdischer Brauch, und auch die Männer der Beerdigungsbruderschaft kommen nicht zu Sterbenden ins Haus, und überhaupt, warum besitzt er einen Schlüssel, es muss ihr Sohn oder ein anderer naher Verwandter sein, der verständigt wurde. Aber kann es sein, dass sie einen ultra-orthodoxen Sohn hat? Der von ihr beauftragte Privatdetektiv hat dieses Detail nicht erwähnt, es tut im Grunde auch nichts zur Sache, und trotzdem hat sie jetzt das Gefühl, dass seinetwegen ihre letzte Chance platzt.
»Ein Privatdetektiv?« Sie erinnert sich, Alex hatte nicht schlecht gestaunt. »Das bisschen Geld, das wir haben, hast du für einen Privatdetektiv rausgeschmissen? Wie hast du den überhaupt gefunden? Das geht ja wohl nicht, oder?«, und sie hatte gesagt: »Das geht vor allem dich nichts an. Anders hätte ich sie nie gefunden!« Erst später war klar geworden, dass das Aufspüren von Rachel noch das kleinste Problem gewesen war. Die vermeintlich zufällige Begegnung im Jerusalem Theater, die auf natürliche Weise zu diesem Besuch hatte führen sollen, hatte nicht schnell genug die erwarteten Früchte getragen, und dies war jetzt wohl die endgültige Abfuhr. Was für ein unglückliches Timing.
Er ruft jetzt bestimmt einen Krankenwagen, gleich wird man sie auf der Bahre heraustragen, und sie wird der Toten mit ihrem Blick das letzte Geleit geben und ihre Begierde, zu wissen, zu verstehen oder zu vergeben, begraben müssen. Natürlich eine abstruse Begierde, wie Begierden meistens, denn was ändert das jetzt noch, ein Jahr nachdem ihr Vater gestorben und sie selbst fast fünfzig ist. Es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen dieser Frau und dem, was ihr von ihrem eigenen Leben noch bleibt, und trotzdem steht sie weiter dort in der sengenden Sonne und gibt noch nicht auf. Vielleicht hat sie noch eine letzte Chance, vielleicht muss sie ihm folgen, so lange klingeln, bis die Tür geöffnet wird.
Drittes Kapitel:
Wenn Rachel überlebt, soll sie meine Frau werden
Sie war hinter Meno hergegangen, als der Tag erwachte und die Sonne hinter den Bergen Moabs plötzlich emporstieg. Er hatte sie nicht bemerkt, er kletterte den Berg Asalsel hinauf zu der atemberaubenden Stelle, an der sich einem auf einen Schlag die ganze Wüste darbietet, so als sei sie in dieser Nacht neu geboren. Erst als im Getöse prasselnder Felsbrocken die Erde sie verschlang, hatte er sich umgedreht. Wie eine Ziege war sie den Abhang hinuntergerollt, wie jener Sündenbock, den man früher an Jom Kippur genau an dieser Stelle ins Wüstland schickte, damit er die Sünden des Volkes Israel sühnte.
Später hatte Meno ihr erzählt, wie er auf die Straße gerannt war, um Hilfe zu holen. Neben ihm schnaufte einer der anderen, die an ihrem Waffentraining der Lechi teilgenommen hatten, sie liefen um die Wette, wem es als Erstem gelingen würde, Rachel zu retten; es war ein Wettstreit um sie. Erst da habe er gemerkt, dass er sie liebe, mitten in den glühend heißen Salzebenen. Wenn Rachel überlebt, soll sie meine Frau werden, und ich werde keine andere Frau neben ihr haben, hatte er sich geschworen und war so schnell gerannt, dass er fast meinte abzuheben, rechts von ihm lag in tiefer Bewusstlosigkeit das Tote Meer, links ragten die hohen Felswände auf.
Soll sie ihr davon erzählen? Oder von jenem Abend, an dem sie beide das erste Mal nach ihrer Genesung im Stadtzentrum des unter britischem Mandat stehenden Jerusalems spazieren gegangen waren, wie die lärmende Menschenmenge sie zu verschlingen drohte und sie auf der Treppe, die hinunter zum Café City führte, Zuflucht fanden. Sie saßen in den schweren Sesseln des Kellerraums, über sich bleiche elektrische Kerzen, und unterhielten sich ungezwungen. Da spürten sie plötzlich, wie viele Augen sie anschauten. Die anderen Gäste des Cafés sprachen so gut wie kein Wort. Sie bekam Angst, als sie merkte, dass es alles Fremde waren. Britische Offiziere vom Nebentisch musterten sie ab und zu mit arrogantem Blick, und am Tisch ihnen gegenüber, auf der anderen Seite des Gangs, saßen junge Araber, fein gekleidete Städter mit Krawatten und schwarzem Haar, das von Brillantine glänzte. Deren hasserfüllte und gleichzeitig begehrliche Blicke zerschnitten ihren Gesprächsfaden. Vergeblich versuchten sie wieder anzuknüpfen, als sei nichts passiert. Sie wollten das Café nicht verlassen, damit ihr Aufbruch nicht als Flucht gedeutet würde.
»Vielleicht gehen wir doch lieber«, hatte sie schließlich vorgeschlagen, und Meno knurrte: »Sollen doch die verschwinden«, stand aber trotzdem auf und ging bezahlen. Als er an den Arabern vorbeiging, wandte sich einer in sehr gespreiztem Englisch an ihn, nannte ihn Sir und versuchte, ihn aufzuhalten. Die britischen Offiziere, die vor großen Biergläsern mit hohen Schaumkronen saßen, lachten laut, klopften sich mit ihren kurzen Schlagstöcken auf die Schenkel, und die braunen Lederriemen über ihren vorbildlich gebügelten Hemden spannten sich stramm.
»Die werden schon noch abziehen«, hatte er gebrummt, als sie auf die Straße entkommen waren, und sie fragte nach: »Wer, die Araber?«, und er antwortete: »Nein, die Briten. Mit den Arabern können wir in Frieden leben«, und sie sagte: »Freut mich, das aus deinem Mund zu hören. Ich glaube dir, was du sagst.« Dann murmelte er lachend, gleichsam zu sich selbst: »Ich beginne, die Nöte unsres Stammvaters Avraham zu verstehen. Es ist wirklich nicht leicht, mit einer so schönen Frau herumzuziehen, und schon gar nicht unter Fremden, unter den Herren des Landes und seinen Bewohnern.«
»Dann gib mich doch als deine Schwester aus, wie Avraham es getan hat«, sagte sie, indem sie sich an ihn schmiegte, zeigte auf ihre Spiegelbilder im Schaufenster eines Hutgeschäfts, »schau doch, wie ähnlich wir uns sind«, und fügte hinzu, »ich würde mich freuen, wenn du mir einfach sagen würdest, dass ich schön bin«. Da hatte er ihr, ohne sie zu berühren, ins Ohr geflüstert: »Siehe, meine Freundin, du bist schön! Siehe, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead.«
Soll sie ihr das erzählen? So viele Erinnerungen prasseln plötzlich auf sie ein. Ein Getöse von Felsbrocken, extrem lebendig, eingebrannt in eine andauernde Gegenwart. Gegen ihren Willen spürt sie jetzt in den Rückenwirbeln den Aufprall ihres Sturzes zwischen den Felsen, seine wohltuenden Worte auf der Haut ihres Gesichts, die Wucht der Offenbarung ihrer beginnenden Liebe.
Sie steht aus ihrem Sessel auf, schwankt etwas, geht ins Schlafzimmer, öffnet den Kleiderschrank, starrt verlegen in die dort hängenden Kleider und vergisst für einen Moment, was sie sucht. Es ist unlogisch, sie wird es hier nicht finden. Schon vor Jahrzehnten hat sie das rote Kleid mit den gelben Blumen weggeworfen, zusammen mit allen anderen Beweisen, die niemanden etwas angingen und für die sich, ehrlich gesagt, auch keiner interessierte. Nicht ihre geliebte Mutter, zu deren Beerdigung sie nicht einmal hatte gehen können, nicht ihren Vater und ihren Bruder, die ihr die Jahre im Untergrund nie verziehen haben, und schon gar nicht ihren Mann, der hatte sie sogar ausdrücklich gebeten, ihm nichts von ihrer ersten Liebe zu erzählen. In jenen Jahren, in denen das Land seine Gefallenen noch beklagte, wäre sie nie auf die Idee gekommen, darüber zu reden. Die Besten deiner Generation, die Besten deiner Freunde sind gefallen, wie kannst du da um deinen Geliebten trauern.
Trotzdem stöbert sie nervös zwischen den Kleiderbügeln, vielleicht wird sich das Kleid ja doch plötzlich offenbaren, und es wird sich erweisen, dass es die ganze Zeit da gewesen ist. Wie schön wäre es, wenn sie es seiner Tochter geben, es für sie auf die Türschwelle legen könnte, anstatt mit ihr von Angesicht zu Angesicht reden zu müssen. Was will die nur von ihr? Wie ist sie jetzt plötzlich auf sie gekommen? Eine gepflegte, vom Leben verwöhnte Frau sucht sich einen Zeitvertreib, neugierig und entflammt wie ein kleines Mädchen.
Was soll sie ihr erzählen? Kein Fremder kann das verstehen. Das Verdikt war größer gewesen als er und größer als sie. Sie hatten sich getrennt, jeder hatte seine eigene Bahn genommen, wie die zerklüfteten Flusstäler jener Sturzbäche, die, aus den Bergen kommend, ins Tote Meer hinunterführen. Was kam es da noch auf das eine oder andere Detail an. Beinah siebzig Jahre hat sie sich nicht mit dieser unreifen Ehe beschäftigt, die auf der Welt nichts hinterlassen hat, und nur diese bevorstehende Begegnung weckt jetzt tote Geschichten zum Leben, Märchen aus längst vergangenen Zeiten, wie jene, die ihr jüngerer Sohn ihr so gern erzählt, und just in dem Moment, in dem sie an ihn denkt, ruft er an. Normalerweise telefoniert er morgens früh und besucht sie zweimal die Woche abends, aber ausgerechnet heute ist er mittags in der Gegend und kommt gleich vorbei, und sie wiegt verlegen den Kopf; was soll sie tun, ist dies ein Zeichen, dass das Treffen mit Menos Tochter besser nicht zustande kommen soll?
Sie muss ihr Bescheid geben, muss den Besuch absagen und hat nicht die Kraft, sich die Enttäuschung in ihrer Stimme anzuhören, und schon gar nicht, dieEnttäuschung auf ihrem Gesicht zu sehen, doch da klopft sie schon an die Tür, klingelt, und sie bleibt schweigend auf dem Sofa sitzen und umklammert ihre Hände. Nein, sie wird ihr nicht aufmachen. Sie wird grausam sein, so grausam, wie der Vater dieser Frau zu ihr gewesen ist; sie wird nichts erklären, so wie er damals nichts erklärt hat. Sie wird Menos Tochter nicht hinter dem Rücken ihres Sohnes von dem Entschluss erzählen, den sie zusammen mit ihrem verstorbenen Mann getroffen hatte und der niemanden sonst etwas angeht. Von dem Entschluss, ihre erste Ehe sogar vor ihren Söhnen geheim zu halten.
Deshalb wird sie auch nicht abnehmen, wenn sie es noch mal telefonisch versuchen sollte. Aufrecht und reglos sitzt sie auf dem Sofa, ihre Fingergelenke sind schon weiß, die Tür ist wie immer verschlossen; bald wird die Besucherin aufgeben und von ihr ablassen. Sie soll bloß verschwinden, bevor ihr Sohn kommt. Es fällt ihr schwer zu atmen, fast wie damals, als sie sich in konspirativen Wohnungen versteckte, manchmal jeden Tag in eine andere umzog und niemals die Tür öffnete.
Oft hatte man sie in ihren Jahren im Untergrund morgens in irgendeine Wohnung gebracht, hatte ihr Tee, Brot und Oliven hingestellt und gesagt: Hier bleibst du bis zum Abend. Die Anspannung, die sie in den verschlossenen Zimmern erlebte, war weitaus größer, als was sie später bei ihren Operationen empfand. Selbst als sie immer wieder im Kinderwagen eine Babypuppe mit einer Bombe im Bauch durch die Straßen schob, hatte sie sich nicht so gefürchtet wie in diesen Zimmern. Doch manchmal war diese Angst auf wundersame Weise auch einem erhebenden Gefühl gewichen, als schwinge die Seele sich empor. Das überkam sie gerade in Momenten höchster Anspannung völlig überraschend und doch mit absoluter Gewissheit. Oder es überkam sie eine Ruhe. Dann begannen die Möbel im Zimmer auf einmal zu strahlen. In allem, was sie tat, lag eine unglaubliche Stille. Und dieser Umschwung war völlig unvorhersehbar, alles, was sie vorher gequält hatte, wurde plötzlich zur Quelle unendlicher Genugtuung, so sehr, dass sie selbst nicht glauben konnte, noch bis vor einigen Momenten in Not gewesen zu sein und dass sie schon am nächsten Morgen wieder mit genau derselben Not zu kämpfen haben würde.
Die Fensterläden mussten geschlossen bleiben. Durch ihre Ritzen versuchte sie, auf irgendeine Art an dem Leben draußen teilzuhaben. In jedem Zimmer, in jedem Viertel gab es andere Stimmen, Gerüche und Anblicke, aber eines blieb immer gleich: Überall gingen Leute aus ihren Häusern und kehrten wieder zu ihren Familien zurück, und sie, die sich von alldem losgesagt hatte, betrachtete sie aus ihrem Versteck. Ihre Eltern wussten nicht, wo sie war. Sie hatte kein Zuhause mehr, keine Anschrift, keinen Namen. Sogar wenn sie festgenommen würde, würden sie nicht erfahren, dass es ihre Tochter war, so oft hatte sie ihre Decknamen gewechselt.
Mit der Zeit kam in ihr der Verdacht auf, dass was ihr scheinbar durch äußere Umstände aufgezwungen war, ihr im Grunde von innen diktiert wurde, denn der Unterschied zwischen Zwang und Wille war manchmal pure Einbildung. Sie wurde gesucht, die Briten suchten sie, aber all diese Details hatten keine Bedeutung. Entscheidend war, dass sie allein in einem Zimmer saß, gefangen und doch absolut frei. Essen und Trinken wurde ihr knapp, aber ausreichend gebracht, und so war sie nie hungrig und nie richtig satt. Stundenlang starrte sie durch die Ritzen, stellte sich vor, dass sie in diesem Zimmer jetzt nicht saß, weil sie gesucht wurde, sondern dass man sie suchte, damit sie in diesem Zimmer sitzen konnte. Dass sie sich hier befand, war das Ziel und der Zweck, während die Umstände, unter denen man sie hierhergebracht hatte, nur das Mittel zum Zweck waren.
Später hatte sie ab und zu versucht, diese Momente noch einmal aufleben zu lassen. Obwohl sie nicht mehr verfolgt wurde und keiner sie festnehmen wollte, hatte sie sich aus freien Stücken allein in einem Zimmer gefangen gehalten. Immer frei, immer allein. Ist es das, was ihr erstgeborener Sohn gemeint hat, als er ihr vorwarf, dass sie nie wirklich für ihn da gewesen sei? Dass sie irgendwie unbeteiligt gewesen sei?
Seine Wut auf sie ist mit den Jahren nur stärker geworden, aber manchmal meint sie auch, sie habe es vielleicht ihm zu verdanken, dass sie noch immer bei klarem Verstand ist. Er ist ihr böse, als sei sie eine junge Mutter, die noch stillen, die noch etwas bewirken, ihn noch beschützen könne, und nicht eine Greisin, um die man sich kümmern muss. An dem Tag, an dem er kapieren wird, dass er auf niemanden mehr böse sein kann, werde ich sterben, denkt sie sich manchmal, und vielleicht wird er das erst verstehen, wenn ich sterbe.
Wie damals flattert ihr Herz, als jetzt die Türe aufgeht, aber es ist nur ihr jüngerer Sohn, sie wird ihn immer so nennen, obwohl er schon groß ist, der Sohn, der ihr keine Vorwürfe macht und der überhaupt keine Vorwürfe mehr macht, seit er fromm geworden ist; er ist freundlich gegen jedermann und auch zu ihr, wie es die Art der Bratzlawer Chassiden ist, und sie versucht wie immer, ihren Abscheu zu verbergen und den Zweifel daran, dass dieser Schrank von einem Mann mit den langen Schläfenlocken und schon ergrauendem Bart wirklich Amichai, ihr jüngerer Sohn, ist. Seine Gesichtszüge erinnern sie an ihre Vorfahren auf den Fotografien aus Osteuropa; ein Teil von ihnen steht da aufrecht, starr und schwarz gewandet, die anderen sitzen auf schweren Stühlen wie schweigende Grabsteine.
Doch ihr Amichai schweigt so gar nicht und hüpft außerdem die ganze Zeit herum. Seine Sprunghaftigkeit erinnert sie trotz allem an das Kind, das er mal war, wie er jetzt hereingeflitzt kommt und sie mit Fragen überschüttet, »wie geht’s dir, Mama? Du siehst gottlob prima aus! War deine Pflegerin schon da?«, und sie antwortet schnell, »nein, heute war noch niemand da, aber wie geht es dir? Woher kommst du gerade?«, und er gießt sich ein Glas Wasser aus dem Krug, der auf dem Tisch steht, ein, hält es in der Hand und trinkt erst, nachdem er seinen Segen gemurmelt hat: »Gepriesen seist du Ewiger, König der Welt, auf dessen Geheiß alles entstand.«
»Amen«, antwortet sie unwillkürlich, sieht, wie er den Mantel auszieht und den Hut von seinem noch immer dichten Haar nimmt, er behält nur sein langärmliges weißes Oberhemd an, an dessen Saum die Schaufäden seiner Zizit wehen, und etwas weiter oben wehen seine Schläfenlocken, es ist, als blase ein heftiger Wind durchs Haus. »Ich habe einen Schüler besucht, der krank ist«, sagt er, schaut sich um, und sein Blick fällt auf die Erfrischungen auf dem Tisch. »Erwartest du Gäste?«
»Du bist mein Gast«, sagt sie, errötet, als habe man sie ertappt, »du hast dich angemeldet, da hab ich uns ein bisschen was hingestellt«, und er lächelt sie an, lange, bis es so scheint, als tue sich in seinem Bart ein Loch auf. »Erinnerst du dich an die Geschichte unseres Rabbis über den Gast?«
»Nicht wirklich«, sagt sie, »es fällt mir schwer, eure Geschichten zu behalten«, und er setzt sich ihr gegenüber in den Sessel, der eigentlich für ihre Besucherin bestimmt war, und gießt sich noch ein Glas Wasser ein. »Diese Geschichte hat unser Rabbi zwei Jahre vor seinem Tod erzählt, am Abend, an dem man die erste Chanukka-Kerze anzündet, über einen Gast, der ins Haus kommt, nachdem die Kerzen bereits angezündet sind. Der Gast verwickelt den Hausherrn in ein Gespräch und weckt in ihm die Sehnsucht nach dem Ort, an dem die Seele sich emporschwingt. Als er hinausgeht, begleitet ihn der Hausherr und beginnt, mit ihm in die Höhen zu schweben, über Hügel und Täler, aber gleichzeitig ist er noch in seinem Haus, unterhält sich weiter mit seiner Familie, isst und trinkt und versteht nicht, wie es kommt, dass er mal hier und mal dort ist. Wenn ich das unterrichte, sage ich immer, dieser Gast kann auch ein naher Mensch sein, und sogar ein Teil meiner selbst, dem ich in meinem bisherigen Leben noch keinen Raum gegeben habe.«
»Und wie geht es aus?«, fragt sie, die Geschichte weckt in ihr ein unbestimmtes, unangenehmes Gefühl. »Bei deinem Rabbi werden die Geschichten zum Ende hin meistens etwas verworren und kommen nirgendwo richtig an.« Er lächelt milde, während er sich eine Handvoll Mandeln in den Mund steckt. »Oj, meine liebe Mama, nur von dir bin ich bereit, mir solche Lästerungen anzuhören. Die Enden sind immer in unserer Hand. Lösen müssen wir die Dinge selbst. Unser Rabbi zeigt uns damit, dass der Weg wichtiger ist als sein Ende. Und er gibt uns die Kraft für den Weg.«
»Weißt du, diese ganzen Geschichten sagen mir nichts«, antwortet sie ungeduldig, »erzähl mir doch lieber was von den Kindern.« Er lacht. »Von den Kindern oder von deren Kindern?«, aber ein Klingeln an der Tür unterbricht ihn, und sie ruft: »Mach nicht auf, Ami, ich will nicht, dass uns jetzt jemand stört.« Er, flink, wie er ist, steht bereits im Vorraum, und Rachel vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Was soll sie jetzt tun? Sie war sich sicher gewesen, dass Menos Tochter längst aufgegeben hat und dass sie sich nach dieser Abfuhr heute nicht mehr bei ihr melden würde. Sie konnten sich auf keinen Fall in seinem Beisein unterhalten, sie hatte ihrem Mann versprochen, dass ihre Söhne nie davon erfahren würden.
»Ami, ich bin müde. Lass niemanden herein«, schreit sie, doch zu spät, er kommt schon ins Wohnzimmer zurück. »Da ist eine Besucherin, Mama, sie sagt, sie sei mit dir verabredet.« Rachel hebt langsam und besorgt den Kopf zu der Frau, die in einem ärmellosen langen schwarzen Kleid neben ihm steht. Die stramm zu einem Knoten gebundenen Locken betonen ihre markanten Wangenknochen, eine Ähnlichkeit mit ihrem Vater, die ihr bei ihrer ersten Begegnung nicht aufgefallen war. Ataras Gegenwart erschlägt sie geradezu, sie schüttelt nur immer wieder den Kopf, eine Geste, die ihr Sohn als Ablehnung deutet, und so fragt er die Besucherin schon nach wenigen Augenblicken: »Vielleicht können Sie das auf ein andermal verschieben? Meine Mutter ist jetzt zu müde.«