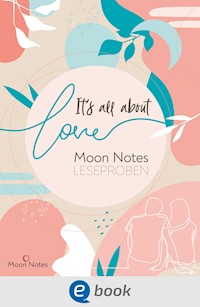9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Grace Welles sitzt in einem Internat in den Sümpfen Floridas fest, einzige Überlebensmethode: strenge, selbst auferlegte Einsamkeit. Und es funktioniert. Ihre abwehrende Haltung hält die Leute, sprich potenzielle Freunde, schön auf Abstand. Als sie jedoch versehentlich einen neuen Schüler rettet, bricht ihre perfekt gepflegte Einzelgängerwelt zusammen. Denn jetzt ist da dieser Junge in ihrem Leben, Wade Scholfield. Mit Wade entdeckt Grace, dass Schulregeln optional sind und Gespräche über Wurmlöcher zu Knutschsessions führen können … Warum also zerbricht sie Wades Herz in Millionen Stücke?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch
Eine Lovestory ohne Amors Pfeil, dafür mit Steinschleuder. Trifft die Leser*innen mitten ins Herz.
Berühmtestes Zitat der Slingshot-Romance-Heldin Grace Welles: »Lies es einfach, verdammt noch mal!«
Was sonst noch drin ist: Ein zweit… okay, eher drittklassiges Internat in den Sümpfen Floridas. Ein Lehrer mit schönen Haaren und schlechtem Frauengeschmack. Eine Heldin, die zwei Dinge perfekt beherrscht: 1. jegliche soziale Interaktion vermeiden 2. mit einer Steinschleuder Wi*#$%r abschießen. Der neue Typ, der Punkt 1 gekonnt ignoriert und dem Punkt 2 den Arsch rettet. Gefühle der Kategorie messy, intensiv, existenziell
Für all die Idioten und Seelenverwandten meiner Jugend
Kleine Anmerkung zum Text: Im Laufe der Handlung haben zwei der Figuren ungeschützten Sex. Wir konnten sie nicht davon abhalten. 😉 Das ist immer eine schlechte Idee. Deshalb: Macht, was auch immer euch Spaß macht. Aber bitte nie ungeschützt ✌.
1
Es war der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, und ich saß als Hexe verkleidet in einer der Toilettenkabinen der Schule. Der lange, schwarze Stoff meines Kleides lugte aufgrund seiner absurden Ausmaße unter der Kabinentür hervor. Ich weinte. Die Knie bis zum Kopf hochgezogen und die Arme um die Beine geschlungen, hatte ich mein Gesicht in den schwarzen Stofflagen vergraben. Mein gesamter Körper fühlte sich steif an, und jeder Muskel war so angespannt, dass ich mir sicher war, schon eine leichte Berührung würde mich entzweispringen lassen. Mein Gesicht war heiß und glänzte vor Rotz und Tränen, und ich musste mir ein bisschen Stoff in den Mund stopfen, damit meine Schluchzer nicht durch den ganzen Raum hallten.
Noch nie hatte ich so geweint. So heulten Frauen in Fernsehschnulzen, während sie sich an die Beine irgendeines Typen klammerten, der gerade versuchte, zur Tür hinauszugehen. Ich war das genaue Gegenteil davon. Ich war immer eines dieser beinharten kleinen Arschloch-Kinder gewesen, die nicht weinten – weder, wenn mir jemand wehtat, noch, wenn mich jemand anschrie oder hänselte. Und wenn ich doch mal weinte, dann kurz und effektiv, eine Tat, begangen im Geheimen, ohne Zeugen oder Spuren zu hinterlassen. Ich hatte mich immer für ziemlich unzerstörbar gehalten, und das war ich auch. Oder war es zumindest gewesen – bis zu jenem Moment auf der Schultoilette.
Einfach so wurde der Panzer meiner Kindheit zerstört, und alles, was es dazu brauchte, war mein Seelenverwandter, der mir ein Buttermesser ins Herz rammte.
Er hieß Carl Sorrentino. Eigentlich Mr. Sorrentino, mein Biolehrer. Es stimmte, er war gut zwanzig Jahre älter als ich, und ich sah ein, dass das für manche Leute ein Thema war. Engstirnige Leute. Es gab Hindernisse, die es zu überwinden galt, klar, aber was waren schon Hindernisse, wenn man es mit Schicksal zu tun hatte? Und das hier war Schicksal. Ich dachte nicht bloß, wir wären Seelenverwandte, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Wenn man Dinge dieser Größenordnung weiß, dann müssen sie nicht zwangsläufig Sinn ergeben. Schließlich ist Liebe eine höhere Wahrheit als Logistik, und im Grunde konnte mich jeder mal, der damit ein Problem hatte. Liebe ist Liebe. Dagegen ist alles andere unwichtig. Was hatte Alter schon damit zu tun? Gar nichts.
Auch Mr. Sorrentino spürte unsere besondere Verbindung, das wusste ich ganz genau. Ich wusste, dass ich keine Wahnvorstellungen hatte, weil es, obwohl wir unsere Gefühle füreinander nicht direkt öffentlich zum Ausdruck brachten (was de facto total illegal gewesen wäre), Hinweise gab, auf die sich meine unweigerlichen Schlussfolgerungen gründeten. Echte Dinge, die Mr. Sorrentino getan oder gesagt hatte. Zeichen.
Zum Beispiel die Smileys, die er mir auf meine Tests kritzelte, unter Sätze wie: »Du hast es drauf, Gracie!«, oder: »Das Grace-Monster hat wieder zugeschlagen!« Außerdem zeichnete er kleine Augen in die Zahlen auf den korrigierten Tests. Als er zum Beispiel 99 Prozent unter einen Test setzte, verwandelte er die Kreise der Neunen in Augen. Das war natürlich übelst kitschig, aber darum ging es schließlich nicht. Sondern darum, dass es unglaublich süß war.
Außerdem gab es da noch die Momente, in denen sich unsere Blicke trafen, wenn er einen seiner Biologiewitze erzählte, die niemand außer mir checkte. Dann lächelte ich ihm quer durchs Klassenzimmer wissend zu, und er erwiderte mein Lächeln. In diesen Momenten blieb für einen Augenblick die ganze Welt stehen.
Und in den Mittagspausen ließ er mich manchmal im Klassenzimmer abhängen, wo ich ihn mit detaillierten Fragen zu was zum Teufel auch immer wir gerade durchnahmen löcherte. Ehrlich gesagt, war mir der Stoff ziemlich egal, aber meine Noten waren hervorragend, weil ich jede Menge Energie in meine Bioaufgaben steckte. Mr. Sorrentino war so geduldig. Er sah mich an, während ich redete. Er saß da und wartete, während ich meine Fragen formulierte und versuchte, dabei möglichst witzig und tiefgründig zu sein. Dann nickte er immer und sagte: »Weißt du, das ist eine verdammt gute Frage, Gracie. Hier, ich zeig dir mal was.« Und dann zeichnete er Schemata für mich an die Tafel. Er zeichnete detaillierte Querschnitte von Tier- oder Pflanzenzellen, das gesamte Atmungssystem oder DNA-Stränge – komplexe Zeichnungen mit Pfeilen und Beschriftungen. Alles nur für mich.
Außerdem gab er mir sehr oft High-Fives. Bei allen anderen hätte ich es zum Kotzen gefunden, aber bei ihm funktionierte es irgendwie. Immerhin war es praktisch die einzige Berührung, die uns erlaubt war, und darum verstand ich, warum er es tat.
Es gab noch viel mehr Dinge. Und ja, ich war nicht dumm. Ich wusste, dass das alles kleine Dinge waren, die man als unbedeutend hätte abtun können. Aber es ging um das große Ganze. Man brauchte bloß die vielen kleinen Hinweise zusammenzuzählen. Und das große Ganze lag glasklar auf der Hand: Mr. Sorrentino und ich hatten eine starke, welterschütternde Verbindung. Eine, die sich allen Regeln und Traditionen entzog. Eine, die das Spiel neu erfindet. Eine Verbindung, die zu stark ist, um den ausgelatschten Pfaden irgendwelcher Prototypen zu folgen.
Aber wie auch immer. Am Ende stellte sich heraus, dass ich anscheinend doch unter Wahnvorstellungen litt.
Es geschah bei der letzten Aufführung des Schultheaters von Macbeth, in der ich eine der drei Hexen spielte. Ich hasste Theater, aber ich hatte für die Rolle vorgesprochen, nachdem Mr. Sorrentino mich eine Hexe genannt hatte, weil ich hundert Prozent beim Pop-Quiz erreicht hatte. Ich dachte, vielleicht machte ihn die Vorstellung an, und es konnte ja nicht schaden, seine Fantasie real werden zu lassen – mit schwarzem Kleid, Hut, dem ganzen Drum und Dran. Als ich nach meiner zweiten Szene von der Bühne ging, kam Mr. Sorrentino auf mich zu und zog mich zu einer brünetten Frau hinüber.
»Gracie, ich würde dir gern meine Verlobte Judy vorstellen. Sie wird im nächsten Schuljahr ein paar Vertretungsstunden geben.«
Judy hatte voluminöses Haar und lächelte so breit, dass es aussah, als hätte sie ungefähr viertausend Zähne. Sie hatte Sommersprossen, buschige Augenbrauen und trug eins von diesen weihnachtlichen Kleidern, die es bei Dillard’s zu kaufen gibt, und kleine Weihnachtsbaumschmuckohrringe. Wegen ihres breiten Lächelns waren ihre Lippen zu schmalen Linien über das ganze Gesicht gezogen, und ihre blasspinke Lipglossschmiere glitzerte im Licht. Ich schüttelte ihre ausgestreckte Hand. Ihre Fingernägel waren genauso blasspink angemalt wie ihre Lippen und perfekt manikürt.
»Schön, dich endlich kennenzulernen!«, verkündete sie. »Ich habe schon viel von dir gehört. Beste Schülerin in Bio, was? Nicht schlecht!«
Ich starrte sie mit leerem Blick an. Sie redete noch eine Weile von all den tollen Dingen, die Mr. Sorrentino ihr über mich erzählt hatte. Meine Noten schienen sie ernsthaft zu begeistern. Ich starrte sie einfach nur an. Wenn man zum ersten Mal verletzt wird, spürt man es zunächst oft gar nicht, weil man unter Schock steht. Der Schmerz ist da, aber du bist wie betäubt, weil er so unerwartet kam.
Judy lächelte immer weiter. »Oh, und Carl hat mir erzählt, dass du nach der Schule vielleicht Biochemie studieren willst!«
»Mhm«, machte ich.
»Wie toll ist das denn bitte?«, sagte sie, und ihre Zahnwand glänzte.
Ich wandte mich an Mr. Sorrentino. »Mr. Sorrentino, kann ich Sie für einen Moment sprechen?«
Er sah Judy fragend an. Sie lächelte.
»Natürlich, Gracie.«
Ich führte ihn in den nächsten leeren Raum im Flur, das Büro der Krankenschwester.
»Was ist los?«, fragte Mr. Sorrentino lächelnd. »Ach, und übrigens, du warst toll. Shakespeare ist wahrlich kein leichter Stoff. Diese Sprache auswendig zu lernen – das kann nicht jeder.«
»Sie haben mir nie gesagt, dass Sie eine Verlobte haben«, sagte ich.
Sein Lächeln verschwand nicht direkt von seinem Gesicht, doch es gefror auf eine Weise, die ihn verloren wirken ließ. »Nun …« Er hielt inne, sah für einen Moment hinunter auf seinen Ellbogen und fuhr dann fort. »Judy war bis gestern noch nicht meine Verlobte, aber offen gesagt ist das mein Privatleben, Gracie. Ich verstehe nicht, was …«
»Vor gestern hat sie nicht existiert? Dann ist sie also einfach so aus dem Nichts aufgetaucht? Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist – also, wissenschaftlich betrachtet.«
Er sah mich verblüfft an, und sein Blick zuckte vor Verständnislosigkeit ohne Fokus hin und her.
»Was ist los?«, fragte er nach einer kurzen Pause.
Ich drehte ihm den Rücken zu und wischte eine Träne fort, die sich in meinem rechten Auge gebildet hatte. »Sind Sie wirklich mit dieser Frau zusammen?«, fragte ich. »Ist das eine ernste Sache?«
»Wie bitte?«
Ich wirbelte zu ihm herum. »Wollen Sie sie ernsthaft heiraten? Die ist doch ein verdammter Witz. Ich meine, haben Sie sich die mal angesehen?«
»Hey, hey, hey!«, sagte er und wich einen Schritt zurück. »Das geht nun wirklich zu weit, Grace!«
»Sorry, aber das ist die Wahrheit.«
»Das reicht!«
Ich fuhr zusammen. In diesem Ton hatte er noch nie mit mir gesprochen. Es war ein seltsames Gefühl, mit ihm nicht einer Meinung zu sein. Ich spürte, wie mein Gesicht heiß wurde, und obwohl das schräg klingt, war ein kleiner Teil von mir definitiv angeturnt.
»Würdest du mir bitte sagen, was hier los ist?«, fragte er.
»Lieben Sie sie?«
Eine gefühlte Ewigkeit stand er einfach nur da und brachte keinen Ton raus. Dann erschien ein Oh Scheiße-Ausdruck auf seinem Gesicht. Erst jetzt schien ihm der Ernst der Situation bewusst zu werden. Oder zumindest ein bisschen was von dem Ernst. Wahrscheinlich dachte er, ich wäre in ihn verknallt. Ich bezweifle, dass er verstand, dass er mein Seelenverwandter war.
Er holte tief Luft. »Setz dich einen Moment, Gracie.«
Ich setzte mich.
»Okay, hör zu. Das Leben kann verwirrend sein. Das weiß ich. Glaub mir, es kann für uns alle verwirrend sein, aber wenn man jung ist, kommt einem vieles umso sonderbarer vor. Ich will, dass du weißt, dass ich dich für eine sehr intelligente, talentierte junge Frau halte. Ich sehe in dir jemanden, der es noch weit bringen wird. Du bist jemand ganz Besonderes, Grace, und das meine ich wirklich so. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich respektiere. Du wirst mal eine Wahnsinnsbiologin.«
Mein Abendessen begann mir die Kehle hochzuwandern. Das Letzte, was ich jetzt hören wollte, war, dass er mich respektierte, weil ich mal eine beschissene Wahnsinnsbiologin werden würde.
»Jetzt fahren Sie vielleicht noch auf sie ab«, sagte ich. »Aber wenn Sie glauben, dass mehr hinter diesem Affentheater steckt, machen Sie sich was vor.«
Ihm blieb der Mund offen stehen. Für einen Moment fehlten ihm die Worte.
»Oh, warten Sie, stimmt ja«, fügte ich hinzu und verdrehte angesichts seiner Reaktion die Augen. »Ganz bestimmt ist das, was Sie und Judy füreinander empfinden, wahre Liebe.«
Mr. Sorrentino verschränkte mit einem Ausdruck grimmiger Entschlossenheit die Arme. »Tut mir leid, dieses Gespräch ist hiermit beendet, Grace.«
Einzig und allein die Tatsache, dass ich in voller Hexenmontur steckte, gab mir den Mut, mich gleichgültig zu geben. »Wie auch immer. Glückwunsch, Mr. Sorrentino, Sie haben da einen echten Schatz gefunden.«
Damit drehte ich mich auf dem Absatz um und rauschte hinaus, wobei die langen Falten meines Polyesterkleides theatralisch hinter mir herschleiften. Mit aller Haltung, die ich aufbringen konnte, lief ich den Flur hinunter. Krampfhaft klammerte ich mich an die Reste meiner schusssicheren Fassade, doch zu dem Zeitpunkt waren selbst ihre kläglichen Reste vorgetäuscht. Ich war bereits zerstört.
Noreen kam mir entgegengelaufen, verkleidet als Baum.
»Heilige Scheiße!«, rief sie. »Wir waren so verdammt gut! Keiner hat seinen Text vergessen! Das war der Wahnsinn!«
Sie hatte einen der rappenden Bäume gespielt. Sie und ein paar weitere Bäume sangen am Ende des zweiten Aktes einen Rapsong. Ein Versuch, die Spinnweben von dem Stück abzustauben, nehme ich an. Ich persönlich war stets dagegen gewesen, war aber auch kein derartiger Theater-Nerd, dass es mich ernsthaft interessierte.
Ich ignorierte Noreen und bog in die herrliche Stille der Mädchentoilette ab. Drinnen steuerte ich geradewegs die letzte Kabine an, warf die Tür hinter mir zu und brach kurzerhand zusammen.
2
Ich fühlte mich wie ein Kadaver, als ich für die Weihnachtsferien nach Hause fuhr. Soweit ich das beurteilen konnte, war meine Seele vom Schicksal verdaut und wieder in meinen Körper erbrochen worden, wo sie nun ziel- und willenlos vor sich hin dämmerte. So hatte ich meinen Zustand zumindest in meinem Tagebuch festgehalten.
»Hallo, Liebes«, begrüßte mich meine Mutter, als ich an der Bushaltestelle auf sie zukam.
Ich war die einzige Schülerin an meiner Schule, die mit dem Bus nach Hause reiste. Wer sein Kind auf das fast-aber-nicht-ganz-renommierte weiterführende Internat schicken konnte, auf das ich ging, der konnte sich auch ein Flugticket in der Economyclass leisten. Aber bei mir lag die Sache anders. Ich stammte aus einer anderen Gehaltsklasse – eher eine Mobile-Home-Community-Gehaltsklasse, die normalerweise nicht viel mit den Schulgebühren von Privatschulen zu tun hat. Es kam mir nach wie vor ziemlich bizarr vor, dass ich auf eine private Highschool ging, doch mein Vater zahlte für meinen Unterhalt und die Gebühren und ließ sich nicht davon abbringen. Seiner Meinung nach war eine solide Ausbildung alles, was ich brauchte, um im Leben klarzukommen. In Wahrheit war es wohl mehr etwas, das er brauchte, um klarzukommen – damit, dass er mich aus Versehen gezeugt hatte und jetzt nicht mehr viel dagegen tun konnte. Irgendwas musste er ja tun, um nicht als kompletter Dreckskerl dazustehen, und seine Lösung bestand darin, mich mit einer aufgeblähten Ausbildung vollzustopfen. Wobei er nie ein Dreckskerl durch und durch war – vielleicht eher ein Sackgesicht. Immerhin meinte er es gut. Wie auch immer, das ist die Kurzversion der Geschichte. Mehr dazu später.
»Hi, Mom.« Ich war bei ihr angelangt und blieb einen Moment mit hängenden Armen vor ihr stehen.
»Komm her«, sagte sie und zog mich in eine Umarmung. »Wie war’s in der Schule?«
»Wie immer.«
»Oh, gut. Ich find’s furchtbar, dass du so viel fort bist«, murmelte sie in meine Haare. »Es ist schrecklich einsam ohne dich.«
Ich drückte sie fest. Bei meiner Mutter lief einiges schief. Und damit meine ich ernste Probleme und nicht so melodramatische Teenagerfantasien. Aber sie war die einzige Person, die ich umarmen konnte, ohne mich zu schämen. Ich brauchte ihr noch nicht mal einen Grund zu nennen. Sie stellte nie Fragen.
»Ich hab gedacht, wir essen Donuts auf dem Heimweg!«, verkündete sie. »Was meinst du? Hast du Lust?«
Allein beim Gedanken daran, jetzt einen Donut zu essen, wallte erneut Übelkeit in mir hoch, doch ich lächelte und sagte: »Ja!« Mit Ausrufezeichen und allem.
Die Ferien verbrachte ich damit, mich an diese neue, verkrüppelte Existenz zu gewöhnen, die offenbar mein Schicksal war. Wie immer las ich viel. Ich konnte nichts gegen meine Sucht nach Büchern tun. Sosehr ich auch versuchte, cooler zu sein, es klappte einfach nicht. Ich schrieb außerdem Tagebuch, Gedichte und Romane, was die Sache auch nicht gerade besser machte. Zuletzt hatte ich mich mit großem Vergnügen durch A Clockwork Orange gearbeitet. Der totale Mindfuck. Jetzt ging ich über zu Stephen Kings Es. Ich dachte mir, dass es besser war, bei den gestörten Themen zu bleiben. Das beruhigte meinen Magen.
Nachts las ich, hörte Musik und weinte. Tagsüber verbrachte ich viel Zeit mit meiner Mutter, was sich als anstrengender denn je herausstellte. Während wir vor dem Fernseher saßen, legte ich gern meinen Kopf in ihren Schoß, und sie fuhr mit den Fingern durch mein Haar. Doch um mit ihr zu reden, musste ich so viel Energie und Geduld zusammenkratzen, dass es unter den gegebenen Umständen richtiggehend wehtat.
Meine Mutter war ein ganz besonderer Mensch. Sie war jung, gerade mal 34. Außerdem war sie schön, und das nicht auf eine Trailer-Park-Art. Sie war auf unverdorbene und natürliche Weise schön. Sie verfügte über dasselbe Farbspektrum wie ich – dunkle Haare, blasse Haut, blaue Augen –, nur dass es bei ihr irgendwie harmonierte. Während der Kontrast an mir hart wirkte und mich käsig aussehen ließ, wirkte sie dadurch entrückt und faszinierend. Draußen zog sie alle Blicke auf sich. Und obendrein (oder trotzdem) war sie auch noch wahnsinnig nett. Sanft, liebevoll und freundlich. Sie wollte für jedes Lebewesen auf dem Planeten jederzeit nur das Beste, und ihre Güte und ihre Frieden-auf-Erden-Vibes waren echt. Sie meinte es ernst. Sie hatte ein Herz für alles und jeden, sogar für Pflanzen, Möbel und andere unbelebte Gegenstände. In ihrer Welt gab es keine bösen Hintergedanken, und sie fand für jedes Verhalten eine Entschuldigung.
Das Problem war, dass sie auch verrückt war. Wirklich verrückt. Ich glaube, am treffendsten beschreibt das Wort wahnhaft ihren Zustand. Sie ignorierte die Welt um sie herum genauso rigoros, wie Kinder es tun, wenn sie Astronaut, Cowboy oder Prinzessin spielen und in ihrer Fantasiewelt leben. Meine Mutter hatte sich eine eigene Welt geschaffen. Die Wirklichkeit verdrängte sie, so gut sie konnte, und wenn das nicht möglich war, wenn die Realität zu laut wurde und zu viel Druck auf die Märchenwelt ausübte, in der sie lebte, dann brach sie zusammen. Und man mühte sich mit den vielen kleinen Einzelteilen ab, um sie wieder zusammenzusetzen. Die Strategie war stets mehr oder weniger die gleiche: Man musste ihr versichern, dass die Wirklichkeit nicht echt und ihre verzauberte Spinnerwelt die Wahrheit war.
Meistens nahm ich ihr das nicht übel. Sie wollte einfach nur glücklich sein, und da Glück in ihrem Leben nicht vorgesehen war, trickste sie das System aus und entschied sich für eine Abkürzung mithilfe ihrer Fantasie. Sie war nicht dumm, und es klappte. Ich verstand ihre Logik und versuchte, sie nach Kräften zu unterstützen. Manchmal ist Wahnsinn die bessere Option. Es konnte riesigen Spaß machen mit meiner Mutter – wie sie die Welt in einem Sammelsurium aus absurden Pastelltönen und einhornmäßigem Glitzerbullshit malte. Manchmal war das nach einem schlimmen Schultag genau das, was ich brauchte. Der Nachteil war, dass man es komplett vergessen konnte, jemals irgendwas Reales, was einen beschäftigte, mit ihr zu besprechen. Denn Realität = versteckte Mine = nuklearer Holocaust der Gefühle. Ihre Abkürzung konnte nicht viel ab, bevor die Sicherung durchbrannte.
Dieses Weihnachten war hart. Ich war noch nie zuvor verliebt gewesen. Ich hatte noch nie zuvor ein gebrochenes Herz gehabt. Diese ganze Scheiße nicht durchblicken zu lassen, fiel mir nicht leicht.
»Es macht dir doch nichts aus, dass dein Vater dieses Weihnachten nicht kommen konnte, oder?«, sagte meine Mutter und tätschelte mir das Knie, während wir vor dem Fernseher saßen. »Weißt du, er wollte wirklich gern, aber ihm ist die Arbeit dazwischengekommen. Seine Anwaltsfirma fusioniert im Januar mit einer anderen, und er muss eine Menge vorbereiten.«
»Ja, mir egal.«
»Liebling, sag nicht, dass es dir egal ist. Ihm ist es nicht egal, dann sollte es dir auch nicht egal sein.«
»Nein, ich meine, ich versteh’s. Ich weiß, dass er viel zu tun hat.«
Sie lächelte. »Ist die Kette, die er dir geschickt hat, nicht hübsch?«
»Ja, sehr hübsch.«
Und hier kommt die wahre Geschichte:
Dass mein Vater an Weihnachten nicht bei uns war, lag schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass er eine Ehefrau und drei Kinder in Kalifornien hatte, die nichts von meiner Mutter und mir wussten. All das Gerede über eine Firmenfusion im Januar war frei erfunden. Meine Mutter und ich waren ein geheimer Ausreißer in seinem ansonsten stinknormalen Leben. Ich kann’s ihm nicht verübeln, dass er vor all den Jahren meiner neunzehnjährigen Mutter auf einer Geschäftsreise nach Florida nichts entgegenzusetzen hatte. Er musste sich einfach in sie verlieben. Sie war außergewöhnlich und grenzenlos schön. Kein Wunder, dass er sie nie aus dem Kopf bekam, auch wenn das noch so bequem gewesen wäre. Ihre Affäre hörte nie auf, sondern wuchs wie ein Schimmelpilz in einem feuchten Keller. Ich war das Nebenprodukt, und da standen wir nun alle. Meine Eltern liebten sich wirklich, das will ich gar nicht bestreiten. Vielleicht gab es mehr wahre Liebe zwischen ihnen als zwischen ihm und seiner eigentlichen Familie, und vielleicht »funktionierte« es deshalb. Was auch immer die Gründe für die unerschütterliche Liebe meiner Eltern waren, meine Mutter und ich stellten jedenfalls sein Alternativuniversum dar, das mit seinem Hauptuniversum koexistierte, Seite an Seite. Wir wussten von »ihnen«, aber sie wussten nichts von uns. Die einzige Regel lautete, nie ein Wort über die ganze Sache zu verlieren.
Ich trug den Nachnamen meiner Mutter: Welles. Mein Vater schickte über ein komplexes System, das seinen besten Freund und Geschäftspartner beinhaltete, jeden Monat ein bisschen Geld. Auf demselben Weg bezahlte er mein Internat, und er besuchte uns ein paarmal im Jahr unter dem Deckmantel von Geschäftsreisen. Wir alle hielten uns an die Regeln, und wie schon gesagt, es funktionierte.
Es war noch nie anders gewesen, und deshalb war es für mich nie was anderes als Normalität. Wenn mein Vater für ein paar Tage oder ein bis zwei Wochen vorbeikam, freute ich mich immer, ihn zu sehen. Er brachte Geschenke mit, und wir gingen jeden Abend essen. Wenn er wieder fuhr, war das für mich auch okay. Dachte ich zumindest. Manchmal saß ich nach einem seiner Besuche auf dem Bett und untersuchte meinen emotionalen Zustand auf irgendwelche Verletzungen. Ich war mir nie zu hundert Prozent sicher. Es hing ganz davon ab, welche Musik ich während dieser Innenansichten hörte, aber größtenteils hatte ich das Gefühl, alles war in Ordnung, bis ich eifersüchtig auf irgendwas Seltsames wurde. Zum Beispiel auf ein Mädchen auf der anderen Straßenseite, das von ihrem Dad angeschrien wurde, sie solle sich von ihrem Loser-Freund fernhalten. So was traf mich manchmal wie aus dem Nichts. Ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag lang mit jedem noch so fragwürdigen Typen schlafen, und keiner würde mich daran hindern.
Das Einzige, was ich an diesem ganzen Szenario überhaupt nicht verstand, war, warum meine Mutter sich ausgerechnet in meinen Dad verliebt hatte. Das war der Teil, der überhaupt keinen Sinn ergab. Auf mich wirkte er so unglaublich normal. Es gab nichts Aufregendes an ihm, außer dass niemand so recht wusste, wann er auftauchte und wieder verschwand. Er war sechzehn Jahre älter als sie, hatte einen überschaubaren Bauch und war schon ziemlich kahl. Mir wollte das einfach nicht in den Kopf. Klar, er hatte Geld. Er war Anwalt in der Musikindustrie und wohnte in Beverly Hills (oder zumindest hatte seine Anwaltsfirma da ihren Sitz), aber das machte ihn in meinen Augen kein bisschen interessanter, und er überschüttete uns ganz sicher nicht mit Geld. Das konnte er gar nicht, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre.
Meine Mutter hätte jeden haben können. Sie hätte mit dem Leadsänger jeder Band durchbrennen können, die durch Florida tourte. Sie hätte einen brillanten Wissenschaftler treffen oder die Muse irgendeines Schriftstellers werden können, dem sie als Inspiration für seinen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman diente. So außergewöhnlich war sie. Mindestens mal hätte sie einen absurd reichen Mann heiraten können, oder meinetwegen auch einfach nur einen ganz normalen Typen, der sie genug liebte, um bei ihr zu bleiben.
Sie hätte jeden in ihren Bann ziehen können, aber stattdessen zog mein Vater sie in seinen.
Ich sah zu meiner Mutter hinüber und fragte mich, ob ich wohl so enden würde wie sie. Gefangen in einer Art Liebeshölle. Wahrscheinlich, dachte ich. Wahrscheinlich war ich am Arsch.
3
Die Midhurst School war 1973 gegründet worden. Sie war ein weiterführendes Internat irgendwo im niedrigeren Privatschulen-Segment. Sie wäre gern renommiert, aber dafür war sie zu zugänglich, hatte zu wenig Mittel zur Verfügung und befand sich noch dazu in den Sümpfen Floridas.
Sie lag im mittleren Teil des US-amerikanischen Blinddarms, wie wir diese Region gern nannten – näher am Atlantik als am Golf von Mexiko, aber zu weit weg von beiden Küsten, um einen Strand in der Nähe zu haben. Die Landschaft rund um die Schule war dicht bewachsen, flach und grün. Louisianamoos hing von den Bäumen, Eidechsen flitzten über die Gehsteige, Schlangen verkrochen sich in den Büschen, und überall wuchs dieses dicke, kräftige Gras, das sich unecht anfühlt, wenn man es anfasst.
Ich mochte die Vegetation hier in Florida schon immer, selbst als ich noch ein Kind war. Sie hatte etwas Entrücktes und Prähistorisches an sich. Sie war fruchtbar und romantisch. Alles hing und tropfte. Und ich liebte die Gefahren, die in ihr lauerten – die Tatsache, dass du dich an Seen vor Alligatoren in Acht nehmen musstest, die Warnungen vor Hurrikanen und Tropenstürmen, und die Klapperschlangen, die sich manchmal in den Büschen rund um die Schule versteckten.
Aber abgesehen von ihrer Vegetation hatte die Gegend rund um die Schule wenig zu bieten. Die nächste Ortschaft lag ein Stück die Straße hinunter. Sie war klein, es herrschte tote Hose, und es fehlte einem dort an so ziemlich allem.
Die Schule selbst bestand aus einem großen, weiß verputzten Bau im spanischen Kolonialstil, der in den 30er-Jahren ein Krankenhaus beherbergt hatte. Das war das Hauptgebäude. Darin befanden sich die Büros, die meisten Klassenzimmer, die Aula und der Speisesaal. Wie der Großteil der Schule war das Gebäude ein bisschen heruntergekommen, in seiner stillen Schlichtheit jedoch nach wie vor beeindruckend. Die restlichen Gebäude erstreckten sich dahinter. Die Wohngebäude, die Turnhalle, die restlichen Klassenräume, die im Hauptgebäude keinen Platz fanden, die Kunsträume – eine bunte Mischung aus 70er- und 80er-Jahre-Bauten, die über die Jahrzehnte hinzugekommen waren.
Die meisten Kinder auf der Midhurst kamen aus Familien der gehobenen Mittelschicht. Ihre Eltern waren nicht direkt reich, aber sie hatten genug Geld, um die Gewohnheiten der Gesellschaftsschicht über ihnen zu imitieren. Es gab nur ein paar wirklich wohlhabende Schüler. Ich nehme an, ihre Eltern hatten versucht, sie in bessere Schulen zu stecken, waren aber an unzureichenden Noten oder fehlenden Verbindungen zu diesen Schulen gescheitert und hatten ihre Ambitionen eine Stufe nach unten korrigiert.
Die Midhurst School führte keine Warteliste, und es gab keine strengen Aufnahmeprüfungen. Man konnte sogar angenommen werden, wenn die Noten nicht über dem Durchschnitt lagen. Konntest du die Schulgebühr zahlen, war dein Kind dabei. Dementsprechend groß war auch die Bandbreite an unterschiedlichen Schülern. Ein Haufen kluger Köpfe, die später einmal auf renommierte Colleges gehen würden. Ein paar Faulpelze ohne jegliche Ambitionen, die sich treiben ließen, wie sie es auf jeder drittklassigen öffentlichen Schule auch getan hätten. Dann gab es da noch Schüler, deren Eltern sie zu Hause nicht haben wollten. Viele kamen aus anderen Regionen in Florida oder benachbarten Bundesstaaten, ein paar aus der Gegend, und es gab sogar eine kleine Gruppe internationaler Schüler – vor allem deutsche, warum auch immer.
Wie alle anderen Schulen hatten auch wir einen dämlichen Schulslogan (Wir halten den Schlüssel zu einer helleren Zukunft) und ein Wappen, bestehend aus einem mittelalterlichen Turm in der Mitte, links und rechts einer Palme und einem Kelch darüber. Bis auf die Palmen machte es überhaupt keinen Sinn. Midhurst behauptete von sich, »in der Tradition verankert« zu sein, und unternahm alle möglichen Versuche, in den Schulrankings möglichst weit oben zu erscheinen – ein Sprungbrett zur Ivy League. Der Turm auf dem Wappen war zweifellos ein Versuch, aus nichts ein bisschen Tradition zu wringen. Weiß der Himmel, was der Kelch bedeuten sollte.
Auf der Internetseite der Schule sah man lachende Schüler, denen die Sonne durch die Haare schien, während sie auf dem Rasen ihre Hausaufgaben machten. Es gab Fotos von Schülern, die Tennis spielten oder ritten. Schüler vor Computern, die wahrscheinlich gerade Programmieren lernten. Schüler, die in sonnendurchfluteten Schlafzimmern abhingen und Gitarre oder Schach spielten. Ein Schüler spielte Saxofon. Oberstufenschüler schmissen ihre Hüte in die Luft, und die Lehrer sahen aus, als hätten sie gerade ein großes Abenteuer zusammen erlebt, aus dem sie mit jeder Menge Insiderwitzen wieder aufgetaucht waren.
In Wahrheit war die Midhurst jedoch eine dieser Schulen, in denen Kaugummis unter den Tischplatten klebten, altmodische Möbel herumstanden, Lehrer klapprige Autos fuhren und seltsam muffige Gerüche in wahllosen Ecken der Korridore hingen. Wir trugen zwar Schuluniformen, aber selbst die waren bescheuert. Lediglich blaue T-Shirts mit dem Schulwappen groß auf die Brust gedruckt und dazu dunkle Hosen oder Faltenröcke. Sie sahen eher aus wie ein Trikot oder irgendwas, das man in einem Sommercamp trug.
Und dann gab es da noch die Schulregeln. In dieser Hinsicht konnte Midhurst es ziemlich gut mit anderen Internaten aufnehmen. Nachtruhe, Kleiderregeln, Vorschriften zu Frisur, Make-up, Socken und Schuhen. Eine Null-Toleranz-Regel, was Rauchen, Alkohol und Drogen anging. Versammlungen in den Schlaftrakten nach 21:00 Uhr verboten. Jungs im Mädchenflügel und anders herum strengstens verboten. Keine Handys im Speisesaal oder im Unterricht. Auf keinen Fall während des Unterrichts ohne Erlaubnis auf die Toilette gehen. Kein Essen in der Wäscherei, in den Klassenzimmern und auf den Fluren. Kein Kaugummi. Niemals ohne Erlaubnis das Schulgelände verlassen. Keine Sportgeräte im Hauptgebäude. Keine Musik nach 21:00 Uhr. Musik generell niemals lauter als »angenehme Zimmerlautstärke«. Keine Kartenspiele oder Bälle in den Schlaftrakten oder auf den Fluren. Kein Geld von anderen Schülern leihen. Kein Rennen in den Fluren. Und so weiter. Internate sind echt gut darin, sich Wege auszudenken, wie sie dein Leben auf klaustrophobische Weise einschränken können. Allerdings wurden 75 Prozent dieser Regeln regelmäßig gebrochen, und im Grunde wussten das alle, auch die Lehrer.
Es war ganz in Ordnung. Wenn man sich erst mal zurechtgefunden hatte, war es ganz in Ordnung.
Die Schule ging in der zweiten Januarwoche wieder los. Ich kam am Abend vorher an und fand in meinem Zimmer meine Mitbewohnerin vor, die ihre Sachen bereits ausgepackt hatte und Mamma Mia! (ja, das Musical) über ihren Lautsprecher hörte.
Ich schmiss meine Tasche auf den Boden. »Oh nein. Verdammt noch mal, bitte nicht das.«
»Hi, Grace. Schön, dich zu sehen«, erwiderte sie und zeigte mir den Stinkefinger.
»Mach den Scheiß aus!«
»Das hier ist auch mein Zimmer.«
»Meine Ohren!«
Sie saß auf dem Rand ihres Bettes und sah zu, wie ich meinen Koffer auspackte. Ich sortierte meine Klamotten ein und reihte meine Notizbücher neben meinem Nachttisch auf. In diesen Büchern hatte ich bereits gut fünfzehn Romane angefangen. Ich fing über so gut wie alles an einen Roman zu schreiben, aber mir fiel es schwer, bei auch nur einem über das erste Kapitel hinauszukommen. Der einzige andere Gegenstand von Bedeutung, den ich mitgebracht hatte, war meine Steinschleuder. Einen Moment lang starrte ich sie an und ließ sie dann in die Sockenschublade fallen. Ich hatte sie mit sechs bekommen und jahrelang beinahe jeden Tag benutzt. Auf eine gewisse Art handelte es sich um den stichhaltigsten Beweis meiner Kindheit – ein Gegenstand, der mehr als alles andere für diese Jahre meines Lebens stand. Ich fragte mich, warum ich die Steinschleuder mitgebracht hatte, und kam zu dem Schluss, dass es wohl darum ging, einen Beleg aus einer Zeit zu haben, in der ich mich nicht neben Toiletten in den Schlaf geweint hatte und mich nichts einschüchtern konnte. Ich wollte mir in Erinnerung rufen, dass ich mal ein Rückgrat gehabt hatte.
»Also, was ist los?«, fragte sie, während ihre Augen weiterhin jede meiner Bewegungen aufsogen.
»Abgesehen von der Tatsache, dass deine Musik meine Trommelfelle vergewaltigt, während wir hier reden?«
»Ohne Witz. Du siehst übel aus. Ungesund irgendwie«, stellte sie fest. »Dein Gesicht ist ganz verquollen und an komischen Stellen fett.«
»Danke.«
»Das sollte nicht gemein klingen. Ich sag nur die Wahrheit.«
»Das weiß ich sehr zu schätzen.«
Trotz unserer vielen Meinungsverschiedenheiten kamen Georgina Lowry und ich ganz gut miteinander aus. Wir waren keine Freundinnen, aber wir waren auch nicht tief genug in das Leben der jeweils anderen involviert, um Feindinnen zu sein. Tatsächlich würde ich so weit gehen, zu behaupten, dass irgendwo zwischen den vielen Schichten nach außen getragener Gereiztheit ganz schwach eine gewisse Loyalität pulsierte. Wie eine feine Vene, tief vergraben in einer Masse aus überschüssigem Fett. Natürlich wären wir lieber gestorben, als es offen zuzugeben, dennoch wussten wir beide, dass es da war – die unvermeidliche Verbindung, die entsteht, wenn man auf engstem Raum zusammengesteckt wird.
Georgina hatte dunkelblonde Haare, ein breites Gesicht und ultrahelle Augen. Dieses Kristallblau, das als schön durchgehen kann, einem aber auch furchtbar auf die Nerven geht. Ihr Körper war sportlich, stämmig und wirkte irgendwie kompakt, aber nicht durch Fett, sondern wegen der vielen Muskeln. Ich erwischte sie oft dabei, wie sie auf dem kleinen Streifen Fußboden zwischen unseren Betten eigenartige Bein- und Bauchmuskelübungen machte. Sie kannte all die Atemtricks, wann man bei den Übungen ein- und wieder ausatmen musste, und während sie trainierte, stieß sie die Luft professionell in kleinen, aggressiven Stößen aus. Ich musste ständig um sie herumbalancieren, während sie mit erhobenen Beinen auf dem Boden herumturnte und ihr Abdomen in kleinen Drehungen nach rechts und links hüpfte. Sie war im Volleyballteam und nahm die Sache so ernst, dass es beinahe schon einer Religion gleichkam.
Außerdem war sie reich. Unser Zimmer war vollgestopft mit ihren Sachen: Klamotten, Schuhe, Sportkram, Dekokissen, Glätteisen und Lockenstab, gerahmte Illustrationen mit inspirierenden Zitaten, ein Luftentfeuchter, ein Minikühlschrank, Familienfotos, kleine Schmuckkästchen, Haarbänder und so weiter. Ich besaß einige wenige Kleidungsstücke, ein paar Bücher und einen Laptop, der jedem Schüler zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt wurde. Eigentlich war es viel mehr ihr Zimmer als meins, und obwohl sie nicht boshaft dabei war, gab es ihr einen Kick, dass ich unterprivilegiert war, wie sie es nannte. Allein das Wort fand sie lustig. Exotisch. Sie fand es faszinierend, dass ich mir nicht einfach Dinge kaufen konnte oder dass ein erheblicher Teil meiner Klamotten aus Kleiderspenden stammte. Wenn sie sah, wie ich mit mir rang, ob ich ein paar Cents in den Snackautomaten steckte, konnte sie nie widerstehen, einen Witz darüber zu machen. Jedes Mal. Sie war immer spielerisch dabei, meinte es humorvoll, aber es mangelte ihr an jeglichem Taktgefühl. Manchmal kriegte sie mich damit. In der Abteilung für Witze und gesellschaftliche Umgangsformen war Georgina ein Riesentrampeltier.
Doch trotz unserer Streitigkeiten und Diskussionen konnte ich nie wirklich meine Wut an ihr auslassen. Sie hatte etwas so verzweifelt Uncooles an sich, dass mich die Art Loyalität für immer an sie band, wie man sie nur einer Mitbewohnerin, einem dummen Geschwisterkind oder einem Landsmann an einem fernen Ort entgegenbringt. Da waren ihr grellpinkes Sportstirnband, das sie jeden Tag im Haar hatte, ihr unmöglicher Musikgeschmack und die Art, wie sie ihre Klamotten trug. Ein Mädchen, von dem die ganze Schule wusste, dass sie ein hoffnungsloser Fall war. Die Jungs würdigten sie keines Blickes, und die Mädchen ließen sie links liegen. Selbst das Volleyballteam war kein großer Fan von ihr. Sie war nicht direkt eine Außenseiterin oder jemand, der herumgeschubst oder gehänselt wurde – dafür war sie zu reich, und Wohlstand hatte Gewicht an unserer Schule –, aber sie war ganz eindeutig uncool. Geradezu quälend uncool.
»Was hast du zu Weihnachten bekommen?«, fragte Georgina, nachdem ich geduscht hatte und mich bettfertig machte.
»Hauptsächlich Bücher.«
Sie wartete darauf, dass ich ihr die gleiche Frage stellte, und als ich es nicht tat, sagte sie: »Ich hab Klamotten gekriegt und diese Cowboystiefel, die ich schon seit einer Ewigkeit haben wollte. Ah, und das Allerbeste: Meine Eltern fliegen in den Osterferien mit mir nach Paris.«
Ich sah sie nur an, zu erschöpft, um Interesse zu heucheln.
»Paris, wie geil ist das bitte!«, quiekte sie.
»Ja.«
»Mann, du bist manchmal echt ’ne Spaßbremse«, sagte sie, löschte das Licht und wälzte sich heftig in ihrem Bett herum.
Ich erwiderte nichts. Ich dachte an den kommenden Tag und wie unwirklich mir alles vorkam. Ich würde Mr. Sorrentino sehen. Ich hatte keine Wahl. Dabei konnte ich mir keine Realität vorstellen, in der Mr. Sorrentino und ich uns je wieder in derselben Zeit und demselben Raum aufhielten. Ich hatte in den Ferien so viel an ihn gedacht, dass er sich von einem normalen Menschen in eine Kreatur mythischen Ausmaßes verwandelt hatte. Er war nicht mehr sterblich. Nicht mehr der charismatische, freundliche Mann aus Fleisch und Blut, der mit mir über Mitochondrienwitze lachte und mir Zwinkersmileys auf meine Tests malte. Nein, er hatte sich in eine schreckliche Gottheit verwandelt, die mein ganzes Leben in ihren Händen hielt. Ich war nicht mehr Herrin meiner selbst. Ich gehörte jetzt ihm.
Ich knipste das Licht wieder an, um diesen Gedanken in meinem Tagebuch festzuhalten, aber da Georgina Stunk machte, knipste ich es wieder aus.
4
Biologie war meine erste Unterrichtsstunde nach dem Mittagessen. Voller Angst stand ich mit dem Rücken gegen die gegenüberliegende Wand gepresst im Flur vor Mr. Sorrentinos Klassenzimmer und starrte auf die Tür. Meine Steinschleuder klemmte im Bund meines Rocks. Als emotionale Stütze sozusagen. Als ich sie am Morgen aus meiner Schublade gezogen und in meinen Rock geschoben hatte, hatte ich es für eine super Idee gehalten, aber als ich nun hier stand, musste ich feststellen, dass sie überhaupt keine Stütze war. Keine Ahnung, wie lange ich vor Mr. Sorrentinos Tür wartete. Schüler strömten mit geröteten Gesichtern und dem üblichen Lärm hinein. Ihre Augen entweder mitten im Witz aufgerissen oder unsagbar gelangweilt und mit lustlosem, schlurfendem Gang, einem Montagmorgen angemessen.
Als die Glocke zum letzten Mal läutete, stand ich immer noch reglos mit meinen Büchern gegen die Wand im Flur gelehnt. Ich hörte, wie Mr. Sorrentinos Stimme begann, die Namensliste zu verlesen, und wandte mich zum Gehen.
Wohin, wusste ich nicht, aber das war auch nicht weiter wichtig. Ich schlüpfte durch den Hintereingang aus dem Schulgebäude, ging an den Tennisplätzen vorbei und machte erst halt, als ich am Ende des Schulgeländes angelangt war. Dort hinten gab es nicht viel außer einer Mauer, die um das gesamte Gelände verlief, und ein paar Geräteschuppen. Ich ließ mich neben einen Baum fallen, schloss die Augen und genoss das Gefühl warmer Tränen, die über meine Wangen strömten. Wenn man traurig ist, hat Weinen etwas für sich. So gern ich mir auch eine dafür verpasst hätte, dass ich so ein rückgratloser Loser war, so schön war es auch, sich in der herrlichen Schwärze meiner Gefühle zu suhlen. Darum ließ ich es einfach zu. Dann grunzte ich und zog die Steinschleuder aus meinem Rockbund, weil sie sich ziemlich unangenehm in meinen Rücken grub. Ich ließ sie neben mir ins Gras fallen, nahm mein Notizbuch heraus und blätterte bis zu einer leeren Seite. Ganz oben schrieb ich Mitternacht in meinem Herzen und darunter: Kapitel 1. Ich holte tief Luft und dachte einen Moment nach. Doch dann wurde ich von lauten Rufen und schnellen Schritten unterbrochen, die durch das Gras hasteten.
Hektisch wischte ich mir die Tränenspuren aus dem Gesicht, klappte mein Notizbuch zu und drehte mich um. Eine Gruppe Jungs kam quer über den Schulhof in meine ungefähre Richtung gerannt. Genauer gesagt, drei Jungs, die einen vierten jagten, der etwas jünger aussah. Ich meinte, ein paar von den älteren zu erkennen – alle aus der Oberstufe –, aber der andere musste neu sein, denn ich hatte ihn noch nie gesehen. Als ihm klar wurde, dass er in einer Sackgasse gelandet war, verlangsamte er seine Schritte. Vor ihm erstreckte sich die Mauer – er saß in der Falle. Er blieb stehen und drehte sich schwer atmend zu den anderen um. Sie kreisten ihn langsam ein. Jetzt erkannte ich sie ohne Zweifel. Der große war Derek McCormick – ein Typ aus der Oberstufe, dem alle Mädchen wegen seines Aussehens und seiner Arschlochqualifikationen nachrannten. Die anderen beiden waren Neal Gessner und Kevin Lutz. Ein berühmt-berüchtigtes Trio, das zusammenhielt wie eine chemische Verbindung.
Als ihnen klar wurde, dass ihr Opfer in der Falle saß, ließen sie sich Zeit, um voll auskosten zu können, wie ungleich dieser Kampf war. Zur Eröffnung gab es einen Schubs, der den Neuen zurückstolpern ließ, bevor er sich wieder fing. Derek, ganz offensichtlich der Anführer des Trios, trat mit einem harmlosen Grinsen vor, das sich über sein ganzes Gesicht erstreckte, als würde er gerade in einer Werbung Frisbee spielen oder so was. In dem Moment wirkte er wie ein so krasses Stück Scheiße, dass es schon fast faszinierend war. Wie aus dem Nichts unterbrach der Neue Dereks Auftritt, indem er ihm einen überraschend soliden Kinnhaken verpasste. Damit überrumpelte er alle, mich eingeschlossen. Nachdem er ein paar Schritte zurückgetaumelt war, richtete Derek sich auf und schlug zurück – in den Bauch, und die anderen beiden stiegen sofort ein, quasi mit Schaum vor dem Mund. Der Neue ging zu Boden. Ohne nachzudenken, hob ich ein paar Schottersteine vom Boden auf. Die kleine Gruppe hatte mich nicht bemerkt. Sie waren zu beschäftigt damit, den Jungen zu umringen und abwechselnd auf ihn einzutreten. Als ich nahe genug war, platzierte ich einen anständig großen Stein in meine Steinschleuder, zog das Gummi zurück und spannte es so, dass der Stein gerade fliegen und der Schuss eher soft ausfallen würde. Dann zielte ich auf Dereks Gesicht. Genauer gesagt, auf sein linkes Ohr. Er hatte sich gerade aufgerichtet, um Luft zu holen. Der Stein traf ihn hart, genau dort, wo ich hingezielt hatte, und Derek sprang mit einem Schrei zurück.
Sein Kopf fuhr herum, und als er mich entdeckte, starrte er mich mit einer Hand auf dem Ohr völlig perplex an. Ich bezweifle, dass er verstand, was geschehen war. Sein Mund stand leicht offen vor Verwirrung, und sein Gesicht war vollkommen reglos. Ein perfektes Ziel. Ich schoss erneut.
»Was zur Hölle!«, heulte er auf, als der zweite Stein seine Wange aufriss.
Ich hatte zwar irgendwie gewusst, dass ich noch schießen konnte, aber als ich ihn zum zweiten Mal an exakt der Stelle traf, auf die ich gezielt hatte, war ich begeistert. Es musste mindestens ein Jahr her sein, dass ich zuletzt auf irgendwas geschossen hatte. Früher hatte ich es irgendwann so draufgehabt, dass ich alles im Schlaf hätte abschießen können. Aber das war noch in meiner Grundschulzeit zu Hause gewesen. Mein Atem wurde schneller. Ich verspürte ein befriedigendes Gefühl der Vollendung und erinnerte mich wieder, wie sehr ich den Adrenalinrausch nach einem perfekten Schuss immer genossen hatte.
Niemand wusste, was als Nächstes zu tun war. Alle vier starrten mich an und ich sie. Ich war kein Junge und sie keine Mädchen, deshalb konnten wir die Sache nicht auf die übliche Art regeln. Sie wollten sich bewegen, aber wohin und zu welchem Zweck? Ehrlich gesagt, wusste ich auch nicht so recht, was ich tun sollte. Meine letzten Schulhofauseinandersetzungen lagen schon eine Weile zurück.
»Hey, was zur Hölle!«, rief Derek erneut und massierte sich das Ohr, während er mich anstierte wie ein verletztes Nashorn – erschrocken und empört, als wären die Gesetze des afrikanischen Buschs auf den Kopf gestellt worden.
»Hat sie dich gerade getroffen?«, fragte Neal mit einem Ausdruck formvollendeten Unverständnisses. »Ist das eine Steinschleuder?«
Währenddessen hatte der Neue sich aufgerappelt und nutzte die allgemeine Verwirrung, um Derek hart in die Kniekehlen zu treten. Beinahe wie von selbst ging Derek zu Boden. Für einen kurzen Moment standen seine Kumpels verwirrt da, dann jagten sie dem Neuen nach, der direkt auf mich zurannte. Ohne anzuhalten, packte er meine Hand und riss mich beinahe um, so viel Schwung hatte er drauf.
»Komm schon!«, schrie er mir zu, ohne meine Hand loszulassen.
Wir rannten. Ich hatte keine Ahnung, ob wir verfolgt wurden oder nicht. Ich drehte mich nicht um. Stattdessen heftete ich meinen Blick auf den Jungen, der mich über das Gelände zog. Den freien Arm um die eigene Mitte geschlungen, hielt er sich die Seite, und seine Schritte waren unregelmäßig, doch er rannte. Als wir richtig Geschwindigkeit aufgenommen hatten, schaffte ich es, meine Hand aus seiner Umklammerung zu ziehen. So fiel mir das Laufen leichter, und außerdem war seine schwitzige Hand der Körperteil eines x-beliebigen Menschen und umklammerte meine Finger viel zu fest. Wir rannten weiter, bis wir den Hintereingang erreicht hatten und ins Gebäude stürzten, wo wie aus dem Nichts Mrs. Gillespie, eine der Englischlehrerinnen, mit einem Stapel Papiere unter dem Arm und einer Kaffeetasse in der Hand im Flur auftauchte. Urplötzlich stand ihre unförmige kleine Gestalt direkt vor uns – grelle Blümchenbluse, passende Blazer-und-Rock-Kombi und eine frische Schönheitssalon-Frisur, die auf ihrem Kopf saß wie ein flauschiges Vogelnest. Für einen kurzen, schrecklichen Moment schien es, als würden wir sie mitreißen, doch es gelang mir, wenige Zentimeter vor ihr schlitternd zum Stehen zu kommen, und der Junge tauchte in letzter Sekunde zur Seite ab, sodass er lediglich ihre Schulter streifte, bevor er zu Boden stürzte. Mit einem spitzen Schrei sprang Mrs. Gillespie zurück, und ihre Kaffeetasse flog durch die Luft, um dann an der Wand zu explodieren. Es regnete Kaffee. Der Junge lag am Boden, und ich stand wie eingefroren ein Stück hinter ihm, in der Hand noch immer meine Steinschleuder. Ich drehte mich um, um zu sehen, ob die anderen uns gefolgt waren, doch keine Spur von ihnen.
5
»Ich heiße übrigens Wade«, sagte er.
Widerstrebend nannte ich ihm meinen Namen und starrte dann demonstrativ in die andere Richtung. Wir saßen im Sekretariat und warteten darauf, dass der Schuldirektor, Mr. Wahlberg, uns zu sich rief.
Ich war an der Schule zwar nie ernsthaft in Schwierigkeiten geraten, aber ich hatte aufgrund von Mathematik und Sport eine beständige, wenn auch harmlose Beziehung mit Mr. Wahlberg. Es handelte sich um zwei Fächer, für die ich wenig bis gar keinen Aufwand betrieb, weil sie für mein Dasein vollkommen irrelevant waren. Daher hatte ich keine Einwände, wegen ihnen regelmäßig in sein Büro geschickt zu werden. Tatsächlich zog ich das Sekretariat dem Sport- oder Matheunterricht bei Weitem vor, und mit der Zeit war mir der Ort vertraut geworden. Die Topfpflanzen, die schlechten Ölgemälde von Mr. und Mrs. McCleary, die die Schule im Jahr 1973 gegründet hatten, das Aushangbrett, das Personalfoto, der hellgraue Teppich und der Fleck an der Decke neben der Tür zum Flur. In gewisser Weise mochte ich das Sekretariat. Seine Vorhersehbarkeit hatte etwas Beruhigendes. Außerdem war es voller Erwachsener, und manchmal musste ich dem hormonellen Blutbad, das einen Großteil des Schullebens ausmachte, mal für einen Moment entfliehen. Erwachsene waren so viel lethargischer. Das konnte entspannend sein.
Diesmal war es jedoch anders. Während ich darauf wartete, in Mr. Wahlbergs Büro gerufen zu werden, spürte ich, wie sich in meinem Nacken kalter Schweiß sammelte und mir flau im Magen wurde. Wir hatten uns in eine ordentliche Menge Scheiße manövriert, aber das war es nicht, was mich nervös machte. Es waren die sozialen Begleiterscheinungen, in denen ich gelandet war: dieser Mensch, der mit seinem auf und ab hüpfenden Knie nur Zentimeter von mir entfernt saß und mit mir zu reden versuchte, als stünden wir nun auf der gleichen Seite von irgendwas. Darum hatte ich nie gebeten. Alles, was ich gewollt hatte, war gewesen, Derek ins Gesicht zu schießen, weil er ein Wichser erster Klasse war. Es hatte mich von Mr. Sorrentino ablenken sollen – etwas, wodurch ich mich besser fühlte. Aber das war gründlich in die Hose gegangen. Irgendwie war ich nun mit diesem schwitzenden, atmenden Fremden, der ein Junge war und dessen Ellbogen bereits zweimal in meinen Arm gestoßen waren, weil er nicht still sitzen konnte, in einem Team gelandet. Allein bei der Vorstellung wurde mir schlecht.
»He!« Blind für meine Versuche, ihn durch nicht gerade subtile Körpersprache abblitzen zu lassen, tippte Wade mir auf die Schulter.
Ich warf ihm einen nervösen Blick zu.
»Hey, das war der Wahnsinn – das mit der Schleuder«, sagte er. Er hielt die Stimme gesenkt, damit Mrs. Martinez hinter ihrem Schreibtisch nichts mitbekam, stieß jedoch jedes einzelne Wort voll atemloser Aufregung aus. »Wie kommt’s, dass du mit so einem Teil schießen kannst?«
Ich wandte mich ab und richtete den Blick auf das Lehrerfoto – auf die linke obere Ecke, um genau zu sein –, wo Mr. Sorrentino stand und mich mit seinem Wen-zum-Teufel-kümmert’s-Haar anlächelte, das ihm in die Stirn fiel.
»Ich habe viel geübt, als ich jünger war«, erklärte ich.
»Warum?«
»Keine Ahnung.«
»Krass. Ich wusste nicht, dass Steinschleudern wirklich funktionieren – also, dass man mit denen echt Dinge gezielt treffen kann.«
»Dafür sind sie da.«
»Ich dachte immer, das sind nur so Spielzeuge.«
»Sind sie nicht.«
»Ja, das glaub ich dir«, sagte er lachend.
Seine Art zu lachen traf mich vollkommen unerwartet. Er hatte eine unbekümmerte Wärme an sich. So lachten Jungs nicht – zumindest nicht die coolen mit ihren übertrieben selbstsicheren, höhnischen Sprüche-Arschloch-Vibes. Selbst als ich ihm einen verstohlenen Blick zuwarf, konnte ich nicht sagen, ob Wade cool war oder nicht. Dort saß er mit hängenden Schultern und schmutzigen, abgeknabberten Fingernägeln. Keine erkennbare Frisur, einfach nur etwas zu lang herausgewachsene Haare, wahrscheinlich weil es ihm einfach egal war. Offene Schnürsenkel. Das Veilchen unterm Auge war ein Geschenk von Derek. Noch ein bisschen Babyspeck im Gesicht.
»Danke übrigens«, sagte er. »Dass du mir geholfen hast.«
Sein Blick ruhte mit derselben anziehenden Unschuld auf mir, die in seinem Lachen gelegen hatte. Es hatte wirklich allen Anschein, als wäre es ihm scheißegal, dass ich mich wie ein Arschloch verhielt.
»Ja. Ich hab’s aber nicht gemacht, weil ich dir helfen wollte«, sagte ich.
»Warum dann?«
Ich konzentrierte mich wieder auf Mr. Sorrentinos Lächeln. »Einfach nur wegen Derek. Schätze, ich kann seine blöde Fresse nicht leiden.«
»Damit kann ich leben«, sagte er mit einem weiteren Lachen.
Ich bog meinen Körper ein wenig weg von ihm und versuchte, ihm auf diese Weise klarzumachen, dass wir, nur weil uns das Schicksal Mrs. Gillespie in den Weg geschleudert hatte, noch lange nicht zu einer Art Duo mutiert waren.