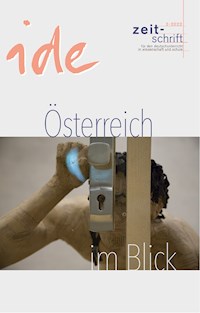
Österreich im Blick E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: ide - informationen zur deutschdidaktik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Berechtigung des Begriffes "Nation" wird glücklicherweise zunehmend infrage gestellt, allerdings gibt es nach wie vor ein Konstrukt, das wir "Österreich" nennen und dem wir eine bestimmte Geschichte und – zunehmend diverse – kulturelle Identität zuschreiben. Das vorliegende Heft möchte keine Festschreibung, wohl aber eine aktuelle Befragung dieser "Imagination Österreich" durchführen, auch wenn das ein fragmentarisches und kontingentes Unterfangen sein wird, das notwendigerweise auch immer wieder in ironischer Distanzierung zu sich selbst betrieben werden muss. Was dieses Heft dennoch leisten kann, sind Einblicke in das kulturelle Leben in Österreich, deshalb werden hier aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Literatur, Tanz, Film und Musik gezeigt und auch in didaktischen bzw. bildungspolitischen Kontexten betrachtet. Zudem eröffnet das Heft vielfältige Perspektiven auf das Themenfeld Sprache – Identität – Zugehörigkeit und stellt damit nicht zuletzt die Frage nach der (historischen und gegenwärtigen) Konstituierung eines "Wir".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial
URSULA ESTERL, NICOLA MITTERER, HANNES SCHWEIGER: Zumindest einige Fundstücke aus Österreich
Österreichische Identitäten: Einführung und Überblick
RUDOLF DE CILLIA: Sprachen und Identitäten in Österreich
HAJNALKA NAGY: Erzähl mir Österreich! Neue Fragen an ein altes Konstrukt aus literaturdidaktischer und gedächtnistheoretischer Perspektive
Literatur in und aus Österreich
MANFRED MITTERMAYER, INES SCHÜTZ: Themen, Bücher, Autorinnen, Autoren. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Rauriser Literaturtage zwischen 2013 und 2019
SANDRA VLASTA: Mehrsprachige Gegenwartsliteratur in/aus Österreich
HANNES SCHWEIGER im Gespräch mit KATJA GASSER: mea ois wia mia. Der Auftritt Österreichs als Gastland der Leipziger Buchmesse 2023
GEORG HUEMER: Zur aktuellen Kinderliteratur aus Österreich. Entwicklungslinien, Herausforderungen und Chancen
ULRIKE TITELBACH im Gespräch mit dem Schriftsteller und Literaturvermittler MICHAEL STAVARIČ: »Literatur muss Verbindungen herstellen«
Film in und aus Österreich
TINA WELKE, KLAUS REDL: Kurzfilme in/aus Österreich. Unterschätztes Format und ambitionierte Nische für kulturelle und sprachliche Begegnungen
VOLKER PIETSCH: Von Wärmedämmungen, Isolierungen und Verschalungen bei Häusern und Menschen. Die österreichischen Dokumentarfilme Was uns bindet (2017) und Im Keller (2014)
Stimmen in und aus Österreich
URSULA MAURIČ, ANJA THIELMANN: Global Citizenship Education & Philosophy for Children als methodischer Ansatz für voXmi-Schulen. Mehrsprachigkeit in p4c-Dialogues zu globalen Themen
ANNA JANDRISEVITS: Die Chefredaktion. Medienkompetenz auf Instagram
Zum Nachhören (online)
HANNES SCHWEIGER im Gespräch mit RENATE FAISTAUER und WOLFGANG HACKL: Das IDT-Kulturprogramm und seine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten
Außer der Reihe
MAX BRINNICH: Die Praxis der Aufzeichnung. Peter Handkes Die Geschichte des Bleistifts im Literaturunterricht
Service
STEFAN DE WILDE: Blicke auf und aus Österreich. Bibliographische Notizen
Magazin
AktuellesErhard-Friedrich-Preis für Deutschdidaktik 2022
ide empfiehltURSULA ESTERL: K. Gümüşay (2021): Sprache und Sein
Neu im Regal
»Österreich« in anderen ide-Heften
ide 2-2021
Wald
ide 3-2019
Maximilian I.
ide 4-2018
Normen und Variation
ide 1-2018
Literaturvermittlung
ide 2-2017
Die Donau – Länder am Strome
ide 4-2015
Sprachliche Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit
ide 2-2015
Kulturen des Erinnerns
ide 3-2014
Österreichisches Deutsch und Plurizentrik
ide 1-2014
Berge
ide 3-2013
Identitäten
Das nächste ide-Heft
ide 3-2022
Kurze Filme
erscheint im September 2022
Vorschau
ide 4-2022
Vergnügen
ide 1-2023
ÜberGEsetzt
https://ide.aau.at
Besuchen Sie die ide-Webseite! Sie finden dort den Inhalt aller ide-Hefte seit 1988 sowie »Kostproben« aus den letzten Heften. Sie können die ide auch online bestellen.
www.aau.at/germanistik/fachdidaktik
Besuchen Sie auch die Webseite des Instituts für GermanistikAECC, Abteilung für Fachdidaktik an der AAU Klagenfurt: Informationen, Ansätze, Orientierungen.
Zumindest einige Fundstücke aus Österreich
Die Definition des Begriffes »Nation« wird glücklicherweise zunehmend infrage gestellt, allerdings gibt es nach wie vor ein Konstrukt, das wir »Österreich« nennen und dem wir eine bestimmte (Mentalitäts-)Geschichte und – zunehmend diverse – kulturelle Identität zuschreiben. Das vorliegende Heft möchte keine Festschreibung, wohl aber eine aktuelle Befragung dieser »Imagination Österreich« durchführen, auch wenn das ein fragmentarisches und der Vorläufigkeit unterworfenes Vorhaben ist. Wenn man den Namen des Landes, in dem man hauptsächlich lebt und beispielsweise beschult wird, nennt, scheint das eine gewisse Art von Zugehörigkeit zu definieren. Immer mehr Menschen erleben jedoch die Kontingenz von (nationalen) Zugehörigkeiten und die großen Schwierigkeiten, die damit verbunden sein können, ein zumindest zeitweiliges »Zuhause« zu finden. Derart fragile »Grenzerfahrungen« machen immer mehr Menschen, solche, die nach Österreich kommen, und auch solche, die dieses Land verlassen, um sich anderswo niederzulassen. Der Weltbürger Ilija Trojanow, der eine seiner zahlreichen Heimaten auch in Wien gefunden hat, schreibt dazu in seinem »Erinnerungsbuch« Der entfesselte Globus: »Es gibt keine Heimat, die nicht zur Fremde werden könnte, und umgekehrt. Es hat mich immer wieder erstaunt, wie selbstverständlich etwas werden kann, das anfänglich irritierend oder gar inakzeptabel wirkte.« (Trojanow 2008, S. 8) Das mag ausschließlich für das Erleben von Menschen gelten, die ihren Lebensmittelpunkt (mehrfach) gewechselt haben, aber diese Erfahrung gilt auch in umgekehrter Logik: Etwas, das ganz und gar vertraut wirkte, kann jederzeit fremd und irritierend erscheinen (vgl. Freud 1997, S. 241–274), auch für jene, die zeitlebens an einem einzigen Ort verweilen. Die äußeren Veränderungen, die wir erleben können, stehen den inneren in nichts nach und so kann die vertrauteste Umgebung etwa allein durch die Wandlungen, die das Altern mit sich bringt, durch Krankheit, den Verlust oder Zugewinn eines geliebten Menschen, sehr unterschiedlich wirken und sich im Zuge dieser Veränderungen als ebenso »befremdlich« erweisen wie eine andere Kultur. Selbst diejenigen Menschen, die ihren Geburtsort nie verlassen, machen also jene existenzielle Erfahrung, die Trojanow beschreibt, wenn er von der Sehnsucht nach einem Zuhause spricht: »Es gab Zeiten, da sehnte ich mich nach Rückkehr. Bis ich begriff, daß meine Herkunft kein Raum ist, der für mich reserviert ist, den ich nur aufsperren und entstauben müsste, um wieder einziehen zu können.« (Ebd.) Die Dichterin Rose Ausländer macht mit ihrer Rede vom »Mutterland Wort« (Ausländer 1999, S. 54) deutlich, dass die Sprache selbst in dunkelsten Zeiten eine Behausung sein kann, in die sich der Mensch vor den äußeren Bedrohungen zurückzuziehen vermag, wenn er denn in der Lage ist, sich der gewohnten und womöglich missbrauchten Strukturen kreativ zu bedienen. Zeitlich gesehen lernen wir aber noch vor diesen Fähigkeiten von Sprache, die sich nach innen richten, deren nach außen gerichtete Macht kennen, die das Individuum zu einem Außen, einem Kollektiv in Verbindung zu setzen oder auch aus diesem auszugrenzen vermag. In einer Welt, in der immer mehr Menschen auf engem Raum mit anderen zusammenleben, die, zumindest auch, eine andere Sprache sprechen, ist ein Bewusstsein für die Bedeutsamkeit der sprachlichen Teilhabe an Gemeinschaften besonders wichtig. Wie grundlegend diese ist, kommt oft erst dann zu Bewusstsein, wenn sie sich nicht mehr bietet: »Wie wichtig Sprache ist, weil wir damit die Welt um uns benennen, sie bezeichnen, ihr Bedeutung verleihen und uns darüber mit anderen verständigen, wird deutlich, wenn man das Gefühl hat, dass einem Sprache nicht zur Verfügung steht.« (Busch/Busch 2008, S. 9)
Dieses Heft erscheint in enger Anbindung an die XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT), die von 15. bis 20. August 2022 in Wien stattfindet. Mit dem Motto *mit.sprache.teil.haben stellt die IDT 2022 die Bedeutung des Sprachenlernens und -lehrens für gesellschaftliche Teilhabe in den Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit Identität und Zugehörigkeit spielt in einer Migrationsgesellschaft wie jener Österreichs eine zentrale Rolle, sowohl mit Blick auf den Bildungs- als auch den Kulturbereich, wie die facettenreichen Beiträge dieses besonderen Themenhefts zeigen sollen.
Den Eindruck, über Sprache nicht im eigentlichen Sinne verfügen zu können, betrachten viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller allerdings als eine notwendige Bedingung ihres Schreibens. Nicht zuletzt deshalb, weil Literatur immer eine Fremdsprache und ein Hort des Fremden im Eigenen ist, ist dieser Kunstform ein recht umfangreiches Kapitel gewidmet. Gerade in der Literatur »zeigt sich Sprache in ihrer konstitutiven Mehrdeutigkeit und wird gleichermaßen für eine Reflexion der Mechanismen der Bedeutungsbildung wie als fundamental kreative Ressource neuer Ausdrucksmöglichkeiten zugänglich« (Dobstadt/Riedner 2021, S. 398). In der Begegnung mit literarischen Texten ist auch das Erleben der tiefen Verbindung und noch tieferen Spaltung möglich, die die menschliche Sprache mit der Wirklichkeit verbindet und von dieser trennt. Dabei bedarf es vielleicht erst der Kenntnis einer Fremdsprache, um die Fesseln abstreifen zu können, die einem die zuerst erlernte angelegt hat. Georges-Arthur Goldschmidt reflektiert darüber in seinem umfangreichen Essay Der Stoff des Schreibens, wo er nach der Erfahrung des Nationalsozialismus der französischen Sprache, die er im Exil auch als Schriftsprache verwendete, bedurfte, »um dem Deutschen seine Unschuld zurückzuerstatten« (Goldschmidt 2005, S. 149 f.). Dabei betrachtet er diese Erfahrung einer notwendigen Bilingualität allerdings nicht als ein Spezifikum seiner Zeit, sondern als eine Konstante, die in der Erfahrung von Schriftsteller_innen und Philosoph_innen quer durch die Jahrhunderte aufbewahrt ist. Er bezieht sich dabei auf Heinrich Heine ebenso wie auf Georg Lichtenberg, der bereits im Jahr 1775 schrieb: »Ich bin eigentlich nach England gegangen um deutsch schreiben zu lernen« (zit. nach Busch/Busch 2008, S. 100; Hervorh. i. O.). Einer solchen Auffassung von Sprache folgend, sind Österreichs mittlerweile meist mehrsprachige Klassenzimmer ein Schatz, der sich allerdings nicht so leicht heben lässt. Darüber schreiben unter anderem Ursula Maurič und Anja Thielmann, wenn sie zunächst die zentralen Anliegen des Schul- und Bildungsnetzwerkes voXmi vorstellen und daran anschließend von einem Projekt berichten, in dessen Rahmen sie versucht haben, dem Begriff der Global Citizenship Education in Verbindung mit einer Philosophy for Children eine sprachliche Basis zu geben, die allen Teilhabe ermöglicht. Wege dazu möchte auch die Chefredaktion, die uns von Anna Jandrisevits vorgestellt wird, eröffnen. Die 2021 von Melisa Erkurt gegründete Plattform ist angetreten, den Journalismus für junge Menschen in Österreich zu revolutionieren und bekommt in diesem Versuch von ihren mittlerweile rund 28.000 Follower_innen recht. Jandrisevits beschreibt, auf welchen Prinzipien dieses Vorhaben basiert, das demnächst auch für Lehrpersonen noch besser nutzbar gemacht werden soll.
Die in Ungarn geborene, heute in Frankreich lebende Schriftstellerin Ágota Kristóf macht uns in Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung darauf aufmerksam, dass nicht nur die gesprochene Sprache und jene, die wir in der Schrift niedergelegt haben, zu uns spricht. Vor allem zu Beginn unseres Lebens sind es vielmehr die sinnlichen Eindrücke, die Dinge und schließlich auch die hörbar werdenden Stimmen und Geräusche der Umgebung, die zu uns sprechen: »Am Anfang gab es nur eine einzige Sprache. Die Objekte, die Dinge, die Gefühle, die Farben, die Träume, die Briefe, die Bücher, die Zeitungen waren diese Sprache.« (Kristof 2007, S. 31) In Anbetracht der zahlreichen neu entstehenden literarischen Texte, in denen Tiere und Dinge Geschichten erzählen, wird uns diese Dimension von Sprache wohl auch im Erwachsenenalter immer stärker zu Bewusstsein gebracht. Was in der Literatur hör- und spürbar wird, erfährt im Film eine hin und wieder geradezu unheimliche, mitunter auch aufdringlich-voyeuristische Sichtbarkeit. Davon berichtet der Beitrag von Volker Pietsch, der sich mit Ulrich Seidls Im Keller (2014) und Yvette Löckers Was uns bindet (2017) beschäftigt. Seidls Film, in dem er uns einen – von der Kamera stark gelenkten – Blick in die Untiefen österreichischer Keller werfen lässt, erfordert eine sensible Szenenauswahl, wenn er im Unterricht genutzt wird, allerdings ist der Effekt dieser Bilder erfahrungsgemäß eindrucksvoll und führt zu Diskussionen über das Fremde im Eigenen, das noch selten eine so starke Inszenierung erfahren hat. Viel ruhiger hingegen der Film Yvette Löckers, einer mittlerweile in Berlin lebenden Regisseurin, die im österreichischen Lungau (Bundesland Salzburg) aufgewachsen ist. Die Kamera begleitet einen Besuch der Regisseurin bei den mittlerweile getrennt, aber unter einem Dach lebenden Eltern, die nun das Erbe unter ihren drei Töchtern aufteilen möchten. Löcker hebt diese Frage nach einer »Hinterlassenschaft« auf eine andere Ebene, indem sie danach fragt, was Menschen aneinander und an ihre Herkunftsorte bindet, und vermag zu zeigen, dass die Antworten darauf nur ambivalent und vorläufig sein können und dass die widerstreitenden menschlichen Wünsche nach Bindung und Distanz ihren Ursprung nicht in der Ferne, sondern in der familiären Geborgenheit und deren erdrückender Enge haben.
Ein weiterer Beitrag zum Thema Film stammt von Tina Welke und Klaus Redl und stellt uns insbesondere den preisgekrönten österreichischen Kurzfilm Die Waschmaschine (2020) vor, der sich aufgrund seiner Kürze und seines humoristischen Potenzials als für den Unterricht besonders geeignet erweist. Der Wunsch, »nicht so zu sein«, Stereotype und Vorurteile in einer komplexen Welt nicht zu bedienen und in der eigenen Begrenztheit und Unzulänglichkeit doch nicht anders zu können, wird hier als ein Alltagsphänomen inszeniert, dessen Vertrautheit und Tragik wir uns als Rezipient_innen kaum entziehen können. Idiom und Ästhetik sorgen dabei für österreichisches Lokalkolorit, das der Geschichte allerdings nichts von ihrer Allgemeingültigkeit nimmt.
Die österreichische Literatur, der auch in regelmäßigen Abständen einzelne Hefte der ide-Reihe gewidmet werden, ist ein »zu weites Feld« – um mit Theodor Fontane einen Schriftsteller deutscher Herkunft zu zitieren –, als dass sie in einem Heft wie diesem in all ihren Facetten präsentiert werden könnte, zumal sich die Frage stellt, was das denn eigentlich sei – Literatur, die in Österreich entstanden ist? Literatur von in Österreich geborenen Schriftsteller_innen, ganz unabhängig davon, wo sie derzeit leben? Literatur, die dem österreichischen Kanon zugerechnet wird? Wir konnten all diese Fragen im hier gegebenen Rahmen nicht ausreichend erörtern und haben uns dazu entschlossen, einzelne, möglichst vielfältige Schlaglichter auf das zu werfen, was man unter der einen oder anderen Perspektive eben unter österreichischer Literatur verstehen könnte. Das Kapitel beginnt mit einem Beitrag von Manfred Mittermayer und Ines Schütz, die seit 2013 eine bedeutsame Institution des österreichischen Literaturbetriebs, die »Rauriser Literaturtage«, organisieren und beseelen. Sie beide blicken als Expert_innen für zeitgenössische Literatur auf die Themenprogramme der Jahre 2013 bis 2019 zurück und wagen sich dabei an die schwierige Frage heran, ob sich in diesem Feld beschreibbare Tendenzen und Veränderungen ausmachen lassen. Die Überschriften der sieben nach Jahren gegliederten Kapitel, in denen mehr als 60 Bücher vorgestellt werden, lassen vermuten, dass es literarische Themen gibt, die sich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt aufdrängen, auch wenn sie dann ganz unterschiedliche literarische Texte hervorbringen. Die dichten Kurzbeschreibungen der Texte durch Mittermayer und Schütz stellen dabei nicht nur einen reichen Fundus an zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur dar, sondern mögen auch als Einladung zu dieser Veranstaltung verstanden werden, die an einem ganz besonderen Ort Österreichs stattfindet, dessen Natur wesentlich mehr ist als bloß eine Kulisse. An diesen Beitrag knüpft jener von Sandra Vlasta im Sinne einer Vertiefung und Erweiterung des genannten literarischen Repertoires an, denn sie setzt sich gezielt mit der mehrsprachigen Literatur auseinander, die in jüngerer Zeit in Österreich entstanden ist und stößt dabei auf die Frage, inwiefern eine »nationale Literatur« mit Identitätsentwürfen verbunden ist bzw. verbunden sein muss und ob die – mitunter auch verlagsseitig betriebene – »Etikettierung« von Büchern Segen oder Fluch ist.
Mehrsprachigkeit ist auch ein zentrales Element des Auftritts Österreichs als Gastland bei der Leipziger Buchmesse 2023, der von Katja Gasser als künstlerischer Leitung kuratiert wird. Sie stellt im Gespräch mit Hannes Schweiger das Begleitprogramm vor, das im März 2022 eröffnet wurde und im Jahr bis zur Buchmesse 2023 eine Vielzahl an vielfältigen Veranstaltungen zu Literatur aus Österreich bietet. Lesungen, Theateraufführungen, Installationen, Ausstellungen, Aktionen im öffentlichen Raum und ein Literaturwettbewerb – all dies steht unter dem Motto »mea ois wia mia« (»mehr als wir«) und damit wird auch das »Wir«, das mitunter leicht über die Lippen kommt, befragt und in Frage gestellt und als mehrsprachiges und kulturell heterogenes »Wir« präsentiert. In ihren Überlegungen zu den Leitgedanken der Programmierung dieses Gastlandauftritts kommt Katja Gasser auch immer wieder auf die Konstruktion einer nationalen Identität zu sprechen, die sie als fragil und in steter Veränderung begreift.
Die Kinder- und Jugendliteratur eines Landes und einer bestimmten Zeit spiegelt die soziale Realität wohl insofern besonders deutlich wider, als sich in ihr Werte, (pädagogische) Normen und die Infragestellungen eben jener Bereiche abzeichnen. Seit den 1960er Jahren hat sich auf diesem Sektor viel verändert, wobei heute auch zunehmend eine künstlerisch anspruchsvolle All-Age-Literatur auf den Markt kommt, die gar nicht mehr eindeutig einer bestimmten Sparte zugerechnet werden kann. Gut so, würde sich die inzwischen leider verstorbene österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger wohl denken, die in ihren Erinnerungen über eine Zusammenkunft von Kinderund Jugendbuchautor_innen und Vertreter_innen von Verlagen schrieb: »Kinderbücher galten sichtlich für die meisten dieser kindertümlich befassten Herrschaften als Pädagogik-Pillen, eingewickelt in buntes Geschichterl-Papier« (Nöstlinger 2013, S. 164). Seither hat sich zum Glück Vieles verändert, was von Georg Huemer in seinem Beitrag vor allem im Nachvollzug großer Tendenzen und Strömungen, aber auch anhand von Beispielen erfahrbar gemacht wird. Weil dieses Thema von so großer Bedeutung für die österreichische Literaturgeschichte ist, wird es dann im nachfolgenden Beitrag gleich noch einmal aufgegriffen, diesmal in Form eines Gesprächs zwischen Ulrike Titelbach und dem in Brno (Tschechien) geborenen, seit seiner Kindheit in Wien lebenden und auf Deutsch publizierenden Autor Michael Stavarič. Im Zuge dieses Dialogs wird deutlich, dass das Schaffen von Literatur ganz allgemein eine grenzüberschreitende Tätigkeit ist, die sich in ihrer Innovationskraft auch nicht von Alters- oder Genrevorgaben Grenzen auferlegen lässt. Ob Sachbuch oder Erzählung, Kunstwerk für Erwachsene oder Staunen Machendes für Kinder lässt sich in seinem Werk in vielen Fällen nicht mehr sagen. Womöglich ist es gerade deshalb eine der besten Empfehlungen für einen zeitgemäßen Literaturunterricht auf der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, wo ohnehin alle festgelegten Kategorien infrage gestellt werden dürfen und sollen. Die Sichtweise Michael Stavaričs auf sein eigenes Schaffen öffnet jedenfalls zahlreiche Perspektiven, die auch in dieser Weise genutzt werden können.
Zurück an den Anfang dieses Heftes: Wie alle bereits vorgestellten Kategorien zeigen, leben wir einen Großteil unseres Lebens mit und in der Sprache, weshalb auch Imaginationen eine so bedeutende Rolle für unsere Wahrnehmung von Welt spielen. Rudolf de Cillias Beitrag erlaubt uns einen panoptischen Blick auf die Zusammenhänge zwischen Sprache und Identität in Österreich, wobei hier vor allem die Abgrenzung von den in Deutschland gesprochenen Varianten eine nähere Betrachtung erfährt. Diese Besonderheit des österreichischen Sprachbewusstseins bietet dem Deutschunterricht zahlreiche Gelegenheiten zu einer anekdotenhaften und kurzweiligen Miteinbeziehung dieser Thematik. Der Beitrag von Hajnalka Nagy beschreibt, welche »Gründungsmythen« der Nation Österreich zugrunde gelegt wurden, welche Problematik damit heute noch verbunden ist und wie sich diese Geschichte auf den Deutschunterricht ausgewirkt hat und dort immer noch nachwirkt. Es mag erstaunen, dass sie sich auf Grundlage dieser Einsichten für ein »Verlernen« des bisher prominent Platzierten ausspricht, weil nur das den Grundstein für eine differenzierte Erinnerungskultur legen kann, die die Stimmen der Marginalisierten als Teil der Geschichte Österreichs hörbar werden lässt.
Für uns als Herausgeber_innen war die inhaltliche Gestaltung dieses Heftes eine große Herausforderung. Es gibt unzählige Perspektiven, aus denen Österreich in den Blick genommen werden kann, diese Möglichkeiten sind einerseits in ihrer Weitläufigkeit reizvoll, stellen andererseits aber auch hohe Ansprüche an den Mut zur Lücke und die Geduld mit den begrenzten Darstellungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten, die uns Menschen nun einmal zu eigen sind. Schließlich haben wir uns dafür entschieden, dieses Heft am Prinzip des »zumindest« auszurichten: Es kann zumindest ein paar Einblicke in das kulturelle Leben in Österreich gewähren, zumindest in einige seiner Spielarten. So haben wir uns etwa bemüht, aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Literatur und Film zu zeigen und diese auch auf didaktische bzw. bildungspolitische Kontexte zu beziehen. Es war uns mithilfe unserer Autor_innen möglich, grundlegende Fragen an die Bedeutung von Sprachen, Identitäten und eine Erinnerungskultur zu stellen, die gerade durch die Geschichte dieses Landes auch mit den höchst problematischen Auswirkungen von politisch-sprachlichen Imaginationen wie jener der »Nation« untrennbar verbunden sind. Dennoch bleibt dieses Heft ein Sammelsurium von Fundstücken, die auch zusammengenommen zu keinem »Ganzen« führen. Und dann wären da noch Leerstellen und Lücken, die ebenfalls nicht aufzählbar sind, wobei insbesondere das »Kulturland Österreich« mit seinen vielfältigen künstlerischen Produktionen nicht ausreichend beleuchtet wurde. Stellvertretend für die reiche Szene der bildenden Kunst sei »zumindest« auf das großartige, von Osama Zatar gestaltete Kunstwerk Sosama (2014) auf unserem Cover aufmerksam gemacht.
Der Künstler erläutert sein Werk folgen dermaßen:
Sosama (»So sind wir«)
Ich – wie ich durch ein Schlüsselloch schaue, aber die Tür ist aus Glas. So sind wir – man kann sich aussuchen, wie man die Realität wahrnehmen will: ein weiter Blick – daher die Glastür – oder ein beschränkter Blick durch das Schlüsselloch. Menschen sind darauf programmiert, Dinge als Stereotype und Kategorien wahrzunehmen. Darauf verweist der enge Blick durch das Schlüsselloch. Selbst wenn es die freie Wahl gibt, Dinge in weiterer Perspektive zu sehen, bevorzugen wir den engen Blick, den wir gewöhnt sind und mit dem wir uns sicher fühlen.
Und auf der Rückseite sehen wir einen Ausschnitt aus seinem Projekt Wosama (2014):
Wosama (»Wo sind wir?«)
Der Name Wosama ist eine Mixtur aus Wien und meinem eigenen Namen (Osama). Dem Wiener Dialekt entsprechend heißt das »Wo sind wir?«. Ich benutze diesen Ausdruck als Künstlernamen, da ich versuche mich zu integrieren. Hier versuche ich zu reflektieren, wie man ein neues Territorium annehmen und trotzdem seine Identität behalten kann, die ja im Wesentlichen durch seinen Namen ausgedrückt wird.
Das künstlerische Leben Österreichs spiegelt sich auch im Kulturprogramm zur IDT. In einem Interview mit Renate Faistauer und Wolfgang Hackl lässt Hannes Schweiger die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte Revue passieren. Das Interview kann auf der ide-Webseite nachgehört werden (https://ide.aau.at/).
Einige Fundstücke werden auch noch im Service- und Magazinteil des Heftes zusammengetragen. »Außer der Reihe« denkt Max Brinnich über das Schreiben eines umstrittenen österreichischen Literaturnobelpreisträgers nach, dem vor vielen Jahren bereits ein ganzes ide-Heft gewidmet wurde (vgl. ide 4/2001). Politische Kontroversen und das Gesellschaftsbild des Autors lässt dieser Beitrag allerdings weitgehend außen vor, dafür taucht er tief in dessen Geschichte des Bleistifts ein, die – einmal mehr – Dingwelt und literarisches Schaffen in großer Nähe zueinander zeigt und deutlich macht, dass die Literatur hier eine Verbindung herstellt, die unserer alltäglichen Wahrnehmung meist entgeht. Als Lehrer ist es Brinnich ein Anliegen, diese weitreichenden Überlegungen auch in didaktischen Dimensionen zu denken, weshalb sein Beitrag mit einem Unterrichtsmodell abschließt. Zumindest einige Blicke auf Österreich versucht Stefan de Wilde in seinen bibliographischen Notizen einzufangen. In den Rezensionen von Ursula Esterl, Viktorija Ratković und Stefan de Wilde werden Publikationen vorgestellt, in denen nicht immer und überall gleichermaßen beachtete Stimmen zu Wort kommen, Stimmen, die in mehreren Sprachen sprechen und Gehör finden sollen.
Selbst wenn wir noch weitere Blicke aus unterschiedlichen Perspektiven auf Österreich geworfen hätten, so hätten wir unmöglich alle Winkel beleuchten können, und so bleibt zu hoffen, dass wir mit dieser Ausgabe zumindest ein Heft vorlegen können, das Sie über das ein oder andere informiert, hin und wieder gut unterhält und an vielen Stellen auf neue Ideen bringt. »Zumindest das« war unser Ziel.
URSULA ESTERL NICOLA MITTERER HANNES SCHWEIGER
Literatur
AUSLÄNDER, ROSE (21999): Mutterland. In: »Mutterland Wort«. Rose Ausländer 1901–1988. Hg. von Helmut Braun. Köln: AphorismA (= Schriftenreihe der Rose Ausländer-Stiftung, Bd. 7), S. 54.
BUSCH, BRIGITTA; BUSCH, THOMAS (2008): Mitten durch meine Zunge. Erfahrungen mit Sprache von Augustinus bis Zaimoğlu. Celovec/Klagenfurt: Drava.
DOBSTADT, MICHAEL; RIEDNER, RENATE (2021): Literatur und andere ästhetische Medien in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In: Altmayer, Claus; Biebighäuser, Katrin; Haberzettl, Stefanie; Heine, Antje (Hg.): Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Kontexte – Themen – Methoden. Berlin: J. B. Metzler, S. 394–411.
FREUD, SIGMUND (101997): Das Unheimliche. In: Mitscherlich, Alexander; Richards, Angela; Strachey, James (Hg.): Psychologische Schriften. Frankfurt/M.: Fischer, S. 241–274.
GOLDSCHMIDT, GEORGES-ARTHUR (2005): Der Stoff des Schreibens. Aus dem Französischen von Klaus Bonn unter Mitwirkung des Verfassers. Berlin: Matthes & Seitz.
ide. informationen zur deutschdidaktik (2001), H. 4: Peter Handke. Hg. von Fabjan Hafner, Arno Rußegger und Werner Wintersteiner. Innsbruck: StudienVerlag. Online: https://ide.aau.at/wp-content/uploads/2020/03/2001-4.pdf [Zugriff: 5.5.2022].
KRISTOF, AGOTA (2007): Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung. München-Zürich: Piper.
NÖSTLINGER, CHRISTINE (22013): Glück ist was für Augenblicke. Erinnerungen. Nach aufgezeichneten Gesprächen mit Doris Priesching. Mit einer Bibliografie von Sabine Fuchs. Wien: Residenz.
TROJANOW, ILIJA (2008): Der entfesselte Globus. Reportagen. München: Hanser.
URSULA ESTERL ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für GermanistikAECC der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Mitherausgeberin der Zeitschrift ide. Arbeitsschwerpunkte: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und Mehrsprachigkeit.
E-Mail: [email protected]
NICOLA MITTERER ist Assoziierte Professorin am Institut für GermanistikAECC der AAU Klagenfurt und Mitherausgeberin der Zeitschrift ide. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind: Ästhetik/Ästhetisches Lernen, Phänomene des Fremden und deren Auswirkungen auf hermeneutische Prozesse in Literatur, Film und bildender Kunst.
E-Mail: [email protected]
HANNES SCHWEIGER ist Assistenzprofessor am Institut für Germanistik und am Zentrum für Lehrer*innenbildung der Universität Wien. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre gehören literarisches Lernen, kulturreflexives Lernen, rassismuskritische Bildung sowie sprachliche Bildung und Sprachförderung in der Schule.
E-Mail: [email protected]
Rudolf de Cillia
Sprachen und Identitäten in Österreich
Der Beitrag erörtert die Rolle der in Österreich gesprochenen Sprachen für Identitätskonstruktionen. Dazu werden zunächst die Sprachensituation in Österreich und die sprachgesetzlichen Bestimmungen skizziert, bevor darauf eingegangen wird, welche Bedeutung die deutsche Staatssprache, welche die österreichische Varietät des Deutschen für die in Österreich lebenden Menschen hat, welche Rollen die anerkannten Minderheitensprachen, welche die der Neuen Minderheiten spielen. Zur Beantwortung dieser Fragen werden in der Analyse sowohl die sprachenpolitischen Rahmenbedingungen als auch Befunde aus dem öffentlichen, medialen sowie halböffentlichen Diskurs herangezogen. Dabei werden Ergebnisse von Forschungsprojekten zur diskursiven Konstruktion österreichischer Identitäten und zum österreichischen Deutsch, die in den Jahren 1995 bis 2020 durchgeführt wurden, berücksichtigt.
1. Sprachen in Österreich
Die überwiegende Mehrheit der in Österreich lebenden Menschen (16,7 % davon besitzen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, in Wien sind es sogar 30,8 %; Statistik Austria 2020) verwendet Deutsch (im Sinn der im Alltag vorwiegend verwendeten Sprache) als »Umgangssprache«.1 Aber Österreich ist wie alle europäischen Länder ein mehrsprachiges Land, einerseits durch anerkannte autochthone, gesetzlich und verfassungsmäßig anerkannte Minderheitensprachen (Slowenisch, Burgenlandkroatisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Romanes und die Österreichische Gebärdensprache; vgl. Bundesverfassungsgesetz [BVG] Art. 8 Abs. 2 und 3)2. Andererseits durch die nicht anerkannten neuen Minderheitensprachen wie – um nur die größten Gruppen zu nennen – die Sprachen des ehemaligen Jugoslawiens (Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch, Serbisch), Türkisch und Kurdisch, Polnisch, Albanisch, Rumänisch, Arabisch, Persisch und Chinesisch (vgl. dazu de Cillia u. a. 2020). Bei der letzten Volkszählung 2001 gaben ca. 88,6 Prozent der Wohnbevölkerung in Österreich an, ausschließlich Deutsch als Umgangssprache zu sprechen, 8,6 Prozent gaben Deutsch und eine andere Sprache als Umgangssprache an, 2,8 Prozent ausschließlich eine andere Sprache. Alle offiziell anerkannten autochthonen Minderheitensprachen Österreichs zusammengenommen wurden von ungefähr 1,5 Prozent genannt, ca. 4,3 Prozent der Wohnbevölkerung gaben Sprachen des ehemaligen Jugoslawiens an, ca. 2,3 Prozent Türkisch und Kurdisch. Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) – geschätzt ca. 10.000 Sprecher*innen – scheint nicht auf, sie wurde erst 2005 anerkannt. Deutlich »deutschsprachiger« fällt das Bild aus, wenn man nur die österreichischen Staatsbürger*innen betrachtet: 2001 machten die Deutschsprachigen 95,5 Prozent aus.
RUDOLF DE CILLIA ist Professor i. R. für Angewandte Linguistik und Sprachlehrforschung am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien (https://linguistik.univie.ac.at/ueber-uns/im-ruhestand/rudolf-de-cillia/). E-Mail: [email protected]
Grundlegend für die sprachenrechtlichen Rahmenbedingungen ist der Artikel 8 der Bundesverfassung von 1920:
Art. 8. (1) Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik.
(2) Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu ihrer gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten, zu sichern und zu fördern.
(3) Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Das Nähere bestimmen die Gesetze.3
Das sichert der deutschen Sprache eine besondere Stellung zu. Und Deutsch ist (mit Ausnahme von Regelungen für die autochthonen Minderheiten) Unterrichtssprache in den Schulen. Eine Bestimmung zum österreichischen Deutsch schließlich findet sich im österreichischen Beitrittsvertrag zur EU, das »Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union«. Danach sind 23 Austriazismen den entsprechenden bundesdeutschen Ausdrücken hinsichtlich Status und Rechtswirkung gleichgestellt, also zum Beispiel der Kren dem Meerrettich, das Obers der Sahne oder die Ribisel den Johannisbeeren4 (vgl. dazu de Cillia 1997, 1998, 2006).
Für die autochthonen Minderheitensprachen gibt es eine Reihe von gesetzlichen Schutzbestimmungen, von denen für die Lautsprachen neben dem oben erwähnten Paragraphen des Bundesverfassungsgesetzes vor allem der Staatsvertrag von 1955, Artikel 7, und das Volksgruppengesetz zu erwähnen sind. Der Artikel 7 sichert u. a. den »Anspruch auf Elementarunterricht5 in slowenischer oder kroatischer6 Sprache und auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen« zu (Abs. 2), die Zulassung der slowenischen und kroatischen Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache im gemischtsprachigen Gebiet und zweisprachige topographische Aufschriften (Abs. 3). Der Staatsvertrag vermeidet die Einführung des numerischen Prinzips. Das Volksgruppengesetz (VGG) vom 7. Juli 1976 allerdings führte – gegen den Willen der Angehörigen der Minderheiten – u. a. dieses numerische Prinzip ein, d. h. die Bindung der Rechte an die Zahl der Sprecher*innen. In der Schulsprachenpolitik existieren eigene Minderheiten-Schulgesetze für Kärnten und für das Burgenland, die u. a. zweisprachigen Unterricht in der Volksschule garantieren. Für die Österreichische Gebärdensprache existieren über die verfassungsmäßige Anerkennung hinaus (s. o.) (noch) keine weitergehenden bundesrechtlichen Schutzbestimmungen.
Zur Sprachenpolitik gegenüber den offiziell nicht anerkannten, in den letzten Jahrzehnten im Zuge von Arbeitsmigration und Fluchtmigration zugewanderten Minderheiten gibt es keine gesetzlichen Regelungen, die sprachliche Rechte (etwa vor Ämtern und Behörden) in der jeweiligen Minderheitensprache garantieren würden.7 Allerdings gibt es im Aufenthaltsrecht und Staatsbürgerschaftsrecht Bestimmungen, die von Anderssprachigen den Nachweis von Deutschkenntnissen mit standardisierten Tests verlangen, die nur für Angehörige von Drittstaaten (also nicht EU und EWR) gelten und die in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend verschärft wurden: Gab es 1995 noch keinerlei Bestimmungen die Staatssprache betreffend im Staatsbürgerschaftsrecht und Aufenthaltsrecht, so wurden 1998 das erste Mal Kenntnisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für den Erwerb der Staatsbürgerschaft gesetzlich verankert (den »Lebensumständen […] entsprechende Kenntnisse der deutschen Sprache«), ab 2006 mussten Deutschkenntnisse mit standardisierten Tests nachgewiesen werden, zunächst auf dem Niveau A2 des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen), B1 seit 2011. Und im Aufenthaltsrecht müssen seit 1. Jänner 2003 Zuwandernde aus Drittstaaten eine so genannte Integrationsvereinbarung eingehen, die den Nachweis von Deutschkenntnissen für einen längerfristigen Aufenthalt verlangt. 2003 waren das Kenntnisse auf dem Niveau A1 des GER, ab 1. Jänner 2006 auf A2. Die derzeit (2022) gültige Regelung geht zurück auf das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2011 und verlangt A1 vor Zuzug, A2 innerhalb von zwei Jahren und B1 für dauerhaften Aufenthalt, mit dem wesentliche Rechte und Sozialleistungen verknüpft sind, innerhalb von fünf Jahren. Seit 2017 schließlich müssen Werte- und Orientierungskurse in die Curricula der Deutschkurse integriert werden.
Im Bildungssystem existieren ausführliche gesetzliche Regelungen für Schüler*innen mit anderen Erstsprachen als Deutsch – auch hier steht die Förderung der deutschen Unterrichtssprache im Vordergrund, gleichzeitig gibt es so genannten Muttersprachlichen Unterricht und ein Unterrichtsprinzip »Interkulturelle Bildung« (BMB 2017), das dafür sorgen soll, dass alle Sprachen und Kulturen in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt werden.
2. Zur diskursiven Konstruktion von Identitäten
Das Konzept der Identität/en, das hier zugrunde gelegt wird, ist das in den eingangs angeführten großen Forschungsprojekten der Wiener Schule der Kritischen Diskursanalyse entwickelte. Öffentliche Diskurse (Politikerreden, Medientexte etc.) und halböffentliche Diskurse (Gruppendiskussionen, Interviews) aus den Gedenkund Jubiläumsjahren 1995 (50 Jahre Zweite Republik, 40 Jahre Staatsvertrag) und 2005 (60- bzw. 50-Jahr-Jubiläum) und 2015 (70- bzw. 60-Jahr-Jubiläum) wurden dabei daraufhin analysiert, wie österreichische Identitäten konstruiert werden (vgl. Wodak u. a. 1998; de Cillia/Wodak 2006; de Cillia/Wodak 2009, de Cillia u. a. 2020). Dabei gehen wir davon aus, dass es die eine österreichische nationale Identität nicht gibt, sondern dass vielmehr je nach Individuum, je nach Öffentlichkeit, nach Kontext unterschiedliche Identitäten konstruiert werden. Daher ist hier von Identität/en die Rede. Und wir gehen davon aus, dass Nationen mentale Konstrukte, »vorgestellte Gemeinschaften« sind, wie es Benedict Anderson (1994) nennt, die in den Köpfen der politischen Subjekte als souveräne und begrenzte politische Einheiten repräsentiert sind. Diskurs verstehen wir als sprachliche Form von sozialer Praxis, und wir nehmen ein dialektisches Verhältnis zwischen diskursiven Handlungen auf der einen Seite und den Institutionen und sozialen Strukturen, die diese sprachlichen Handlungen rahmen, auf der anderen Seite an. Einerseits prägt der politische, institutionelle und soziale Kontext den Diskurs, andererseits wirkt der Diskurs auf die soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit formend zurück, zum Beispiel auf die Gesetzgebung. Ein Beispiel dafür: Die gesetzliche Einführung des verpflichtenden Nachweises von Deutschkenntnissen für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft und für dauerhaften Aufenthalt von Zuwanderern ist die Folge einer jahrelangen Auseinandersetzung über Zuwanderung in Österreich und zunehmend ausländerfeindlicher Diskursstränge im politischen Diskurs seit Beginn der 1990er Jahre (vgl. de Cillia/Wodak 2006; Wodak 2020). Eine der inhaltlichen Dimensionen von vielen, die nationale Identitäten konstituieren, ist die Vorstellung, dass eine gemeinsame Sprache für nationale Identität eine wichtige Rolle spielt. Das soll im Folgenden auf unterschiedlichen Ebenen und anhand von Daten aus dem öffentlichen und dem halböffentlichen Diskurs illustriert werden.
3. Deutsch als Staatssprache und österreichische Identitäten
Die obige Darstellung der Entwicklung der letzten eineinhalb Jahrzehnte zeigt, dass die Rolle der deutschen Sprache in den letzten 25 Jahren von der offiziellen Politik institutionell und gesetzlich zunehmend gestärkt wurde. Neben den oben dargestellten Rahmenbedingungen zeigt sich die verstärkte Bedeutung des Deutschen vor allem im öffentlichen, medialen und politischen Diskurs i.e.S., nicht so sehr im halböffentlichen Diskurs. Die Analyse der letzten Jahrzehnte, zum Beispiel anhand von Wahlkämpfen, zeigt, dass die Frage der Deutschkenntnisse für Staatsbürgerschaft und Aufenthalt immer häufiger thematisiert wurde. Das soll an ein paar Beispielen illustriert werden: »Deutsch statt ›Nix versteh’n‹« war etwa ein mehrmals verwendeter Slogan der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), und in einem Plakat aus dem Jahr 2008 heißt es: »Wer österreichischer Staatsbürger sein will und wählen darf, muss unsere Sprache sprechen.« Die ÖVP (Österreichische Volkspartei) Wien verwendete im Gemeinderatswahlkampf 2010 den Slogan: »Es reicht! Wer bei uns lebt, muss unsere Sprache lernen. OHNE DEUTSCHKURS KEINE ZUWANDERUNG. Keine Rechte ohne Pflichten.« Und im Jänner 2012 verabschiedete die Wiener SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) ihre »Wiener Positionen zum Zusammenleben«, in denen es unter anderem heißt: »Die gemeinsame Sprache der Verständigung in Wien ist Deutsch. Es besteht die Verpflichtung, Deutsch zu lernen. [….].«
In den Jahren nach 2015 (vgl. de Cillia u. a. 2020) stehen vor allem die Themen »Deutschpflicht« an den Schulen (auch in der Pause), »Deutschförderung« an Kindergärten und Schulen und ähnliche, Sprachen betreffende Themen im Kontext der Zuwanderung im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses. Ein Fokus liegt auf der Diskussion der Form von Deutschförderung für außerordentliche (a. o.) Schüler*innen8 mit anderen Erstsprachen als Deutsch: Soll sie in getrennten Klassen stattfinden oder in integrativer Form mit zusätzlicher Deutschförderung, wobei die Schüler*innen zumeist im Klassenverband bleiben? Die Presse sowie die überwiegende Mehrheit von Expert*innen und Fachverbänden sprach sich gegen eine getrennte Beschulung von Kindern aus, trotzdem führte 2017 die damalige Regierung ein 2022 noch gültiges Trennungsmodell ein, demzufolge Schüler*innen mit »ungenügenden Deutschkenntnissen« in eigenen Deutschförderklassen beschult werden. Auch die Schulreife wurde 2017 an die Deutschkenntnisse geknüpft, die mit dem umstrittenen Testverfahren MIKA-D überprüft werden.
Parallel zu dieser Entwicklung gab es in der Öffentlichkeit ca. seit 2010 immer wieder Forderungen nach einem Deutschgebot an den Schulen auch in den Pausen bzw. nach einem Muttersprachenverbot (»Deutsch in der Pause« bzw. »Amtssprache Deutsch« in den Schulen). Als Beispiel sei ein Schreiben der Direktion der Vienna Business School Mödling vom 16. März 2015 an die Schüler*innen (Titel »Amtssprache Deutsch«) angeführt, das feststellt: »Auf Grund eines interkulturellen Konfliktes mit dem Reinigungspersonal wird darauf hingewiesen, dass im gesamten Schulhaus (auch in den Pausen) nur die Amtssprache Deutsch eingesetzt werden darf.« Einzige Ausnahmen seien die an der Schule unterrichteten Fremdsprachen im Unterricht (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch). Das gelte auch für Telefonate. Wenn Schüler*innen mit den Eltern nur in einer anderen Sprache kommunizieren könnten, dann müsse das in einem Bereich der Schule stattfinden, »wo sich keine anderen Personen aufhalten, die sich auf irgendeine Art beleidigt fühlen könnten« (zit. nach de Cillia 2020, S. 96; Herv. i. O.). Eine parlamentarische Anfragebeantwortung der Bildungsministerin vom 20. Mai 2015 hält fest, dass eine derartige Regelung gesetzeswidrig und daher unzulässig sei. Und obwohl namhafte österreichische Verfassungsjurist*innen diese Deutschpflicht für grundrechtswidrig halten, enthält das oberösterreichische Regierungsprogramm 2021–2027 wieder eine entsprechende Passage (Land Oberösterreich 2021, S. 28).
Im halböffentlichen Diskurs unserer Corpora spielt die Frage »Deutsch als Staatssprache« eine geringe Rolle. Dieser Aspekt wird explizit kaum erwähnt – meist nur im Zusammenhang mit dem österreichischen Deutsch. Die Forderung, österreichische Staatsbürger*innen und Zuwandernde müssten Deutsch können und Deutsch-Kenntnisse nachweisen, wird an keiner Stelle explizit erhoben – es ist offensichtlich in erster Linie ein Anliegen der politischen Parteien, die mit dieser rechtspopulistischen Agenda seit Beginn des 21. Jahrhunderts Politik machen. Allerdings wurde von Teilnehmer*innen in den Gruppendiskussionen manchmal schon in der Vorstellungsrunde, in der diese sagen sollten, was sie zum Österreicher/zur Österreicherin mache, spontan »Sprache« als Merkmal ihrer Identität genannt. In einer Gruppe von Schüler*innen etwa, in der sich einige mit Migrationshintergrund befanden, wurde besonders oft »die Sprache« als solche genannt: So meint eine Schülerin, deren Familie aus Afghanistan stammt: »Ich glaube, wenn man die Sprache kann, […] da kann man sich schon als Österreicher nennen, oder so.« Ähnlich eine andere Schülerin: »und auf jeden Fall die Sprache zu können, denk ich, das gehört auch auf jeden Fall dazu …« (de Cillia u. a. 2020, S. 100).
Die zentrale Bedeutung der Staatssprache Deutsch für österreichische Identitätskonstruktionen im Jahr 2022 zeigen die einschneidenden sprachgesetzlichen Maßnahmen der letzten zwei Jahrzehnte (Integrationsvereinbarung und Staatsbürgerschaftsgesetzgebung mit zunehmender Erhöhung der Anforderungen an nicht Deutschsprachige, getrennte Schulklassen für Kinder mit anderen Erstsprachen, Druck auf die Schulen, auch in der privaten Kommunikation in den Pausen andere Sprachen als Deutsch zu verbieten) – eine Entwicklung, die im Diskurs sehr gut nachvollziehbar ist.
4. Österreichisches Deutsch und österreichische Identitäten
Der symbolische Wert der österreichischen Varietät der plurizentrischen deutschen Sprache im Rahmen von nationalen Identitätskonstruktionen ist relativ hoch anzusetzen (vgl. de Cillia 2015, 2020; de Cillia/Ransmayr 2019). Hinweis darauf ist schon die Tatsache, dass bereits 1951 ein Österreichisches Wörterbuch als eigenes, in Österreich gültiges Nachschlagwerk zur Dokumentation der sprachlichen Unabhängigkeit von Deutschland erstellt wurde. Auch die Tatsache, dass die spezifisch österreichische Varietät des Deutschen bei Österreichs EU-Beitritt 1995 durch ein Zusatzprotokoll zum Beitrittsvertrag, das »Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union«, rechtlich verankert wurde, zeigt das (siehe oben). Dafür waren im Übrigen identitätspolitische Überlegungen ausschlaggebend. Aus sozialwissenschaftlichen Umfragen und Leserbriefen in Tageszeitungen wusste man, dass den Österreicher*innen die österreichischen Bezeichnungen für Lebensmittel besonders wichtig waren und dass man befürchtete, man würde nach dem Beitritt bundesdeutsche Ausdrücke wie Quark statt Topfen oder Aprikose statt Marille offiziell verwenden müssen (vgl. dazu de Cillia 1998). Im medialen Diskurs wurde dieser Verhandlungserfolg innerhalb Österreichs eher ironisch kommentiert – das österreichische Deutsch in der Liste beschränkt sich ja auf 23 kulinarische Ausdrücke –, wie folgende Schlagzeilen zeigen: »Topfen überlebt die EU« (Kurier, 13.4.1994), »Alles Powidl, dem 10er sei Dank« (Der Standard, 13.4.1994). Bei bundesdeutschen Medien führte das Protokoll allerdings zu ernsthaften Irritationen und herablassenden Kommentaren. »Österreichische Pferdeäpfel im Eurogulli« findet sich zum Beispiel als Titel in der Süddeutschen Zeitung vom 23/24. Juli 1994, »Europhäaken ohne Genußverzicht« in der FAZ vom 11. Juni 1994.9 Die Ergebnisse der Verhandlungen wurden in der Werbekampagne vor der Volksabstimmung zum EU-Beitritt, die am 12. Juni 1994 stattfand, propagandistisch verwertet. So hatte ein Plakat der österreichischen Bundeswirtschaftskammer den Titel »Alles bleibt, wie es ißt«, und der Bürgermeister der Stadt Wien initiierte eine Inseratenkampagne mit dem Titel »Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat«. Das Ergebnis der Volksabstimmung mit 66,6 Prozent pro EU zeigt, dass diese Kampagne durchaus erfolgreich war.
Die Daten aus dem halböffentlichen Diskurs (Gruppendiskussionen, Interviews) unserer Forschungen, die zwischen 1995 und 2020 erhoben wurden, zeigen deutlich, dass das österreichische Deutsch eine wichtige Rolle für Identitätskonstruktionen spielt. Fragt man danach, was es für die Menschen bedeutet, Österreicher*in zu sein, so wird häufig spontan »die Sprache« genannt, worunter eben meistens das österreichische Deutsch verstanden wird. So meinte eine Diskutantin im Burgenland in einer Gruppendiskussion im Jahr 2016: »Also ich fühle mich wirklich als Österreicherin durch die Sprache schon alleine, weil, die Sprache macht doch ein Land aus und […] Es is ja anders Österreichisch als Deutsch-Deutsch.« (de Cillia u. a. 2020, S. 100) Zahlreiche Beispiele aus den Projekten 1995–1998 und 2005–2008 könnten angeführt werden, wie etwa die Äußerung eines Schülers 2005: »Ja, österreichische Identität heißt für mich […], ich hab mein Deutsch, mein Österreichisch, also das sind einfach Grundmerkmale, die ich als Österreicher hab, und dass ich sagen kann, ich bin ein Österreicher.« Auch im Projekt »Österreichisches Deutsch macht Schule« gaben drei Viertel der Schüler*innen (75,6 %) und Lehrer*innen (78,7 %) an, österreichisches Deutsch sei wichtig für ihre Identität (de Cillia/Ransmayr 2019, S. 156).





























