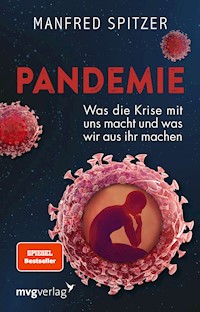
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Warum machen wir so viele Fehler im Umgang mit Pandemien? Wie reagiert unser Immunsystem, wenn wir keine körperlichen Kontakte mehr haben? Welche Auswirkungen hat es auf Kinder, wenn sie wochenlang alleine spielen? Warum kursieren so viele Fake-News? Die Corona-Pandemie schafft nicht nur medizinische und wirtschaftliche Probleme, sondern sorgt auch für Angst, Einsamkeit, sozialen Druck und Misstrauen. Manfred Spitzer, Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm und Bestsellerautor, erklärt verständlich und informativ, welche dramatischen Folgen eine Pandemie auf uns und unser Leben hat. Dabei klärt er über wenig bekannte Zusammenhänge, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und grassierende Irrtümer auf. Dieses Wissen brauchen wir, denn wie die Krise ausgeht, liegt an uns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Ähnliche
MANFRED SPITZER
PANDEMIE
MANFRED SPITZER
PANDEMIE
Was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
5. Auflage 2021
© 2020 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Petra Holzmann
Umschlaggestaltung: Catharina Aydemir
Umschlagabbildung: Shutterstock/Christos Georghiou, CoreDESIGN, Vector-3D
Satz: Carsten Klein, Torgau
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-7474-0257-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-608-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-609-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Vorwort
1. In der Krise – der neue Normalzustand?
To mask or not to mask?
Kurze Besinnung
Mein Leben mit Corona
Psychiatrie unter Corona
Worum es geht und was wir wissen
2. Crashkurs Corona, SARS-CoV-2 und COVID-19
SARS und MERS
SARS-CoV-2 und COVID-19
Tote zu zählen, ist gar nicht so einfach
Übersterblichkeit
Viren, Wetter und Verhalten
Was bisher geschah
Was bisher getan wurde, und welche Effekte es hatte
3. Risikobewertung, exponentielles Wachstum und komplexe Systeme
Risikobewertung
Exponentielles Wachstum
Die Komplexität unserer Gesellschaft
4. Angst und Misstrauen, Denunziation und Verleugnung
5. Infodemic: Verschwörungstheorien, Dummheiten und Fake-News
Infodemic
Verschwörungstheorien
Dummheiten und Fake-News
6. Körperlicher Abstand, soziale Isolation und Einsamkeit
Flattening the curve
Einsamkeit schmerzt
Einsamkeit ist ansteckend
Einsamkeit ist tödlich
7. Stress macht krank
8. Epidemien verursachen Stress
9. Corona und Kinder
Was macht das Coronavirus mit Kindern?
Kawasaki-Syndrom
Was macht die Corona-Pandemie mit Kindern?
Starke und schwache Schüler
Glückende Kindheit – jetzt!
10. Aus der Geschichte lernen: Mehr als 3000 Jahre Pocken, Pest und mehr
Nicht pharmakologische Interventionen und die zweite Welle
11. Die Gegenwart meistern: Kommunikation, Führung, Kunst, Politik und Wissenschaft
Es ist Pandemie – aber keiner geht hin?
Führungskräfte – was ist zu tun?
Kunst und Kultur sind Lebensmittel
Maßnahmen der Politik: Föderalismus versus Flickenteppich
Wissenschaft: Make the experts great again
12. Die Zukunft hängt von uns ab: Diese Krise meistern und die nächste vermeiden
Die Medizin in der Krise
Die Wirtschaft in der Krise
Die Vogel-Strauß-Allianz
Bildung in der Krise
Das Präventionsparadoxon
Corona- und die Klimakrise
Ökologie in der Krise
Die Zukunft: zwei Szenarien
Vertrauen
Dank
Über den Autor
Anmerkungen
Literatur
Widmung
Für meine Freunde und alle Mitarbeiter hier in der Ulmer Klinik für Psychiatrie, für meine Kollegen am Universitätsklinikum Ulm und für alle anderen Menschen auf der Welt, die in der Krise viel mehr arbeiten als sonst.
VORWORT
Haben Sie auch Ihre Nase zwar (hoffentlich!) nicht voller Viren, aber dennoch die Nase gestrichen voll von Corona? Dann geht es Ihnen wie mir! Eine Nachricht über die Pandemie jagt die nächste Sonder-Extra-Spezial-Sendung – und all diese Informationen jagen uns Angst ein. Mehr als vier Millionen Infizierte und mehr als 280.000 Tote weltweit (Stand: Muttertag 2020). In Großbritannien stirbt jeder Siebte, der sich mit Corona infiziert hat, in Schweden jeder Achte, weltweit jeder Vierzehnte, in den USA jeder Siebzehnte und bei uns jeder Dreiundzwanzigste. Dachte man noch vor einigen Wochen, das Virus SARS-CoV-2 verursache im Wesentlichen eine Lungenkrankheit, so zeigen sich, während die Pandemie voranschreitet, immer neue Ausdrucksformen der Krankheit: Leber, Nieren, Herz, Gehirn und Blutgerinnung können betroffen sein und auch bei jungen Patienten rasch zum Tod führen. So berichtete am 28. April 2020 ein Arzt aus New York im Fachblatt New England Journal of Medicine über fünf Patienten im Alter von 33 bis 49 Jahren mit schweren Schlaganfällen.1 »... Normalfall auf der Intensivstation. Das Röntgenbild zeigte einen großen linksseitigen Schlaganfall. Oxley schnappte nach Luft, als er das Alter und den COVID-19-Status des Patienten erfuhr: 44, positiv. [...] Das mittlere Alter bei solchen schweren Schlaganfällen liegt bei 74 Jahren. [...] Während er [den Schlaganfall] durch Herausziehen des Blut gerinnsels behandelte, konnte er zuschauen, wie gerade im gleichen Moment neue Schlaganfälle [bei dem Patienten] entstanden. ›Das ist verrückt‹, hatte er zu seinem Chef gesagt.« Dieses Zitat stammt nicht aus dem Fachblatt, in dem die Fakten kühl und objektiv dargestellt sind, sondern aus einem drei Tage zuvor in der Washington Post erschienenen Bericht über diese Vorfälle, der das Entsetzen des Arztes über seine Erfahrungen auf der Intensivstation viel besser zum Ausdruck bringt.2 Für die Ärzte ist das neue Corona-Virus ein »Moving Target«, ein Ziel, das sich permanent bewegt und seine Erscheinungsform ändert.
Fast mehr noch als die Infizierten, Kranken, Toten und überfüllten Intensivstationen ängstigen uns die Nachrichten darüber, was wir unternommen haben, um der Pandemie zu begegnen, und was dadurch mit uns passiert: Mehr als die Hälfte der Menschheit ist Beschränkungen von Freiheitsrechten unterworfen; über 40 Millionen Amerikaner haben mittlerweile ihre Arbeit verloren; die Lufthansa verliert eine Million Euro Liquiditätsreserve pro Stunde; die Verluste (Wertevernichtung) an den Börsen weltweit belaufen sich auf mehrere Hundert Milliarden US$, die Ausgaben der Staaten zur Unterstützung von Unternehmen und Menschen während der Krise auf mehrere Tausend Milliarden. Wer bezahlt das alles – und wie und wann?
Leere Straßen und Plätze, mittlerweile wieder geöffnete Geschäfte, in denen trotzdem keiner Lust hat, etwas einzukaufen; mehr Kindesmisshandlungen, häusliche Gewalt und Ehescheidungen – all das bemerken wir selbst oder erfahren es täglich über die Medien. Dies hat zu dem geführt, was die WHO schon vor Wochen als Infodemic bezeichnet hat: zu einer Flut von Meldungen, Meinungen, Halbwahrheiten und schlichtem Unfug, dem wir völlig schutzlos ausgeliefert zu sein scheinen.
Eines ist klar: Wir durchleben gerade eine globale Pandemie, »für die es bislang kein Drehbuch gibt« (so der deutsche Finanzminister Olaf Scholz mehrfach öffentlich). Was auch klar ist: Der überwiegende Teil der Menschen leidet nicht, weil er an dem Virus erkrankt ist, sondern er leidet aufgrund der Folgen der Eindämmungsmaßnahmen, die er selbst bzw. andere Menschen zurzeit erdulden. Wir leiden also mehrheitlich nicht unter dem Virus, sondern uns selbst. Denn wir leiden unter Ängsten und Ungewissheit, unter hohem sozialem Druck in engen Wohnungen; zugleich unter verordneter sozialer Distanz und Einsamkeit, unter Überflutung durch immer bedrohlichere Nachrichten, Fake-News und Verschwörungstheorien; unter geschlossenen oder nur teilgeöffneten Kitas, geschlossenen oder nur teilgeöffneten, dafür digitalen Schulen, die vor allem den schwachen Schülern schaden; viele Menschen leiden unter einer existenziellen Bedrohung durch Laden- und Werksschließungen, unter dem Verlust des Arbeitsplatzes, unter Kurzarbeit und weiteren vielfältigen wirtschaftlichen Folgen.
Bei der Corona-Krise geht es vor allem um Menschen und erst in zweiter Linie um das Virus. Genau deswegen ist neben dem Virologen und dem Epidemiologen auch der Psychologe und Psychiater herausgefordert.
Können Sie sich noch an den Tag erinnern, an dem Sie sich zum ersten Mal über das Corona-Virus und dessen Auswirkungen auf Ihr Leben ernsthaft Gedanken gemacht haben? Ich schon. Es war am Sonntag, dem 15. März. Per Mail hatte ich am Vorabend einen Übersichtsartikel erhalten, den ich am Sonntagmorgen zuerst langsam und gemütlich und dann immer schneller gelesen habe, denn es wurden mit klarer Sprache Inhalte angesprochen, die mir in dieser Deutlichkeit noch nicht bekannt und äußerst ungemütlich waren. Sofort wurde mir auch die Bedeutung der Sache für mich als Klinikchef deutlich, denn ein »weiter wie bisher« konnte es nach allem, was ich gelesen hatte, in der Klinik nicht geben.
Dann ging alles ganz schnell: Am Montag wurden die ersten Maßnahmen getroffen, und ab Dienstag war ich Teil der Umsetzungsgruppe des Universitätsklinikums Ulm, in deren regelmäßigen Treffen darüber beraten wurde, wie die Pläne und Vorkehrungen der Corona-Task-Force des Klinikums (auch dieses Gremium tagte täglich) zur Begegnung der Pandemie praktisch realisiert werden könnten. Ab Mittwoch (18. März) trugen alle Ärzte, Krankenpfleger und Patienten im Krankenhaus einen Mundschutz, und Gruppenaktivitäten fanden nicht mehr statt. Um als psychiatrisches Akutkrankenhaus weiter zu funktionieren, mussten wir die Psychiatrie neu erfinden. Dabei ging es keineswegs um neue große Konzepte, sondern um den ganz konkreten täglichen Lebensvollzug: Das war sehr viel Arbeit.
Zugleich betraf mich »die Krise« noch auf eine andere Weise: Weil ich vor einem guten Jahr ein Buch über Einsamkeit publiziert hatte, war ich für viele nun »der Experte« für die Folgen der Maßnahmen der sozialen Isolation. Zwar ist Einsamkeit nicht das Gleiche wie soziale Isolation, wie auch körperlicher Abstand nicht das Gleiche ist wie sozialer Abstand, aber genau das musste ja erst einmal jemand deutlich machen. Und der war ich – in unzähligen Interviews in den verschiedensten Medien.
Alles zusammen – der klinische Alltag, die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Umsetzungsgruppe und die vielfältige Kommunikation – hatte zur Folge, dass ich mich in den Wochen seit Mitte März mit kaum etwas anderem als Corona beschäftigt habe, ganz einfach, weil es sein musste. Und dabei habe ich sehr viel gelernt. Morgens vor und abends nach der Arbeit (bis mir die Augen zufielen) las ich über Corona – nicht nur im Netz die neuesten Nachrichten, Zahlen und Schaubilder, sondern vor allem in den wissenschaftlichen Fachblättern, weil das seit Jahrzehnten sowieso zu meinem Job gehört und ich das daher so gewohnt bin. Andere lesen Krimis; ich dagegen finde die Wissenschaft viel spannender. (Man muss das mögen, oder wie die Engländer sagen: It’s an acquired taste.)
Immer wieder brachte ich in diesem Zusammenhang gelegentlich meine Gedanken zu Papier, weil man sie dabei besser ordnen kann als beim bloßen Denken (bzw. weil man das beim Schreiben tun muss). Auch das mache ich (angestoßen durch das tägliche Schmökern in Fachblättern) seit Jahrzehnten – und gelegentlich wird dann ein Buch aus diesen geschriebenen Gedanken. Die Idee zu diesem Buch entstand im April. Die Ruhe dazu fand ich an den Wochenenden, die ich glücklicherweise nicht mehr in der Bahn oder auf der Autobahn verbringen musste, waren doch seit Mitte März alle Vorträge und Tagungen etc. bis auf Weiteres abgesagt worden. (März und April sind neben Oktober und November normalerweise Tagungshochsaison, aber die Frühjahrssaison fiel dieses Jahr komplett aus.)
Man kann sich ein Sachbuch wie ein riesiges Puzzle vorstellen. Viele interessante Einzelteile ergeben noch lange kein Gesamtbild. Die Teile müssen ineinandergreifen, sich ergänzen, einen »Sinn« ergeben, der viel mehr ist als die Summe der Teile. Sonst bräuchte man das Buch nicht, denn eine nahezu unendliche Menge von Einzelinformationen findet man ja schon längst in der »Cloud«. Das Gesamtbild ergibt sich aus genau den wichtigen für dieses Bild nötigen Verbindungen relevanter Einzelheiten – darum geht es beim Puzzle wie beim Sachbuch.
An einem Puzzle arbeitet man am besten in Ruhe und nicht auf dem Rücksitz eines fahrenden Autos oder in einem ruckelnden Zug. Und zudem mit der nötigen inneren Muße, die man braucht, um Zusammenhänge und Muster zu erkennen, zu bewerten, einzuordnen und zu einem Ganzen zu formen. Damit verglichen, war die Arbeit an diesem Buch für mich eine ganz neue Erfahrung, denn sie glich eher dem Zusammenzimmern eines Floßes in einem reißenden Strom, während man das entstehende Floß auch noch um Hindernisse steuern muss. Das war nötig, denn es war klar, dass das Buch niemandem nützt, wenn es in einem halben Jahr erscheint. Genau um diesen Nutzen geht es mir eigentlich in jedem meiner Bücher: Ich schreibe sie nicht zur »Erbauung« des Lesers, sondern weil ich aufklären, etwas bewirken will. Zwar enthält dieses Buch viel Allgemeingültiges und Prinzipielles (was auch in zehn Jahren noch richtig ist), aber seine Motivation, sein Bezug, seine praktischen Folgen und seine Daseinsberechtigung und sein gesamtes Momentum ist die Krise, in der wir uns gerade befinden.
Selten habe ich so fieberhaft an einem Buchprojekt gearbeitet. Das lag nicht daran, dass ich an Fieber erkrankt wäre, sondern daran, dass die Situation der jetzigen Krise für mich – wie für alle anderen ja auch – völlig neu war und noch immer ist. Im Gegensatz zu den meisten meiner Mitmenschen bin ich Arzt und Wissenschaftler, mit (hippokratischem) Eid, Kranken zu helfen, und (baden-württembergischem) Eid, dem Land zu dienen. Ich habe diese Aufgaben immer ernst genommen und mich zuweilen genau damit auch unbeliebt gemacht.
Vielleicht gibt es nach dem Erscheinen dieses Buchs wieder einen Shitstorm, zum Beispiel von Leuten, die Impfen für Teufelswerk, die Pandemie für harmlos und zugleich für eine Erfindung von bösen Mächten zur Auslöschung oder zumindest zur Versklavung der Menschheit halten. Da ich das alles schon erlebt habe, sehe ich alldem mit Gelassenheit entgegen. Schließlich werde ich demnächst 62 Jahre.
Ein Letztes: Ich glaube fest daran, dass diese Krise, unter der wir alle gerade sehr leiden, auch etwas Gutes haben kann und von uns als – wenn auch sehr steiniger – Weg in eine bessere Zukunft genutzt werden kann. Denn es spricht sich gerade herum, dass wir danach nicht genau da weitermachen dürfen, wo wir zuvor aufgehört haben. Wenn wir uns auf unser Miteinander neu besinnen und bei allem ablenkenden Gewusel (Konsum, Reisen, Events) den Sinn unseres Daseins – glückendes Miteinander (früher hätte man einfach gesagt: Liebe) – neu für uns erkennen, dann wäre das schon sehr viel. Wenn als Nebeneffekt aus der Krise mehr Nachhaltigkeit resultiert, wenn also der Globus verschnauft, weil wir Menschen eine Erkrankung des Atmens zu vermeiden suchen, ist das zumindest für Mutter Erde gut. Je mehr neue Erfahrungen wir dabei machen und zudem die Zeit haben, darüber nachzudenken, desto eher können wir auch hoffen, dass sich etwas zum Guten wendet. Um Aufklärung sowie Glaube, Liebe und Hoffnung für uns Menschen, verbunden mit mehr Nachhaltigkeit für unsere Erde (es gibt nur diese eine), darum geht es mir in diesem kleinen Buch.
Ulm, am Muttertag, 10.5.2020
Manfred Spitzer
1.
IN DER KRISE – DER NEUE NORMALZUSTAND?
Das Leben mit Corona sei die neue Normalität, lernte man in der Tagesschau vom 7. Mai 2020. Das augenfälligste Zeichen dieser neuen Normalität sind wohl die Masken, die wir jetzt alle tragen: Ob aus Kaffeefiltern gebastelt, aus Stoff genäht, als OP- oder vielleicht sogar als Sicherheitsmaske der Klasse FFP2 oder FFP3 gekauft: Masken sind das neue normale Bekleidungsstück. Aber helfen sie auch? Ein Blick ins Deutsche Ärzteblatt könnte weiterhelfen: Dort wurde am 6. April online publiziert, dass auch die einfachsten medizinischen (chirurgischen) Gesichtsmasken das Coronavirus zurückhalten können. Man bezog sich dabei auf eine im Fachblatt Nature Medicine drei Tage zuvor publizierte Studie3, in der dies experimentell gezeigt worden war.
Nur einen Tag später las man – erneut im Deutschen Ärzteblatt online – das genaue Gegenteil, denn eine Arbeitsgruppe aus Südkorea hatte am 6. April im Fachblatt Annals of Internal Medicine eine Studie publiziert, bei der vier Patienten mit Masken husten sollten, während vor ihnen eine Schale stand, die danach auf Viren untersucht wurde.4 Die Masken hatten in diesem Experiment nicht nur keinen abhaltenden Effekt, man fand an ihnen außen sogar mehr Viren als innen! Das Ergebnis war also nicht nur enttäuschend, sondern sogar erschreckend!
Die Experten halfen in dieser Situation wenig. Die WHO empfahl Gesichtsmasken zunächst nicht, das Robert Koch-Institut auch nicht. Erst mit der Zeit bröckelte die Abwehr, und immer mehr sprachen sich für Gesichtsmasken aus. Wie kam das?
To mask or not to mask?
Frei nach Shakespeare formuliert5, wird die Frage nach dem Gebrauch von Masken gegenwärtig heftig diskutiert. »Unnötiger Aufwand« und »gefährliches In-Sicherheit-Wiegen« sagen die einen, »sinnvoller Schutz« sagen die anderen. Glücklicherweise gibt es zu dieser Frage mittlerweile nicht nur Meinungen (und die oben genannten nicht besonders aussagekräftigen Studien), sondern durchaus auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die diesen Namen verdienen.
Wissenschaftler aus den USA haben am 21. April 2020 ein mathematisches Modell entworfen und damit Daten aus zwei US-Bundesstaaten (New York und Washington) zur Dynamik der Übertragung der Krankheit COVID-19 durchgerechnet. Dabei kam heraus, dass Gesichtsmasken deutlich mehr bringen, als man zunächst vermuten könnte. Ihr Nutzen für die Gesamtbevölkerung ist umso größer, je früher die Masken im Verlauf einer Epidemie oder Pandemie eingesetzt werden. Weiterhin wurde deutlich: Der Effekt von Gesichtsmasken lässt sich recht gut als Produkt aus Maskenwirksamkeit einerseits und dem Prozentsatz der Bevölkerung, der die Masken nutzt, andererseits abbilden. Zudem gilt: Auch wenn sie als alleinige Maßnahme unter bestimmten Umständen nur einen geringen Einfluss auf die Epidemie haben, verringern sie dennoch die effektive Übertragungsrate. Masken können also mit anderen Maßnahmen, einschließlich hygienischer Maßnahmen (Händewaschen) und sozialer Distanzierung (Abstandhalten, Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Cafés, Restaurants, Kindergärten und Schulen etc.), kombiniert werden, um letztlich zu einem Rückgang der Infektionsraten und damit der Belastung des Gesundheitssystems beizutragen. Gesichtsmasken sind gewiss kein Allheilmittel und sollen auch nicht anstelle anderer Maßnahmen eingesetzt werden. Zusammen mit anderen Maßnahmen sind sie jedoch wirksamer, als man denken könnte. Betrachten wir einige Ergebnisse der Studie etwas genauer.
Unter der Annahme einer festen Übertragungsrate vermindern Gesichtsmasken, die von 80% der Bevölkerung getragen werden und zu 50% effektiv sind (also 50% der Viren abfangen), im US-Bundesstaat New York 15–47% der Todesfälle innerhalb von zwei Monaten. Hierbei würden vor allem die Spitzen abgefangen, die um 34–58% reduziert werden. Damit sind Gesichtsmasken ein wirksames Mittel, Intensivstationen vor Überlastung zu bewahren (siehe Kapitel 6, Abschnitt »Flattening the curve«). Sogar Masken mit einer Effektivität von nur 20% sind noch nachweislich wirksam und können die Zahl der Todesfälle vermindern.6
Es überrascht nicht, dass dieser Nutzen von Gesichtsmasken größer ist, wenn ein größerer Anteil der Infizierten asymptomatisch ist, das heißt keine Infektionssymptome zeigt. Denn die Masken verhindern, dass jemand, ohne es zu wissen, einen anderen ansteckt. Aber Masken sind keineswegs nur in diesen Fällen hilfreich, wie die Wissenschaftler herausfanden. Sie bieten vielmehr auch dann einen Nutzen, wenn sie von (wirklich) gesunden Menschen zur Prävention einer Infektion getragen werden. »Zusammenfassend legen unsere Ergebnisse nahe, dass der Gebrauch von Gesichtsmasken durch einen möglichst großen Teil der Bevölkerung (das heißt landesweit) erfolgen und unverzüglich umgesetzt werden sollte, selbst wenn die meisten Masken hausgemacht und von relativ geringer Qualität sind. Die Maßnahme kann zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie beitragen, wobei der Nutzen in Verbindung mit anderen nicht pharmazeutischen Interventionen, die die Übertragung in der Gemeinschaft reduzieren, am größten ist«, betonen die Autoren am Ende ihrer Arbeit.7
Trotz der Ungewissheit über den Effekt von Masken ist deren Nutzen also zumindest der Möglichkeit nach groß und der Schaden durch sie vergleichsweise klein. Dies wird auch von anderen Autoren so gesehen.8 In Hongkong trugen etwa 96% der Bevölkerung Gesichtsmasken, und die Krankheit COVID-19 war mit 129 Fällen pro einer Million Einwohner sehr gering. In anderen Ländern ohne Gesichtsmaskenpflicht lag diese Zahl bei 2983 Fällen pro einer Million Einwohner (Spanien), bei 2251 Fällen (Italien) oder bei 1242 Fällen (Deutschland). Diese Unterschiede sind allesamt nicht nur statistisch, sondern auch klinisch sehr bedeutsam, wie Vincent Cheng und Mitarbeiter am 30. April 2020 publizierten.
Die Nebenwirkungen von Gesichtsmasken sind vor allem Kopfschmerzen, die jedoch in der Allgemeinbevölkerung kaum auftreten, sondern vor allem beim medizinischen Fachpersonal, wie im Rahmen einer Querschnittsstudie an Gesundheitspersonal, das während der COVID-19-Pandemie in Hochrisiko-Krankenhausbereichen tätig war, gezeigt werden konnte. Insgesamt 158 Beschäftigte nahmen an der Studie, die im Mai 2020 publiziert wurde, teil und füllten einen Fragebogen aus. Die Mehrheit (126, das heißt 77,8%) war zwischen 21 und 35 Jahre alt. Zu den Teilnehmern gehörten Krankenschwestern (102, das heißt 64,6%), Ärzte (51, das heißt 32,3%) und »paramedizinisches« Personal wie Rettungssanitäter oder Therapeuten (5, das heißt 3,2%). Bei etwa einem Drittel (46, das heißt 29,1%) der Befragten lag eine vorbestehende primäre Kopfschmerzdiagnose vor. Und diejenigen, die in der Notaufnahme arbeiteten, hatten eine höhere durchschnittliche tägliche Dauer des Maskengebrauchs im Vergleich zu denjenigen, die auf Isolierstationen oder auf der medizinischen Intensivstation arbeiteten. Von den 158 Befragten entwickelten 128 (81,0%) neue, das heißt zuvor nicht vorhandene Kopfschmerzen durch das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung wie N95-Gesichtsmaske und Schutzbrillen. Eine vorbestehende primäre Kopfschmerzdiagnose oder ein Gebrauch der Schutzmasken und -brillen über mehr als vier Stunden pro Tag waren unabhängig voneinander mit einem etwa vierfach erhöhten Risiko des Auftretens neuer Kopfschmerzen assoziiert. Seit Ausbruch von COVID-19 äußerten sich 42 der 46 (91,3%) Befragten mit bereits bestehenden Kopfschmerzen zur Frage, ob die verstärkte Benutzung von Schutzmasken und -brillen zu einer Verschlechterung ihrer Kopfschmerzen geführt hatte, entweder mit »stimme zu« oder mit »stimme sehr zu«. Diese Kopfschmerzen hatten auch Auswirkungen auf ihre Arbeitsleistung.9
Halten wir fest: Das Tragen von Gesichtsmasken ist hierzulande im Gegensatz zu manchen asiatischen Ländern kulturell noch nicht eingeübt. Dabei tragen sie sowohl zum Schutz der anderen als auch zum Eigenschutz bei. Sie wirken am besten, wenn sie von allen getragen werden.
Ein instruktives, lehrreiches Beispiel hierfür lieferte die Stadt Jena. Dort waren Mitte März die Infektionszahlen steil nach oben gegangen und lagen höher als in allen anderen thüringischen Städten und Landkreisen. In dieser Situation rauften sich die Stadt und die Universitätsklinik zusammen und sprachen für Jena als erste deutsche Großstadt eine allgemeine Verpflichtung zum Tragen einer Gesichtsmaske aus. Nach dem Motto »Keine Maske ist schlechter als irgendeine Maske« waren auch Schals und selbst gebastelte oder genähte Masken erlaubt. Und so kam es, dass seit Anfang April die Menschen in Jena im öffentlichen Nahverkehr, in allen Verkaufsstellen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Vierzehn Tage später wurden Schutzmasken auch in Büros vorgeschrieben, wenn mehr als eine Person im Raum ist. Und siehe da: Am 16. April vermeldete die Stadt, dass es in den vergangenen acht Tagen keine einzige Neuinfektion in Jena gegeben hatte.
Mittlerweile gilt eine Gesichtsmaske als geeignetes Mittel, um die Corona-Epidemie zu verlangsamen. Am 15. April wurde eine entsprechende dringende Empfehlung, Masken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr zu tragen, von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder verabschiedet, und bis Ende April wurde daraus in allen Bundesländern eine Tragepflicht.
Kurze Besinnung
Warum beginne ich ein Buch über die Corona-Pandemie mit einer Diskussion über Gesichtsmasken? Müsste man nicht erst einmal erklären, was Corona ist, was man über das Virus und die Krankheit weiß und wie sich alles entwickelt hat? »Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gesetzt.« An diesen viel zitierten medizinischen Leitsatz werden meine Kollegen vielleicht denken.
Klar, man könnte ein Buch auch am Anfang anfangen: erst einleiten, dann alles klarstellen und am Ende die Schlussfolgerungen ziehen. Das hat jedoch einen ganz entscheidenden praktischen Nachteil: Sehr viele Leute lesen Bücher nicht zu Ende, sondern geben irgendwann zwischen Anfang und Ende auf. Dieses Faktum ist ebenso bekannt wie von Autoren verdrängt und gehasst. Aber es bleibt eben ein Faktum. Und weil ich mit diesem Buch keine Erbauung erzeugen, sondern vor allem Gutes bewirken will, schreibe ich das Wichtigste gleich hier am Anfang: Leute, lasst euch nicht kirre machen von denjenigen, die etwas anderes behaupten: Tragt Masken, solange die Pandemie läuft!
Es gibt noch einen zweiten, systematischen Grund, warum ich gleich am Anfang über Masken spreche: Man kann daran schön zeigen, warum es in der Wissenschaft durchaus vorkommt, dass nicht alle einer Meinung sind. »Wenn sich schon die Experten streiten, was soll man dann noch glauben?«, hört man derzeit immer wieder. Oder vermeintlich noch schlimmer: »Der Experte X ändert seine Meinung. Wie soll man dem noch glauben?«
Die Menschen vergessen dabei, dass es keine ewig gleiche Realität gibt, sondern Realität sich verändert. Realität ist immer auch das, was wir jeweils wahrnehmen, und nie völlig davon zu lösen (was bliebe übrig?). Eine Pandemie ist kein Ding, sondern ein dynamischer Prozess, eine »Zeitgestalt«, die wir erst voll erkennen können (auch und gerade in wissenschaftlicher Hinsicht!), wenn sie vorbei ist. Dennoch brauchen wir die Wissenschaft schon jetzt, in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass unsere Erkenntnisse nicht abgeschlossen und vollständig, sondern vorläufig und unvollständig sind.
Aber dennoch: Haben Sie etwas Besseres als die Wissenschaft? Wollen Sie lieber jemanden fragen, der kein Experte ist? Als Mediziner ist man gewohnt, (noch) nicht »alles« zu wissen, und muss dennoch täglich Entscheidungen fällen, bei denen es durchaus um Leben und Tod gehen kann. Manchmal wird daher in der Medizin auch eine »zweite Meinung« eingeholt, meistens von den beteiligten Medizinern selbst, ohne groß Aufhebens darüber zu machen. Denn das ist in der Medizin normal. Ebenso normal ist, dass sich unsere Kenntnisse, also die Fakten, ändern. Und wenn sich die Fakten ändern, dann ändere ich meine Meinung. Was würden Sie tun?
Mein Leben mit Corona
Am 13. März hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Brief an die Krankenhäuser dazu aufgefordert, alle aus medizinischer Sicht nicht notwendigen, also »elektiven«, Eingriffe zu stoppen, um mehr Behandlungskapazitäten für COVID-19 Patienten zu schaffen. Das Besondere an diesem Brief ist, dass der Gesundheitsminister des Bundes den Krankenhäusern (die sind Ländersache) eigentlich gar nichts zu sagen hat. Dennoch sind sie der Aufforderung nachgekommen.
Die Corona-Pandemie hat seit Mitte März 2020 das Leben und die Arbeit in der Medizin verändert. Das betrifft nicht nur die Infektions- und Intensivstationen in der inneren Medizin, Anästhesie und Chirurgie, sondern auch mein Fachgebiet, die Psychiatrie. Das gesamte Universitätsklinikum Ulm (UKU) befand sich, wie andere entsprechende Krankenhäuser der Maximalversorgung auch, seit etwa Mitte März im Corona-Notfall-Modus: Verschiedene Teams planten die Versorgung von zu erwartenden künftigen Kranken. Ich selbst war und bin noch immer – wie schon erwähnt – seit dem 17. März in der Umsetzungsgruppe, die täglich direkt im Anschluss an die Krisen-Task-Force zusammenkommt und überlegt, wie man praktisch umsetzt, was zuvor von der Task-Force prinzipiell beschlossen wurde. »Station XY zieht von A nach B um, damit A Intensivstation werden kann.« Das sagt sich leicht, verursacht aber etwa so viel Zusatzaufwand wie ein kleines Erdbeben.
Die Arbeit in der Umsetzungsgruppe brachte mich in direkten Kontakt mit Kollegen und anderen Mitarbeitern des Klinikums, die mit den Vorbereitungen des UKU auf die Pandemie befasst waren. Die Treffen begannen immer mit den Fallzahlen: »Gestern neun, heute 13 positiv getestet«, hieß es am 17. März.
Am 18. März wurde der Höhepunkt der Pandemie für den 28. April vorhergesagt, zugleich mit schlechten Nachrichten: Es würden im schlimmsten Fall (Worst-Case-Szenario) mehrere hundert Betten fehlen – allein in Ulm.
19. März: In einer der uralten Kasernen in Ulm werden Medikamente und Schutzkleidung jetzt bewacht, weil die gerade knapp sind und in der gesamten Republik immer wieder gestohlen werden, vor allem nachts und in Kliniken. »Wir beschaffen, was wir kriegen können … 65 Fälle in unserem Einzugsgebiet.« Und: »Die Sterblichkeit der über 70-Jährigen liegt bei 12,5%.« Das klang nicht gut!
Am 23. März erfuhr ich, dass die Patienten der Hals-Nasen-Ohren-Klinik auf den Balkonen – Gott bewahre! – rauchen dürfen, weil es sonst nirgends geht. Am gleichen Tag durften sie das dann auch in der Psychiatrie. »Masken und Schutzkleidung sind jetzt genügend da. Auch die Mondanzüge.« Bei Kontakt mit Infizierten muss nun aus arbeitsrechtlichen Gründen ein bestimmtes Hygiene-Formular ausgefüllt werden. »Höhepunkt erst am 30. April.«
24. März: »Derzeit 14 Coronapatienten, sechs davon auf Intensiv.« Umzugschaos. Der Höhepunkt kommt erst am 5. Mai. »Haben die Bestatter genügend Kapazität?« Und dann ging es noch um die Frage, ob Laborkapazitäten von wissenschaftlichen Projekten, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert werden, für Coronatests verwendet werden dürfen. Für den einen ist das ethisch geboten, für den anderen Diebstahl. »Am besten dort nachfragen!«
25. März: COVID-19 diagnostiziert man schneller und zuverlässiger mit einem Computertomografen (CT) als mit einem Labortest. »Wo kriegen wir jetzt schnell einen her?« Mundschutzplicht für alle im Klinikum. »Das Umkleiden besser organisieren.« Zwei Personalgruppen bilden – A und B; wenn einer infiziert sein sollte, muss die Gruppe in Quarantäne, aber man hat dann noch immer wenigstens die Hälfte des Personals! »Höhepunkt erst für den 22. Mai berechnet. Mit 580 Patienten.«
26. März: Video über Corona auf Klinik-Webseite.
27. März: 250 Bodybags (neudeutsch für: Leichensäcke) bestellt.
Und so ging es weiter. Was jedes Mal gesagt wurde, habe ich weggelassen: »Guten Tag«, »Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund« und irgendwann dazwischen immer: »Wir brauchen mehr Tests.« Wir beschäftigten uns mit immer neuen alltäglichen, aber dennoch wichtigen Problemen. Wie gehen wir mit Besuchern der Patienten um (Besuch verbieten, testen, begrenzt zulassen? Wie Besuch handhaben in der Kinderklinik, in der Frauenklinik, in der Psychiatrie?)? Soll es Passierscheine geben? Was ist mit den Heimen in der Umgebung (»tickende Zeitbomben?«)? Wer koordiniert die Arbeit der Klinikseelsorger? Wie bringt man die Mitarbeiter dazu, in den Pausen die Masken auf- und den Abstand beizubehalten? Die Fallzahlen – auch die der Intensivpatienten mit Beatmung – stiegen derweil weiter.
Dann irgendwann in einer Sitzung der Knaller: Der Höhepunkt in Ulm war schon.
Das war Mitte April. Und das lag definitiv nicht daran, dass irgendjemand etwas falsch gemacht, also beispielsweise falsch beobachtet oder falsch gerechnet hätte. Die Berechnungen waren ja richtig, aber die Fakten, auf denen sie beruhten, hatten sich geändert. Corona erwies sich als ein ungemein bewegliches Ziel.
Psychiatrie unter Corona
Währenddessen erfanden wir in der Psychiatrischen Klinik ab dem 16. März täglich die Psychiatrie neu, um unter sich ständig verändernden Bedingungen das tun zu können, was wir immer tun: unsere Patienten so gut wie möglich zu versorgen. Gewisse Veränderungen im Klinikalltag mussten sein, denn die von Kanzlerin Merkel am Donnerstag, den 12. März, zu Recht geforderte und in ihrer Rede an die Nation am 18. März nochmals eindringlich angemahnte soziale Distanzierung (siehe hierzu Kapitel 6) passte nicht zu Gruppentherapien, die in den Bereichen Sport, Musik, Kunst, manuelles Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Zielen sowie im psychotherapeutischen Bereich zum Standard der Versorgung stationärer Patienten gehören. Denn seit mehr als 200 Jahren (der Zeit der Aufklärung) wissen wir, dass psychische Krankheit mit einem Verlust des Gemeinschaftssinns (sensus communis) einhergeht, das heißt, dass folglich sehr viele Probleme beim alltäglichen Miteinander auftreten. Nicht zuletzt deswegen bildet die »therapeutische Gemeinschaft« in der Klinik das Rückgrat unseres Tuns.
Da nun aber bestimmte Klinikangebote einfach nicht mehr möglich waren – der plötzliche Wegfall aller Gruppenaktivitäten und deren Ersatz durch Einzeltherapie führte dazu, dass den Patienten deutlich weniger Aktivitäten zur Therapie und zur Tagesstrukturierung angeboten werden konnten –, war es für manche Patienten besser, die Krankheit zu Hause bei häufigen Kontakten zum Behandlungsteam in der Klinik zu überstehen, anstatt im Krankenzimmer sehr viel Zeit allein verbringen zu müssen. Dort mussten seit Mitte März sogar die Mahlzeiten eingenommen werden (und nicht mehr im Gemeinschaftsraum). Einige Patienten aber brauchten den mehrfach täglichen intensiven Kontakt zum Behandlungsteam dringender als alles andere und blieben in der Klinik.
Psychiatrische Notfälle (schwere Depression mit akuter Suizidalität oder nach erfolgtem Suizidversuch, akute Belastungsreaktion mit Erregungszustand, Psychose unklarer Ursache ohne Krankheitseinsicht, Bewusstseinstrübung bei Intoxikation mit Alkohol oder illegalen Drogen etc.) kümmern sich weder um Tageszeit, Werk-, Sonn- oder Feiertage noch um eine weltweite Pandemie. Manche Patienten reagierten jedoch auf die Maßnahmen der sozialen Isolation mit Verunsicherung, Angst, Depression oder gar Suizidalität und brauchten zusätzliche Hilfe.
Worum es geht und was wir wissen
Unter Epidemiologen gibt es den Ausspruch: »Wenn Sie eine Epidemie gesehen haben, dann haben Sie eine Epidemie gesehen« – also keineswegs alle Epidemien, wie das bekannte Diktum zum Schließen von nur einem Fall auf alle Fälle nahelegt. Denn Epidemien können, je nach den Eigenschaften des Erregers und der (nicht nur menschlichen) Gesellschaft, auf die er trifft, ganz unterschiedlich ablaufen. Weil beide – Erreger und betroffene Population – sehr verschieden sein und unabhängig voneinander variieren können, multiplizieren sich diese Verschiedenheiten. Dennoch kann man aus der Geschichte manches lernen – wenn nicht über das Virus, dann wenigstens über uns selbst in Zeiten einer Pandemie. Zudem gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zur Entstehung von Krankheit – physisch wie psychisch – durch Stress, beim Einzelnen, aber auch bei Paaren und in Gemeinschaften. In systematischer Hinsicht folgt daraus, dass die Erkrankung von vielen – Epidemie oder Pandemie – Stress erzeugt und der wiederum krank macht. Hierdurch entstehen Teufelskreise und Widersprüche, inmitten derer politische Entscheidungen gefällt werden müssen. Diese wiederum können gar nicht unabhängig von kulturellen Gegebenheiten sein, was die Sache nochmals komplexer macht.





























