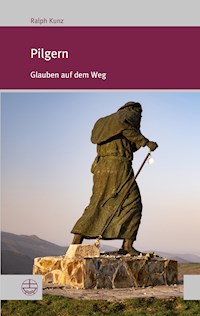
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Forum Theologische Literaturzeitung (ThLZ.F)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das sehr ansprechend geschriebene Buch des bekannten Zürcher Theologen Ralph Kunz beschreibt Pilgern als eine alte spirituelle Praktik, die in den letzten Jahren wieder neu entdeckt wurde. Das ist mehr als nur ein spiritueller Hype! Denn das Ziel des Pilgerwegs ist Gott. Was eine wachsende Schar von Menschen bewegt und begeistert, wird in seiner biblischen, geschichtlichen und kulturellen Bedeutung für die Gegenwart entfaltet und als Leitmetapher für die christliche Lebensform gedeutet. [Pilgrimage. Being Religiously on the Way] The very attractively written book by the well-known Zurich theologian Ralph Kunz depicts pilgrimage as an ancient spiritual practice that has been rediscovered in recent years. This is more than just a spiritual hype! Because the goal of the pilgrimage is God. What moves and inspires a growing number of people is unfolded in its biblical, historical and cultural significance for the present and interpreted as a guiding metaphor for the Christian way of life.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Forum Theologische Literaturzeitung
ThLZ.F 36 (2019)
Herausgegeben von Ingolf U. Dalferth
in Verbindung mit Albrecht Beutel, Beate Ego,
Friedhelm Hartenstein, Ralph Kunz, Christoph Markschies,
Karl-Wilhelm Niebuhr, Friederike Nüssel,
Nils Ole Oermann und Henning Wrogemann
Ralph Kunz
Pilgern
Glauben auf dem Weg
Ralph Kunz, Dr. theol., Jahrgang 1964, studierte in Basel, Los Angeles und Zürich. Er ist Professor für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Seelsorge, Predigt und Gottesdienst an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, Leiter des Center for the Academic Study of Christian Spirituality der Universität Zürich, Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (WGTh), der International Academy of Practical Theology und der Internationalen Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH • Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Kai-Michael Gustmann, Leipzig
Coverbild: © 77pixels/Fotolia.de
Satz: 3w+p, Rimpar
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2020
ISBN 978-3-374-06236-2
www.eva-leipzig.de
Für meine Pilgerbrüder: Beni, Eric, Konrad, Philippe und Xandi
VORWORT
Vorworte sind eine seltsame Textgattung. Man schreibt sie im Nachhinein. Das ist auch bei diesem Vorwort der Fall. Es ist ein Nachwort, das ich schreibe, nachdem ich das letzte Kapitel geschrieben habe. Wenn ich das Bücherschreiben mit einer Pilgerreise vergleiche, ist es der Augenblick, den Jakobsweg-Pilger bei der Ankunft in Compostela erleben. Eigentlich müsste ich jetzt eine Urkunde bekommen, die mir bezeugt, dass ich den ganzen Weg gelaufen bin. Der Vergleich ist gar nicht so unpassend. Für das Fingerpilgern mit dem Computer braucht es unbedingt ein Laufwerk. Mir kommt es auch so vor, dass ich in Gedanken gereist bin und nach etlichen Strapazen das Gefühl habe, jetzt sei es aber genug.
Das Vorwort ist eine wunderbare Einrichtung. Es schenkt dem Autor die Gelegenheit, noch einmal zurückzublicken auf den Argumentationsgang. Und da beginnt die Analogie mit dem Pilgern mir auch ein wenig unheimlich zu werden. Bei der Relecture der eigenen Texte wird man mit der Spur konfrontiert, die man selber gelegt hat. Schön wäre es, wenn man sagen könnte: Ich bin geradeaus zum Ziel gepilgert, noch schöner, wenn man die Gewissheit hat, auch wirklich dort angekommen zu sein, wo man hinwollte oder hingeführt wurde. Vor allem aber beschleicht mich beim Rückblick das Gefühl, dass ziemlich viel auf der Strecke geblieben ist, Wissensgepäck, das ich in meinem Rucksack mitführte und wieder auspacken musste. Darunter sind wunderbare Studien über Liturgie und Reisesegen, englische Literatur zur Theologie der Pilger und so weiter und so fort. Es war viel zu viel für einen Forum-Band! Ganz prosaisch ausgedrückt: Ich habe erst beim Schreiben begriffen, wie groß, tief und schön dieses Thema ist.
Eine Erkenntnis hat mich dann mit großer Wucht getroffen. Und ich bin nicht sicher, ob ich mein Staunen über diese überraschende Einsicht, die sich mir unterwegs einstellte, wenigstens halbwegs auf den Punkt bringen konnte. Dass Jesus der erste Pilger ist, der wahrhaftige Zeuge, der uns voran nach Jerusalem zog, eine Schar mit sich, denen er die Regeln der anbrechenden Königsherrschaft auslegte, die Hoffnung im Gepäck, dass bald die große Wallfahrt beginne. Gott sendet seinen Sohn als Pilger. Der Gedanke der Peregrinatio Dei – das Vorwort und das Vorzeichen vor jeder christlichen Pilgerschaft – hat mich gepackt! Dass Jesus der erste Pilger ist, der Pilger, der dort gar nicht gut angekommen ist, wo man ihn erwartet hat, der Pilger, der uns entgegenwandert, um ganz unerwartet bei uns anzukommen, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Womit ich schon fast beim Segen bin, den man sich beim Abschied vor oder bei der Ankunft nach der Pilgerfahrt (adventus peregrini) wünscht oder geben lässt. Und so soll mein Nachwort für Sie, liebe Leser, ein Vorwort werden, ein Segenswunsch, auf dass Sie sich nicht verirren auf meinem Gedankenweg und ein Souvenir mit nach Hause nehmen, mit dem Sie auf Ihrem Pilgerweg etwas anfangen können.
Winterthur, im Sommer 2019
Ralph Kunz
INHALT
Cover
Titel
Über den Autor
Impressum
Vorwort
1 Einleitung
1.1Zweifellos ein Boom
1.2Ein faszinierendes Phänomen
1.3Das praktisch-theologische Interesse
1.4Abgrenzungsprobleme
1.5Weggang als Chance für Tiefgang – zu diesem Buch
2Pilgern als kirchliche Praktik
2.1Pilgern als kirchliche Praktik
2.2Zu den Praktiken selbst
2.3Heiligung, Heilung und Heil in der communio viatorum
2.4Persönlicher Zugang zum Pilger(n)
2.5Pilgern als Gleichnis
3Bilder des Pilgerns und Typen der Pilger
3.1San Pellegrino – Typisches im Heilsbild
3.2Welche Typen haben welche Bilder?
3.3Pilgern als Methode – der aszetische Weg
3.4Dissonanz als Weltflucht und Resonanz als Weltkontakt
3.5Kontrast, Konkurrenz und kritische Korrelation – Funktion(en) der biblischen Leitbilder
3.6Biblische Erzählfiguren und Bildtypen der Wallfahrt
3.7Der Psalter als Reisebuch
3.8Von der Unruhe zur Ruhe
4Pilgern an [un]heilige Orte
4.1Imago Dei
4.2Spaziergänger, Vagabund, Tourist und Spieler
4.3Kritische Rückfragen an den spätmodernen Pilger
4.4Die Zielbestimmung des heiligen Ortes
4.5Der unheilige Ort als Ziel des Pilgers
4.6Das Gebet des ersten Pilgers
5Theologie des Pilger(n)s
5.1Pilgertheologische Perspektiven
5.2Detlef Lienau – Sich erlaufen
5.3Walter Nigg – des Pilgers Wiederkehr
5.4Roger Jensen – eine schöpfungstheologische Deutung
6Beweggründe für Kirche – pilger(n)theologische Impulse für die Ekklesiologie
6.1Perspektivenwechsel
6.2Unverschämt heiter unterwegs
6.3Peregrinatio Dei
6.4Wandeln im Geist
6.5Pilgern als Gang in Hoffnung hinein
6.6Warnung vor der Privatisierung
7Praktisch-theologischer Impuls – Beten mit den Füßen
7.1Kurzes Resümee
7.2Pilgern als Beten mit den Füßen
7.3Funktionen des Betens
7.4Leibliche Vergegenwärtigung – Beten im Pilgerschritt
7.5Christliches Beten als Vollzug des Liebesgebotes
7.6Beten als Ausdruck der Einsicht in die eigene Endlichkeit
7.7Beten als Ausdruck der Liebe – ein Reden des Herzens
7.8Neues Selbstverstehen, Gottverstehen und Weltverstehen
8Was ist das Ziel?
8.1Geistliche Begleitung
8.2Gleichgestaltet dem Bild Christi
8.3Zuhause angekommen?
8.4Die Frage nach dem guten Leben
8.5Wandern auf der vertikalen Resonanzachse
Weitere Bücher
Endnoten
1EINLEITUNG
1.1ZWEIFELLOS EIN BOOM …
Pilgern ist »in«. Die Wiederentdeckung des spirituellen Wanderns hat in den 1980er Jahren zunächst zögerlich begonnen und sich seit der Jahrtausendwende zu einem regelrechten Boom entwickelt.1 Die schieren Zahlen sind eindrücklich.2 Und die Pilgerszene wächst. Das weckt auch die Aufmerksamkeit der Wissenschaften. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass aus der Mode ein Trend geworden ist? Was macht den Trend zur Bewegung? Was die vielen Menschen, die sich auf den Weg machen, letztlich mobilisiert und motiviert, ist eine Frage, die Soziologie, Ethnologie und Kulturwissenschaften, aber auch Trend- und Marktforschung interessiert.3 Der Einfluss der Trendsetter ist hinsichtlich einer Prognose für die weitere Entwicklung des Booms nicht zu unterschätzen: Schließlich verspricht das Pilgern für Touristiker eine gewisse Wertschöpfung.4
Wenn Pilgern heute »in« ist und den Status eines Dauergasts in Feuilletons genießt, hat das millionenfach verkaufte Buch »Ich bin dann mal weg« von Hape Kerkeling seinen Teil dazu beigetragen.5 Es hat mitgeholfen, die Idee des Pilgerns im deutschsprachigen Raum populär zu machen. Dabei ist Kerkelings Schilderung der Begegnungen, Erlebnisse und Strapazen auf seinem Weg nach Santiago de Compostela nichts Spektakuläres. Vielleicht ist das Schlichte des Plots ein Teil der Faszination, die sich mit dem Pilgern verbindet? Man kann ganz einfach in die Tiefe gehen. »Pilgern ist eine nicht domestizierte Form der Spiritualität; gelegentlich könnte man sogar sagen, eine ›entfesselte‹, weil nicht gebundene Form gelebter Frömmigkeit. Vielleicht ist es sogar die einfachste Form, weil sie auf ganz basale Tätigkeiten abstellt: Gehen, schlafen, essen, trinken, schauen.«6 Einfacher geht es nicht! Aber die Krise gehört zur Nebenwirkung. Wer aufbricht, muss mit ihr rechnen. Denn wer sich auf den langen Pilgerweg macht, so wie es Hape Kerkeling in seinem Buch beschreibt, kommt unweigerlich zum Punkt, an dem sie oder er aufgeben möchte. Nicht immer machen die Füße mit, was sich die Pilger in den Kopf gesetzt haben oder sich von Herzen wünschen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.7 Der Körper verlangt nach einer Pause. Wer, wie er, den ganzen Weg von Frankreich nach Santiago läuft, ist wochenlang unterwegs, wird auf sich selbst zurückgeworfen und hält manchmal die Einsamkeit auf dem Weg kaum aus.
Für Tobias Braune-Krickau zeigt das Buch und seine Verfilmung etwas von der Attraktivität und der Herausforderungen des Pilgerns. Pilgern gibt ja auch etwas her, das man zeigen kann: äußere Landschaften, die zum Schauplatz einer inneren Reise werden, etwas Konkretes und etwas Diffuses. Das Ziel der Reise ist einerseits bestimmt und bleibt andererseits doch offen. In der Schlüsselszene schaut die Kamera auf den Pilger, wie er an einer Wand die gekritzelten Worte »Yo y tu«, Ich und Du, entdeckt. Man sieht Kerkeling auf dem Weg, schaut mit seinen Augen, erblickt einen Jungen auf der Straße: sein altes und sein neues Ich. Im nächsten Moment begegnet Kerkeling Gott, beginnt zu weinen, beginnt zu lächeln und die Kamera schwenkt in den Himmel.8 Ist das Kitsch? Es ist auf jeden Fall Geschmackssache und vielen gefällt es.
Wo und wie in diesem Ensemble das Religiöse auftaucht, ist nicht von vornherein ausgemacht. Braune-Krickau sagt über die Darstellung des Pilgerns im Film, was für die spätmoderne Pilgerschaft generell gelten kann: »Pilgern erscheint […] als eine Praxis der Selbsttransformation, deren Grad an religiöser Bestimmtheit sich erst auf dem Weg herausstellen wird.«9 Und Hape Kerkeling ist nicht allein. Auf seinem Weg hat er Freunde gefunden, die ihm das Durchhalten erleichtert haben, weil sie auch auf der Suche sind. Wie wichtig diese Weggemeinschaft ist, kommt aus der Beschreibung der letzten Kilometer kurz vor dem Ziel zum Ausdruck:
»Wir haben beschlossen, diese letzten Tage gemeinsam zu laufen, um aufeinander aufzupassen und um den Einzug in das Heiligtum miteinander zu erleben. Wir werden immer aufgekratzter und immer alberner. […] In Massen strömen die Menschen auf Santiago zu und viele singen so wie wir das berühmte französische Pilgerlied. […] Hier ist die Reise unwiderruflich zu Ende und im gleichen Moment beginnt etwas Neues! Etwas, das wir überhaupt nicht begreifen. In was sind wir da hineingeraten? Das muss der Pilgerhimmel sein! Eine Menschenmasse in großartiger Feierstimmung erwartet uns.«10
1.2 EIN FASZINIERENDES PHÄNOMEN
Natürlich wäre Pilgern auch ohne Kerkeling-Effekt populär. Dass es (im deutschsprachigen Raum) einen Promotor hat, der mit seiner eigenen Biographie der Pilgerschaft eine persönliche Note gibt und sich herzlich wenig um theologische Korrektheit kümmert, mag seinen Leserinnen und Lesern sympathisch sein und ist in gewisser Hinsicht symptomatisch für das Phänomen. Viele Menschen sind berührt und im wörtlichen Sinn bewegt zur Nachahmung – auch und gerade von einer unaufdringlichen spirituellen Botschaft. Kerkeling spricht in lebensnaher und elementarer Weise vom Gottvertrauen.11
Aber muss es Pilgern sein? Vergleichbares ließe sich vom Fasten oder anderen Praktiken mit einem spirituellen Touch berichten. Es ist sicher kein Zufall, haben doch strapaziöse Körperübungen oftmals Botschafterinnen und Botschafter, die begeistern können. Fast hat man den Eindruck, dass sich die Mission vom Feld der Lehre auf die Felder der Aszetik, Diätetik und Gymnastik verschoben hat. Roger Jensen, der norwegische Pilgertheologe, meint, dass es für unsere spätmoderne oder postmoderne Kultur typisch sei, weniger nach intellektuell überprüfbarem Wissen im Blick auf Sinn und Spiritualität als nach einer sinnhaften und spirituellen Praxis zu fragen. Viele Menschen suchen heute ihren Lebenssinn durch die Praxis – die Praxis selbst sei der eigentliche Sinn. »Oft ist die Praxis selbst das Ziel, und nicht eine Schlussfolgerung, die man intellektuell durch Abstraktion erarbeitet oder übernommen hat. Die Motive für unsere Praxis lassen sich nicht ohne weiteres erklären.«12
Das Interesse an einzelnen Praktikerinnen und Praktikern ist demnach noch kein hinreichender Grund für die Attraktivität einer Praktik. Damit eine Gemeinschaft entstehen kann, muss die Praxis selbst Sinn erzeugen und einen Sog entfalten.
Dem prominenten Pilger gelingt es zwar, andere vom Pilgern zu überzeugen, aber offensichtlich findet auch das Pilgern selbst und nicht nur der charismatische Pilger Nachahmung. Letztlich ist es dann doch die Gemeinschaft der Pilger, die wirbt. Sie laden einander ein, es ihnen nachzutun. Sie erleben etwas und machen Erfahrungen, die sie sonst nicht oder nicht in dieser Intensität gemacht hätten. Dafür zeugen die vielen Pilgerinnen und Pilger, die immer wieder aufbrechen. Davon zeugen ein immer dichter werdendes Netzwerk von Zentren und die wachsende Literatur.
Dass es unterschiedliche Motivationen gibt, zu Fuss aufzubrechen, liegt auf der Hand. Sagen wir es so: Es ist eine Herzenssache. Aber findet das Herz, was es sucht? Finden Pilger das Heilige auf dem Weg oder erst am Ziel? Oder finden sie, dass Pilgern an sich eine heilende oder heilsame Sache ist? Ist es das schlichte Fascinosum einer Praktik, für die man »nur« gute Schuhe, Wetterschutz und eine Landkarte benötigt?13 Könnte es sein, dass es um die Bewegung geht und das Ziel eigentlich irrelevant ist?
Über diese Frage lässt sich streiten. Detlef Lienau, ein Pilger-Experte, der in dieser Studie noch ausführlicher zu Wort kommt, äußert dazu eine dezidierte Meinung:
»Ich gehe davon aus, dass der Pilgerweg zum Symbol des Lebensweges werden soll. Er stellt ihn dar, gibt ihm anschaulich Ausdruck, macht ihn verständlich und prägt sich im Vollzug ein. […] Wie ist das konkrete Pilgerziel zu verstehen, damit es der Ausrichtung auf das eschatologische Pilgerziel Reich Gottes entspricht? Wenn der Sinn des Lebens- und Pilgerweges das Erreichen des Ziels ist, dann hat der Weg keinen Eigenwert, sondern zieht seinen Sinn und Wert daraus, dass er zum Erreichen des Zieles verhilft. Er ist also relativ, bezogen auf etwas anderes – und das darf nicht durch ein Verharren im bloßen Unterwegssein verloren gehen. Als Mittel zum Zweck bezieht der Weg gerade aus dem, worauf er zielt und wozu er verhilft, seine Dignität. Diese Würdigung des Unterwegsseins ist abgeleitet …«14
Hat der Weg wirklich keinen »Eigenwert«? Der Spieß lässt sich umdrehen. Hat nicht der heilige Ort seinen Nimbus verloren? Unbestritten ist die Tatsache, dass sich das Pilgerwesen nicht mehr mit demselben spirituellen Magnetismus erklären lässt, der in den ersten Jahrhunderten des aufkommenden Pilgerwesens oder im Hochmittelalter spielte. James J. Preston erklärt die Entstehung des Pilgerwesens aufgrund der Anziehungskraft der Ziele auf den Pilger.15 Er weist darauf hin, dass der Sog von einem heiligen Ort ausgeht. Allerdings sind schon in den alten Mustern des spirituellen Wanderns unterschiedliche Faktoren, Interessen und Erwartungen zu erkennen: die Hoffnung, eine Wunderheilung oder eine Erscheinung zu erleben, die heilige Geographie, die eine Erfahrung der Nähe zum heiligen Anfang verspricht, oder die Überwindung der Gefahren, die den Weg zum Ziel als Prüfung herausfordernd machen. Wenn die Beobachtung Jensens zutrifft, dass die Praxis einen Sog entwickelt, hat eine Verschiebung der Kräfte stattgefunden. Das, was fasziniert, und das, wovor man Respekt hat, ist weniger eindeutig verortet.
1.3 DAS PRAKTISCH-THEOLOGISCHE INTERESSE
Was macht das Pilgern so populär? Wer macht sich auf den Weg? Für wen ist es attraktiv? Was ist die Motivation der Pilger? Was die Pilgerforschung interessiert, ist auch für die Praktische Theologie interessant, weil es theologische Fragen stellt und nach theologischen Antworten verlangt. Pilgern hat eine biblische, geschichtliche und kulturelle Tiefendimension. Man kann es mit der Wegmetapher auf den Punkt bringen: Dass wir als Kirche wie als Einzelne auf ein Ziel hin unterwegs sind, gehört zum Kernbestand des Glaubens. Die Rede vom Pilgerstand oder von der Weggemeinschaft, die nach dem Himmelreich trachtet, ist biblisch affin – eine Redeweise, die Motive bündelt und Erzählungen in einen Bildbereich versammelt. Die Praktische Theologie fragt danach, was Narrative wie die Völkerwallfahrt, die Nachfolge oder das himmlische Jerusalem, für die Deutung des Lebens austragen. Sie will wissen, woran sich Menschen orientieren, wenn sie pilgern. Das Eine geht nicht ohne das Andere. Sie wird sich auch dafür interessieren, warum die Glaubenserfahrung unterwegs möglicherweise als attraktiver empfunden wird als eine Glaubenserfahrung, die man im kirchlichen Zuhause machen kann. Sie wird sich darüber Gedanken machen, wo eine Begleitung und Betreuung der Pilgernden gefragt ist und wo sie keinen Sinn macht. Sie fragt danach, wie eine moderne Pilgermission aussieht und welche Ausbildung die freiwilligen Begleiter auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie sieht, welches Potential die kleinen und großen Formen des Pilgerns also das, was eine wachsende Schar von Menschen bewegt und begeistert für die Belebung der Kirche haben könnte.
Skeptiker wenden ein, dass das Pilgern nur eine Mode sei. Was einmal angefangen hat, könne ebenso gut wieder aufhören. Daran stimmt, dass religiöse Praktiken boomen und wieder vergehen, denn dies ist historisch immer wieder zu beobachten. Tatsächlich ist das Wallen in Wellen gekommen und wieder gegangen. Die Faktoren für das Auf und Ab sind so vielfältig wie das Phänomen und manchmal ganz simpel: Man muss sich das Reisen leisten können! Nicht jede und jeder kann seine Arbeit für eine längere Zeit unterbrechen. Der Vergleich mit anderen Bewegungen, die kommen und gehen, lässt weiter fragen, ob die Deutungsarbeit der Theologie überhaupt erwünscht ist.16 Roger Jensen, der ein Primat der Praxis beobachtet, fragt, ob es (aus kirchlicher Sicht) nicht klüger sei, die »Bewegung von unten […] unabhängig von theologischer Interpretation und Reflexion«17 wachsen zu lassen. Er kommt dann allerdings zum Schluss, Interpretation und Reflexion sei sowohl notwendig als auch unvermeidlich, um das Erleben und die Erfahrungen des Pilgerns in religiöser Sprache zu artikulieren und im Lichte des kirchlichen Erbes diskutieren zu können. Ich teile seine Ansicht. Es gehört zur Kernaufgabe der Theologie, das kirchliche und theologische Erbe als Deutungs- und Reflexionshilfe für das heutige Pilgern fruchtbar zu machen. Mich interessiert allerdings auch die Umkehrung. Ich denke, die Pilgererfahrung hält auch für die Gemeinden fruchtbare Impulse bereit.
1.4ABGRENZUNGSPROBLEME
Es gibt viele gute Gründe, das gegenwärtige und das traditionelle Pilgerwesen zu vergleichen und über Divergenzen und Konvergenzen nachzudenken. Unübersehbar sind die Spannungen: Das Entfesselte steht gegen das Gebundene, das Spirituelle gegen das Religiöse oder das Individuelle gegen das Gemeinschaftliche. Dabei lassen sich von beiden Seiten her Anstöße erkennen, denen ein gewisses Störpotential zukommt. Zum Beispiel irritiert von der Seite der Tradition her die tief in der christlichen Existenz verankerte Wahrheit des Pilgerstands, in der sich das Bekenntnis zu Gott als letzter Heimat ausdrückt. Die peregrinatio ist aber auch ein Motiv des Sterbens, das aufs Engste mit dem Kreuzsymbol verknüpft ist.18 Walter Nigg sagt es so:
»Wer Christentum sagt, der sagt auch homo viator, wie der Lateiner im Mittelalter den nach der Ewigkeit wandernden Christen nannte. Die Pilgerschaft ist unablöslich mit der christlichen Botschaft verbunden.«19
Die Frage, wie die Praktik des Pilgerns gedeutet werden muss, ist mit dem Hinweis auf den Pilgerstand freilich noch nicht hinreichend beantwortet. Ungeachtet der biblischen Wertschätzung und Begründung zog das Wallen und Pilgern aus protestantischer Sicht den Verdacht einer werkgerechten Frömmigkeit auf sich. Es ist ein öffentlicher, sichtbarer und darum sogar filmreifer religiöser Akt, der außerdem mit Strapazen verbunden ist. Insofern fragt sich manch ein wackerer Protestant, ob das freiwillige Wundlaufen der Füße eine (schlecht) versteckte Neuauflage des alten Bußpilgerns sei. Und lebt hinter der eigenartigen Idee, dass es besonders heilige Orte oder spirituelle Kraftorte gibt, nicht jener alte Aberglauben weiter (oder wieder auf), den der aufgeklärte Christ überwinden wollte oder überwinden sollte? Das neu erwachte Fascinosum weckt das alte Tremendum und lässt auch Befürchtungen aufkommen: dass das, was derart viele Menschen in den Bann zieht, ein Hype sein muss und es letztlich ein Wandel im Zeitgeist ist, der das Pilgern so gängig macht.
Die Gefahr, dass sich die symbolische Bedeutung der Pilger- und Wallfahrt mit einer naiv-esoterischen Wanderseligkeit vermischt und so für den spirituellen Tourismus vermarktbar wird, ist nicht ganz von der Hand zu weisen.20 Das neue Pilgern ist zweifellos auch ein Exempel für religiöse Individualisierung, Synkretisierung und Pluralisierung. Wer nach Beweisen sucht, wird fündig. Es gibt genug Indizien, die dafür sprechen, dass das, was einmal bestimmte religiöse Bedeutungen hatte, ein sehr diffuses spirituelles Phänomen geworden ist. Der spätmoderne Pilger ist ein Musterbeispiel für den Typus des religiösen Sinnsuchers. Die damit verbundenen Abgrenzungsproblematiken führen zu mehr oder weniger unergiebigen Definitionskämpfen. Anders gesagt: Pilgern ist widerspenstiger, als es den Anschein macht.
Die Verbindung zur alten Praktik ist gegeben, aber brüchig geworden.21 Das ist ein Allgemeinplatz der Sozial- und Kulturwissenschaften, die sich mit zeitgenössischer Religiosität beschäftigen und als allgemeine Beobachtung mäßig interessant!22 Für Detlef Lienau ist die Disparatheit der Bezüge auch ein Beleg für die spannungsreichen Pole, die sich gerade beim Pilgern entdecken lassen. Wer pilgert, erlebt Identität wie Fremdheit, erfährt seine eigene (körperliche) Begrenztheit und Grenzenlosigkeit, wird sich fremd und lernt sich kennen, wird bestärkt, aber auch irritiert, hat ein Ziel und verliert es.23 Lienau sieht in dieser Polarität die beiden Grundpole der Existenz: »Wir stehen in einer wissenden Selbstbeziehung und zugleich in eigentümlicher Distanz zu uns selbst. Zwar können wir ›Ich‹ sagen, aber nicht ohne weiteres, wer dieses ›Ich‹ ist.«24 Pilgern bietet die Intensivierung einer Grunderfahrung. Es ist also exemplarisch und verdient darum mehr Aufmerksamkeit als andere religiös affine körperliche Praktiken. Roger Jensen sieht es ähnlich, betont jedoch stärker als Lienau die Gottesbeziehung: »Pilger zu sein heisst Gott zu suchen. Als Pilger entlang der alten christlichen Pilgerwege zu wandern, auf denen Geschichte und Kultur vom christlichen Glauben zeugen, ist eine Einübung ins Christentum. Die Pilgerschaft als Praxis kann Lebensmut spenden – und den Mut zu sterben.«25
Zwischen Detlef Lienau und Roger Jensen sind unterschiedliche Akzentuierungen erkennbar, die ich im Kapitel »Pilgertheologie« (5.) vertiefen möchte. Mir ist es wichtig, einleitend festzustellen, dass die Akzente, die sie setzen, Differenzen ins Spiel bringen, die nicht überspielt und nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen. Die Komplexität des Phänomens lässt es vielmehr anraten, einen multiperspektivischen Zugang zu wählen. Roger Jensen bringt es gut auf den Nenner, wenn er meint, dass der spätmoderne Pilger seine Wanderschuhe nicht deshalb anziehe, weil er sich als ein Fremder in der Welt fühle und seine Heimat an einem anderen Ort suche, sondern weil er bereits in der Welt zuhause sei und ständig eine Bestätigung dafür suche, dass die Erde seine Heimat sei.26 Möglicherweise scheitert der eine oder andere spätmoderne Pilger bei diesem Versuch. Nicht erst dann – aber dann ganz bestimmt – stellt sich die Frage, was die communio viatorum, die unterwegs zu Gott ist, dem Weggenossen zu sagen hat.
1.5WEGGANG ALS CHANCE FÜR TIEFGANG – ZU DIESEM BUCH
Sowohl die Geschichte der christlichen Pilgerreisen nach Santiago de Compostela als auch die populäre »Spiritualität« und »Sinnsuche«, die sich in der posttraditionalen Pilgerfahrt manifestieren, werden in einschlägigen Publikationen ausführlicher behandelt und umfassender aufgearbeitet als in dieser Studie. Wo es Sinn macht, soll auf diese Forschungsarbeiten hingewiesen werden. Ich habe schon durchblicken lassen, dass meine Hauptintention und -motivation, dieses Büchlein zu schreiben, in eine andere Richtung gehen! Als Doppelfrage formuliert: Was geschieht, wenn der homo viator nach Hause kommt? Und was bewegt sich in einer Ortsgemeinde, die entdeckt, dass sie dem Wesen nach eine communio viatorum ist?
Mich interessieren die Entwicklungschancen, die sich aus einer Begegnung des homo viator mit der communio viatorum ergeben. Mit Blick auf das, was in letzter Zeit an Pilgerliteratur erschienen ist, und in Erwartung dessen, was in nächster Zeit erscheinen wird, setze ich Akzente, von denen ich hoffe, dass sie die Diskussion bereichern und ein paar neue Impulse für die Praxis geben.
– Im folgenden Kapitel soll der Ansatz und das methodische Vorgehen begründet werden. Ausgehend vom Begriff der Praktik, wird der Stand der empirischen Pilgerforschung knapp skizziert, eine Klärung der grundlegenden Begriffe Pilgergang, Pilgerstand und Pilgerideal vorgenommen und der Versuch einer Typologie unternommen.
– Mein Versuch der Vertiefung führt zu den biblischen Wurzeln der Wallfahrt (3). Einer Anregung Martin Luthers Folge leistend, pilgern wir zu Fuß durch die Schriften und fragen nach dem Leitmotiv der Wanderschaft, folgen den Sinnbildern der Wanderung und erproben die neuen Wege, die sich auf einer solchen Reise eröffnen.
– Kann man auch zum unheiligen Ort pilgern? Die zunächst abwegige Frage entpuppt sich als eine christliche Brechung der Pilgerreligion, die dem Kreuzweg folgt. Drei theologische Ansätze sollen den Gedanken vertiefen, dass Christus der erste Pilger ist. Dabei werden Spannungen in den Deutungsansätzen dekonstruiert und die verschiedenen Aspekte der Pilgertheologie als kritisches Korrelat entfaltet.
– Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, was eine Pilgertheologie leistet und wie sie die Pilgerreligion kritisch begleiten kann. Es werden die unterschiedlich akzentuierten Ansätze von Walter Nigg, Detlef Lienau und Roger Jensen referiert und reflektiert. Dabei geht es weniger darum, Einseitigkeiten zu kritisieren, sondern das Erhellende, das jeder dieser Zugänge hat, für pilgertheologische Vertiefung der Praktik zu nutzen. Gleichwohl fallen – in diesem Licht besehen – auch die Lücken auf, die zu Nachfragen einladen. Auffällig ist, wie wenig man über die Einbettung der Pilgerfrömmigkeit in das größere Ganze der Spiritualität und der Nachfolge lesen kann, wie dünn die Auslegung der Verbindungen zwischen dem Zeugnis der Schrift und der Kultur der Wallfahrt ausfällt, und wie stark sich das residentielle Christentum gegen das Transitorische der christlichen Existenz stemmt.
– Im sechsten Kapitel frage ich ausgehend von Karl Barths Versöhnungslehre nach der theologischen Tiefendimension des Pilgerns für die Gemeinde, die sich aus der Ausrichtung auf die Praktik des Gehens erschließt. Der Leitbegriff der geistlichen Einübung steht für die Praxis der Lebensführung, die sich auf die Lebensform des Evangeliums beruft.27
– Pilgern als geistliche Gangart belehrt die Kirche, die auf ihre Sesshaftigkeit pocht, eines Besseren. Aber die Gemeinde hält den Wandervögeln auch eine Lektion bereit. Sie ist eine betende Gemeinschaft. Wenn man Pilgern als Beten mit den Füssen versteht, entdeckt man den Tiefgang dieser kirchlichen Praktik.
– Das letzte Kapitel fragt danach, welche Aufgabe der geistlichen Begleitung der Pilger zukommt. Das Ziel der Nachfolge – so könnte man das Nachwort vorwegnehmen – ist es, das Ende der Reise als Anfang von etwas Neuem zu sehen.
2 PILGERN ALS KIRCHLICHE PRAKTIK
2.1 PILGERN ALS KIRCHLICHE PRAKTIK
Meiner kleinen Studie liegen keine empirischen Untersuchungen zugrunde. Ich kann nicht den Anspruch erheben, mehr als Beobachtungen zu versammeln, die aus bescheidenen eigenen Erfahrungen mit der Praktik des Pilgerns stammen. Mir liegt an einer theologischen Reflexion der Pilgerpraxis und mich faszinieren die zahlreichen Beziehungen und Bezüge, die sich daraus für die Gemeinde ergeben, die sich in frischer und neuer Weise als communio viatorum erfahren darf. Dieser Fokus legt eine klassische Arbeitsweise mit Texten nahe und liefert hoffentlich Anregungen für Forschungsprojekte, die methodisch andere Wege gehen.
Es macht durchaus Sinn, dass der Praktische Theologe, der in erster Linie einen Zugang via Textarbeit wählt, überlegt, wie er den Gegenstand seiner Forschung auf dem Feld der Praktischen Theologie einordnet. Darum möchte ich eine methodologische Reflexion vorausschicken, die beim Begriff der Praktik ansetzt. Es ist ein Begriff, der sich für empirisch ausgerichtete Untersuchungen als relevant erwiesen hat, Untersuchungen notabene, deren Gegenstand sich nicht ohne Weiteres in eine der klassischen Teildisziplinen der Praktischen Theologie einordnen lassen. Womit haben wir es beim Pilgern zu tun? Wie sinnvoll ist es, von einem kirchlichen Handlungsfeld zu sprechen? Welche Form der Gemeinschaft ist im Blick und wie lässt sich das kirchliche Engagement angemessen auf den Nenner bringen? Ist es die Pilgermission, die Pilgerkirche oder die Pilgerarbeit?
Es fällt auf, dass die Pilgerpraxis konzeptionell nur schwer zu fassen ist, weil sie sozusagen aus der Pastoral ausgewandert ist. Das Pilgern ist eine religiöse Praxis und eine Form des leibbezogenen Betens, die das Weite sucht. Einerseits entziehen sich die Pilger dem kirchlichen Zugriff, andererseits bezieht sich die Praktische Theologie vornehmlich auf die Arbeit in der Gemeinde. Es geht nicht in erster Linie um Menschen, die im Milieu der Kirche verkehren. Wir reden von einer heterogenen Gruppe, haben aber Einzelne im Blick, die sich oft auch alleine auf den Weg machen.28
Wenn ich Pilgern dennoch als kirchliche Praktik bestimme, geht es mir nicht darum, die Pilger zu »verkirchlichen«, sondern in gewisser Weise die Kirche zu »verpilgern«. Es gibt gute Gründe, eine allzu sesshafte und auf ihre Beständigkeit versessene Kirchlichkeit kritisch zu befragen. Die Praktik zum Forschungsgegenstand zu erheben, verschiebt darum den Fokus von der bestehenden zur entstehenden Kirche und berührt ein Kernanliegen der Praktischen Theologie.29 Eine Definition des schottischen Theologen John Swinton umschreibt das erkenntnisleitende Interesse der Praktischen Theologie an Praktiken sehr präzise: »Practical Theology is critical, theological reflection on the practices of the Church as they interact with the practices of the world, with a view to ensuring and enabling faithful participation in God’s redemptive practices in, to and for the world.«30
Pilgern als eine kirchliche Praktik praktisch-theologisch zu reflektieren, beschränkt sich also nicht darauf, die Praxis der Pilgernden mit allen Mitteln der Empirie zu erkunden. Die theologische Reflexion ist insofern eine kritische Reflexion, als sie die kirchliche Praxis nicht zur Norm erhebt, an der man eine verweltlichte Praxis misst und entsprechend beurteilt – einmal abgesehen davon, dass es eine »reine« kirchliche Praktik nie gegeben hat und nie »rein« geben wird. Swintons Definition macht vielmehr klar, dass kirchliche Praktiken immer mit weltlichen Praktiken interagieren, aber die theologische Reflexion darauf abzielt, die Praktiker an Gottes Werk teilhaben zu lassen. Mit Blick auf die Praktik gesagt, zielt die Praktische Theologie darauf, Pilgern so zu gestalten, dass die Pilger an Gottes befreiendem Handeln in der Welt und für die Welt partizipieren – anders gesagt: dass die peregrinatio der Kirche ein Teil der peregrinatio dei wird und sich dafür am ersten Pilger Jesus Christus orientiert (4.6; 6.3).
Nun könnte eine solche Sicht als ausschließend, steil und einengend empfunden werden. Kritiker könnten wie Effi Briests Vater mit dem Hinweis auf das »weite Feld«31 argumentieren. Die Rede vom christlichen Weg hat doch etwas Exklusives! Tatsächlich ist die Motivlage, die Menschen dazu veranlasst, sich auf ihren Weg zu machen, beinahe so breit und vielfältig wie die religiöse Orientierung der Bevölkerung. Spirituell Wandernde in corpere zu »anonymen Christen« (Karl Rahner) zu erklären oder umgekehrt ihnen vorzuwerfen, sie seien keine echten Pilger,32 solange sie »nur« über Beziehungsproblemen brüten, ist so oder so nicht angebracht. Die Problematik der Missionierung, der Eingemeindung und Manipulation, die sich in solchen Zuschreibungen zeigt, ist nicht neu und lässt sich auch für andere Praxisfelder, z. B. für die Kasualien, die Urlaubsseelsorge oder auch für diakonische Engagements, diskutieren. Um es kurz zu machen: Wo immer und wann immer Menschen unterwegs sind und allenfalls mit beauftragten kirchlichen Mitarbeitern in Berührung kommen, geht es seitens der Kirche um die Kommunikation des Evangeliums. Wenn ich Pilgern darum als eine kirchliche Praktik begreife, liegt mir an der Gelegenheit für Kirche, die sich daraus ergibt.33 Die Praktiker sind nicht Objekte einer pastoralen Versorgung und die Kommunikation dient nicht der Rückführung entlaufener Mitglieder. Beim Pilgern entstehen Weggemeinschaften, die die Kirche herausfordern, weil in ihnen Evangelium kommuniziert wird.34
Wenn ich immer wieder darauf bestehe, dass es Christus ist, der mit seiner Gemeinde mitpilgert, geht es mir um einen theologisch bestimmten Weg auf dem weiten Feld. Das wiederum setzt eine evangelische Theologie voraus, die sich als Interpretationspraxis versteht und um »die vielschichtige und vieldimensionale Auslegung und Reflexion der Kommunikation des Evangeliums und ihrer Auswirkungen im Leben, Denken und Handeln von Menschen unterschiedlicher Zeiten und Kulturen«35 weiß. Ob die kirchliche Pilgerarbeit auf dem Weg oder die Gemeinde am Weg den Bezugspunkt und den Ausgangspunkt der theologischen Reflexion bilden und ob sie sich stärker im Feld der Seelsorge, der Bildung oder der Geistlichen Begleitung verortet, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der Kontext bestimmt darüber, welche konkrete Gestalt die Interpretationspraxis hat, und stellt den Bezug her auf das christliche Leben, »in dessen Zentrum die Kommunikationspraxis der Kirche steht, ohne die es kein christliches Leben gäbe.«36
Wenn das Evangelium Auslegung des Lebens durch Gottes Gegenwart auf Gottes Gegenwart hin ist, beschreibt die theologische Reflexion der kirchlichen Praktik einen hermeneutischen Zirkel, der die Kommunikationspraxis der Kirche kritisch daraufhin befragt, ob und wie in ihr das christliche Leben gefördert und die Sozialformen, die der Lebensförderung dienen, gestärkt werden können. Es geht in dieser Studie also um ein (überkonfessionell verstandenes) »evangelisches Pilgern« – ein Gehen auf dem Glaubensweg, das zum Ziel führt, Gottes Vorausgehen, sein Mitgehen und Entgegenkommen zu erfahren.37
2.2 ZU DEN PRAKTIKEN SELBST
Was heißt es aber, vom Pilgern als einer kirchlichen Praktik zu sprechen? Im Blick ist zunächst eine »routinisierte Bewegung des Körpers«.38 Mit dieser rudimentären Bestimmung eines körperlich-materiellen Vollzugs ist auf das Elementare verwiesen, das jede Praktik auszeichnet.39 Es ist eine Form der Kommunikation, in der verbale und non-verbale Arten der Gottesbegegnung in einer charakteristischen, auch für Außenstehende wiedererkennbaren Weise zusammenkommen. Wenn ich Pilgern als eine kirchliche Praktik begreife, bei der sich zunächst einmal alles um das Gehen dreht, ist genauer zu klären, was im Unterschied zum klassischen Praxisbezug ins Auge fällt. Ich folge hierfür Julia Koll, die eine praktisch-theologische Beschäftigung mit praktischtheoretischen Konzeptionen im Anschluss an den so genannten Practice Turn fordert.40
Der Anstoß zum Turn ging im Jahr 2001 vom US-amerikanischen Sozialphilosophen Theodore Schatzki aus.41 Praxistheorien, die sich mit bestimmten Kontexten, Körperbewegungen und Artefakten befassen, können ganz Unterschiedliches als Praktiken anvisieren. Es können Sportarten wie Fußball, Alltagstätigkeiten wie Kochen oder Freizeitbeschäftigungen wie Singen im Chor sein. Reckwitz nennt drei Merkmale eines konzeptionellen Idealtypus einer auf Praktiken ausgerichteten Praxistheorie:
– die Aufmerksamkeit für die offensichtliche Körperlichkeit und Materialität,
– der Fokus auf ein inkorporiertes Wissen über Gegenstände und Personen und wechselseitige Beziehung,
– der Akzent der Zeitlichkeit des Sozialen: Praktiken vollziehen sich performativ zwischen Routine und Unterbrechung.42
Die Diskussion, ob und wie Praktiken als zentrales Element des Sozialen zu sehen sind und wie sich verschiedene Praktiken in einer bestimmten Lebensform bündeln, wirft viele Fragen auf, die zweifellos interessant sind, auf die ich aber nur zum Teil und nur am Rand eingehen kann.43 Mein erkenntnisleitendes Interesse, wie ich es am Attribut des Kirchlichen oben zu zeigen versucht habe, lässt mich nach der Gemeinschaft der Pilger fragen.44 Was zeichnet sie als Gemeinschaft aus und wie verändert sie sich? Wo lässt sich das kirchliche Erbe erkennen und wo verwischt es sich oder löst sich auf?
Die mit dem Pilgern verbundenen Symbolisierungsprozesse kennzeichnen dieses als eine ästhetische Praktik, die – ähnlich wie ein Ritual – auf die gegenseitige Bestätigung und Bestärkung in der Gruppe angewiesen ist. Wer sich auf einen als Pilgerweg bestimmten Weg an einen als Pilgerort bestimmten Ort aufmacht, ist selbst dann Teil der Community, wenn sie oder er sich als nicht-religiös bezeichnet oder mutterseelenallein unterwegs ist. Einerseits bettet die ausgeführte und aufgeführte Aktivität in eine bestehende Gemeinschaft ein, andererseits eröffnen sich zwangsläufig Spielräume für heterogene Deutungen, Erwartungen und Intentionen.45 Dass darum die Vorstellung einer kirchlichen Praktik als einem festgefügten Praxiszusammenhang von individuellen und subjektiven Teilnehmerperspektiven perforiert wird, ist nicht weiter erstaunlich. Den praxistheoretischen Richtungsstreit zwischen Objektivität und Subjektivität, wie er in den Sozial- und Kulturwissenschaften ausgetragen wird, kennt die Praktische Theologie schon lange und in ganz unterschiedlichen Bezügen. So muss sie beispielsweise vom Gottesdienst als einem bestimmten Ritus reden und weiß doch, dass der Gottesdienst unterschiedlich erlebt werden kann und bei den Rezipienten kognitive Dissonanzen entstehen können, die bearbeitet werden müssen. Schließlich können Praktiken, die keine Resonanz erzeugen, auch aus dem Repertoire der geistlichen Übungen verschwinden oder auswandern.
Pilgern als Praktik zum Gegenstand des praktisch-theologischen Nachdenkens zu erheben, heißt gerade nicht, sich auf die Seite der Strukturalisten zu schlagen, sondern sagt Ja zu einem Denkstil, der dazu auffordert, »Religion und Religiosität nicht als Einstellung und individuell-punktuelles Erleben zu konzeptionalisieren, sondern als stetige soziale Praxis, die erlernt, eingeübt und mit anderen geteilt wird.«46 Dabei dürfen die nonverbalen Bezüge und die praktisch-performative Dimension, aber auch Unterscheidungen, die das weite Feld sinnvoll begrenzen, nicht vernachlässigt werden! Mit Blick auf die vielgestaltige Praktik und die Heterogenität der Gemeinschaft der Pilger legt es sich mit Bezug auf die Kommunikation des Evangeliums nahe, erstens diejenigen Wanderer als Pilger zu bezeichnen, »die sich mit einem geistlichen Anliegen – wie weit es auch gefasst sein mag – auf einen Weg begeben«47, und zweitens Pilgergang und Pilgerstand zu unterscheiden. Letzteres steht für eine Deutung der irdischen Existenz als Lebensreise, die erst in der himmlischen Heimat endet. Mit dem physischen Gehen, dem Aufbruch an einen heiligen Ort oder einen Gang der Heiligung, der den Alltagstrott unterbricht, hat die Metapher des Pilgerstandes nur abgeleitet und indirekt zu tun. Man muss nie gewandert sein, um ein solcher Pilger zu heißen und es muss noch kein Pilger sein, wer gerne wandert.
Im Unterschied zum »Pilgerstand« rückt der »Pilgergang«, die »Pilgerfahrt« oder die »Pilgerreise« stärker die Praktik und damit auch die körperliche Tätigkeit ins Blickfeld. Anders als das Studium des Pilgerstandes, das den Pilgergang vernachlässigen kann, weil sich das Nachdenken um eine Metapher dreht, muss eine Untersuchung des Pilgergangs das körperliche Gehen deuten. Denn hier geht es ja um einen engen Konnex zwischen dem, was die Praktik bewirken soll, und den Vorstellungen, die mitlaufen.
So befruchtend es also ist, den Blick zu weiten und die Praktiken in ihrer ganzen phänomenalen Breite zu erkunden, so wichtig ist es, die Koordinaten zu bestimmen, die das Feld der Untersuchung theologisch begrenzen bzw. öffnen und vertiefen. Vom Pilgern als einer »kirchlichen Praktik« zu handeln, betont einerseits die Einbettung in die Sozialgestalt des Glaubens, will aber auch an die Quellen erinnern, denen sich die Kirche verdankt und die sie qua Praktiken als gestaltende Kraft erfährt. Die Kirche steht und versteht sich in der Praxis der Nachfolge niemals abstrakt. Sie ist die Weggemeinschaft derjenigen, die den Glauben praktizieren. Wenn im Laufe dieser kleinen Studie immer wieder von Jesus als dem ersten Pilger die Rede ist, soll dieses Verständnis der Weggemeinschaft konkretisiert werden und mit der Geschichte seiner (gescheiterten) Wallfahrt verknüpft werden. Es geht bei der kirchlichen Praktik, insofern Kirche Erzähl- und Erinnerungsgemeinschaft ist, nicht nur um eine bestimmte geistliche Übung, sondern immer auch um ein Narrativ, das hilft, sich den wandernden Jesus vorzustellen und ihn als ein Bild zu schauen, das den Betrachter anschaut und verwandelt. Ich werde diesen Gedanken in Kapitel 3. entfalten und halte an dieser Stelle mit Jan Olav Henriksen fest:
»Christianity is constituted by a chain of memory that links back to and uses the Jesus story, as this story is mediated to individuals via the Christian community. […] Practices that mediate the memory of the past simultaneously articulate the implications of the Jesus story for the future. Memory is, in Christian practice, thus not a nostalgic return to the past. It is used actively in different practices to open up the present and the future in a constant negotiation process that expresses its orientation towards the future. The Jesus story thereby is the semiotic reservoir that enables Christians to understand their own lives and practices as distinctly Christian.«48
2.3 HEILIGUNG, HEILUNG UND HEIL IN DER COMMUNIO VIATORUM
Geistliche Praktiken wollen etwas bewirken. Die beabsichtigte Wirkung kann biblisch-theologisch als »Frucht des Geistes« (5,22 f.) bezeichnet werden,49 eine Frucht, die denen verheißen ist, die aus dem Geist leben und im Geist wandeln (Gal 5,25). Was den geistlichen Lebenswandel ausmacht, wohin er führt und was ihn von anderen Gängen unterscheidet, wird in der Dogmatik und Ethik mit der Lehre der Heiligung bedacht. Wenig überraschend ist die Wegmetapher durchgängig präsent. Sie verbindet die narrative Tiefenstruktur mit dem Metanarrativ der Lebensführung.50 Sie macht auch deutlich, dass der Pilgergang als kirchliche Praktik etwas mit der Heiligung – und ich füge hinzu mit Heil und Heilung – als einer Wirkung des Heiligen Geistes zu tun hat beziehungsweise haben soll. Rechtfertigungstheologisch gesprochen ist die Praktik kein »Werk« und doch eine Aktion, weil das, was Gott durch Christus im Geist realisiert, in der Gemeinschaft der Heiligen aktualisiert wird.51 Bewirkt kirchliche Praktik nicht das, wozu sie bestimmt ist, ist sie zu kritisieren. Die Reaktion der Reformatoren auf die Wallfahrtspraxis, die am Ende des Spätmittelalters in verschiedener Hinsicht ihren eigentlichen Zweck verfehlte, weil sie missbräuchlich war, ist ein historisches Beispiel für die theologische Kritik einer Praktik, die sich verlaufen hat.52





























