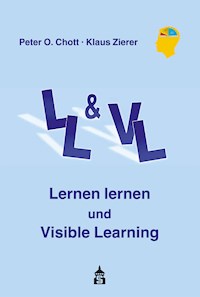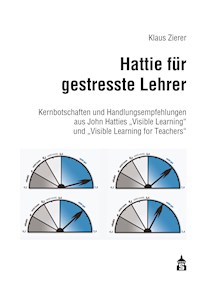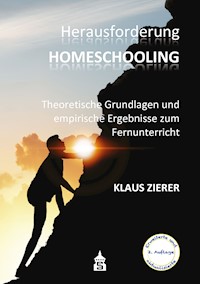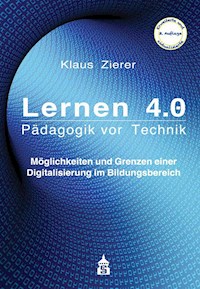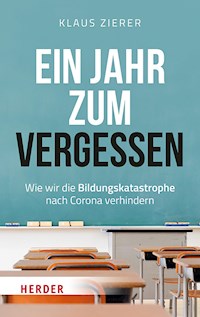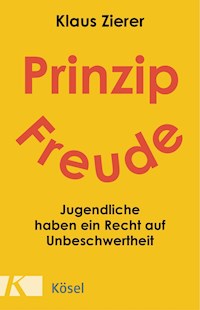
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Ähnliche
Studien zeigen, dass Jugendliche und Kinder heute zunehmend in einem Klima der Sorge aufwachsen. Überlastung, Stress, Schulangst, Cybermobbing oder der Klimawandel sind nur beispielhafte Stichworte. Für den Vater und Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer sind diese Erkenntnisse Grund zu einem Appell: Heranwachsende brauchen wieder mehr Freude! Eltern müssen den aktuellen Entwicklungen etwas entgegenstellen und mit pädagogischer Kompetenz und Haltung ihre Kinder noch stärker unterstützen.
Klaus Zierer, geboren 1976, ist Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und Associate Research Fellow am ESRC Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (SKOPE) der University of Oxford. Zuvor war er Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Oldenburg und hat an der LMU München promoviert und wurde dort habilitiert. Nach dem Studium des Grundschullehramts war er zunächst mehrere Jahre als Grundschullehrer tätig. Als Experte ist der Erziehungswissenschaftler häufiger Interviewpartner und Gastautor in den Medien, u. a. bei SZ, DIE ZEIT, FAZ, ARD, 3sat, arte und ORF Doku sowie PSYCHOLOGIE HEUTE und Eltern family. Klaus Zierer ist Vater von drei Kindern.
Klaus Zierer
Prinzip
Jugendliche
haben ein Recht auf
Unbeschwertheit
Kösel
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2021 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Weiss Werkstatt München
Umschlagmotive: © Bogdanovich_Alexander/Shutterstock.com
Grafik siehe hier: © Prof. F. Schulz von Thun
Zitate: siehe hier: Günter Grass »Was Freude bringt« aus Günter Grass: Eintagsfliegen, © Steidl-Verlag, Göttingen 2012.
Siehe hier: Josef Guggenmos, »Der Regenbogen«, aus Josef Guggenmos, Was denkt die Maus am Donnerstag?, © 1998 Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel
Redaktion: Jennifer Wagner
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-27992-9V001
www.koesel.de
Inhalt
Jugendliche brauchen Freude!
Mein Anliegen als Pädagoge
Was ist Freude eigentlich?
Eine Annäherung
Warum ist Freude so wichtig für Jugendliche?
Die Big Five der Freude
Leben im Hier und Jetzt:
(K)ein Grund zur Freude
Freue dich!
Freude als Bildungsziel
Pathologien der Freude:
Ein integrativer Ausblick
Literatur
Über den Autor
Jugendliche brauchen Freude!Mein Anliegen als Pädagoge
»Fast jeder zweite Schüler leidet unter Stress« (Ärzteblatt, 2017)
»Was tun, wenn schon Jugendliche Burnout haben?« (Süddeutsche Zeitung, 2019)
»1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler von Cybermobbing betroffen«
(Süddeutsche Zeitung, 2017)
»Nie allein, aber auch nie wirklich zusammen – warum so viele junge Menschen so einsam sind« (Stern, 2020)
»Generation K: Jetzt kommen die Ängstlichen« (Die Zeit, 2017)
»75 Prozent der psychischen Erkrankungen vor dem 24. Lebensjahr« (Tagesspiegel, 2020)
Vielleicht kennen Sie die eine oder andere Schlagzeile, die in den letzten Jahren durch die Presse ging. Schlimmstenfalls sind Sie direkt davon betroffen (gewesen). Vergleicht man die Zahlen verschiedener Untersuchungen, die diesen Schlagzeilen zugrunde liegen, so zeigt sich das Ausmaß des Problems in seiner ganzen Tragweite. Denn diese Studien belegen, dass die angesprochenen Probleme keine Eintagsfliegen sind, sondern ein massiv anwachsendes Gefährdungspotenzial für Kinder und Jugendliche und damit für die ganze Gesellschaft darstellen. Ohne in einen Alarmismus zu verfallen, sind folgende Zahlen beachtenswert:
Die Shell-Jugendstudie 2019 (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel, 2019), die seit 1953 regelmäßig durchgeführt wird, geht unter anderem der Frage nach, ob Ängste die nachwachsende Generation in einer besonderen Weise umtreiben und worüber diese sich besonders sorgt. Im Längsschnitt zeigen die Ergebnisse deutlich: Junge Menschen haben immer schon Sorgen gehabt, die aber angesichts aktueller Entwicklungen zunehmen: Umweltzerstörung, Terrorismus und Angst vor Zuwanderung seien 2019 die bestimmenden Themen gewesen.Lee Jenkins (2015), US-amerikanischer Bildungsforscher, konnte nachweisen, dass die Freude am schulischen Lernen nahezu kontinuierlich abnimmt: Seien es in der ersten Klasse noch fast alle Kinder, die gerne zur Schule gingen, falle die Quote auf gut 30 Prozent in der neunten Jahrgangsstufe, um sich bis zum Ende der Schulzeit auf knapp 40 Prozent zu erholen. Mit anderen Worten: Die Schule verfehlt ihren ureigenen Bildungsauftrag, nämlich den Kindern Freude am Lernen zu vermitteln.Laut WHO-Meldung (2018) nehmen sich weltweit 800.000 Menschen jährlich das Leben, hochgerechnet also alle 40 Sekunden einer. Damit zählt Suizid zu den häufigsten Todesursachen. In Deutschland seien das laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2019 über 9.000 Personen, darunter um die 200 Jugendliche gewesen.Die NAKO-Studie ist eine der größten Gesundheitsstudien weltweit. Sie erforscht Volkskrankheiten, darunter auch psychische Erkrankungen. Einer Mitteilung aus dem Jahr 2019 zufolge zählten Depressionen zu den am weitesten verbreiteten Krankheiten. Schätzungsweise seien allein in Deutschland 4 Millionen Erwachsene betroffen und die Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden, wird auf 20 Prozent geschätzt. Der Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit 2019 (vgl. Storm [Hrsg.], 2019) belegt diese Zahlen für junge Menschen: Jedes vierte Schulkind zeige psychische Auffälligkeiten. Zwei Prozent litten an einer diagnostizierten Depression und ebenso viele unter Angststörungen. Hochgerechnet seien circa 238.000 Kinder und Jugendliche so stark betroffen, dass sie ärztliche Unterstützung hinzuzögen. Im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2018 sei die Depressionshäufigkeit um fünf Prozent gestiegen. In den Sekundarstufen litten doppelt so viele Mädchen wie Jungen unter ärztlich diagnostizierten Depressionen. In den JIM-Studien wird regelmäßig davon berichtet, dass Jugendliche mit Mobbing im Netz konfrontiert werden. Im Jahr 2019 habe knapp ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen angegeben, jemanden im Bekanntenkreis zu haben, der Opfer geworden sei, und acht Prozent hätten diese Erfahrung selbst gemacht, wobei Mädchen doppelt so oft betroffen seien wie Jungen (vgl. mpfs, 2019).Die COPSY-Studie (vgl. Ravens-Sieberer et al., 2021), die insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Jugendliche untersuchte, kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie verschlechtert habe. Es werde vermehrt von psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten berichtet.Für mich als Pädagogen sind diese Zahlen und die damit verbundenen Schlagzeilen aber nicht nur Grund zur Sorge. Vielmehr sind sie für mich der Grund für einen Appell: Jugendliche brauchen Freude!1 Wenn Kinder und Jugendliche immer weniger Gelegenheiten haben, sich zu freuen, dann steht das Einfallstor für vielfältige Übel weit offen. Wir müssen also den aktuellen Entwicklungen etwas entgegenstellen und Kinder und Jugendliche mit pädagogischer Kompetenz und Haltung unterstützen. Dabei geht es mir nicht darum, alles Neue dafür verantwortlich zu machen, dass die Welt der jungen Menschen aus den Fugen geraten ist: Die Medienflut, der Wertewandel, die Konsumorientierung und vieles andere mehr bleiben nicht folgenlos. Insofern wäre eine kulturpessimistische Sichtweise durchaus denkbar, ja sogar berechtigt.
Aber sie würde sich schnell in einem Hätte, Könnte, Sollte verlieren und schließlich an den Strukturen zerbrechen. Als Pädagoge möchte ich anders an das Problem herangehen: Nicht an den Strukturen drehen, sondern diese von innen heraus neu denken. Ich möchte also optimistisch in die Zukunft blicken: Menschen können vieles schaffen, wenn sie entsprechend darauf vorbereitet werden. Bildung wird damit zum Schlüssel – wenn man sie richtig versteht. So meint Bildung im Kern das, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Es kommt also darauf an, Menschen zu stärken – durch Zeit für Freude.
Aber blicken wir auf die großen Herausforderungen der Gegenwart, um nicht weltfremd zu argumentieren. Man muss schon eingestehen: Zeit für Freude scheint es nicht zu geben. Beinahe täglich führen uns alle möglichen Medien durch Bilder der Verwüstung, der Zerstörung, der Angst und der Verunsicherung vor Augen, wie groß die Herausforderungen der Gegenwart wirklich sind. Auf den ersten Blick gibt es keinen Grund zur Freude. Vielmehr überwiegt der Grund zur Sorge. Wäre es daher nicht angemessener und zeitgemäßer, über die Sorge und nicht über die Freude zu schreiben?
Historisch betrachtet gibt es dieses Prinzip der Sorge bereits und es hat durchaus seine Berechtigung. In besonderer Art und Weise findet es sich ausbuchstabiert in Martin Heideggers Philosophie (2001), in der der Mensch und seine Existenz unter die Lupe genommen werden. Das bestimmende Moment der Analyse: Das Dasein sei Sorge. Der Mensch sorge sich um sich selbst, sein Hab und Gut, seine Familie, seine Freunde. Er müsse sich um Essen und Trinken sorgen, um Nähe und Geborgenheit, um Sicherheit und Arbeit – und, sofern man nicht aus dem Leben gerissen werde, müsse man sich auch um seinen Tod und die damit verbundenen Folgen sorgen. Sorge treibe also an und sei so zentral für den Menschen, dass er sich ihr gar nicht widersetzen könne.
Dazu drei Beispiele: Der Klimawandel fordert Menschen heraus, sich um die Umwelt zu sorgen – nicht nur um der Umwelt willen, sondern um der Menschen willen. Denn die Natur braucht nicht uns, um zu leben, sondern wir brauchen die Natur, um zu leben. Kriege führen weltweit zu Flucht und Vertreibung, was aufseiten der betroffenen Menschen ebenso zur Sorge führt als auch aufseiten der Menschen, die sich dieses Leids annehmen. Und schließlich stehen immer wieder Menschen vor existenziellen Fragen, wenn Firmen die Schließung droht.
Die Sorge ist also das Prinzip der Gegenwart – auf den ersten Blick ohne Frage. Auf den zweiten Blick offenbart sich aber, dass ein Leben in ausschließlicher Sorge kein Leben ist und unmenschlich wird. Der Mensch richtet sein Leben nicht nur nach den Fragen der Sorge aus. Es gibt weitere Motive, die wichtig sind und die einer Sorge diametral gegenüberstehen. Ein bekanntes und vielleicht auch das wichtigste in Zeiten globaler Herausforderungen ist das Prinzip Freude. Um die Freude soll es in diesem Buch daher auch gehen.
Sich mit dem Prinzip Freude auseinanderzusetzen, ist zeitgemäß und zeigt sich selbst in den bereits skizzierten Krisen: Wenn Umweltschützer auch in Zeiten des Klimawandels, der zunehmenden Plastikvermüllung, weiter ansteigenden CO2-Ausstoßes und unaufhaltbar anmutenden Artensterbens Bäume pflanzen, Tümpel anlegen und zu Müllsammelaktionen aufrufen, dann ist das Motiv eindeutig: Das Gefühl, auch in der Ohnmacht etwas Sinnvolles zu tun, gibt Kraft und bereitet Freude. Wenn Menschen, die auf der Flucht sind, selbst in widrigsten Umständen dem Leben noch Freude abgewinnen können. Und wenn Mitarbeitende, selbst am letzten Tag, bevor das Unternehmen schließen muss, mit vollem Elan ihre Arbeit erledigen, dann ist es die Freude, die antreibt und Zuversicht gibt.
Eine besondere Bedeutung erhält das Prinzip Freude, wenn man in diesen Zeiten Jugendliche begleitet und beobachtet. Auch sie sorgen sich: um die Natur, um die eigene Gesundheit und auch um die ihrer Eltern, Großeltern und Freunde. So mancher reflektiert im Hinblick auf die Zukunft, ob ökonomisch alles gut gehen wird. Aber Jugendliche brauchen Freude. Die Zuversicht und das Urvertrauen in das Leben, dass alles gut wird, sind prägend und grundlegend für eine gesunde Entwicklung. Wie sollen diese Zuversicht und dieses Urvertrauen entstehen und gedeihen, wenn Kinder und Jugendliche nur Sorge erfahren? Soll die junge Generation sich nur noch sorgen und ihr Lebenselixier der Unbeschwertheit und der Leichtigkeit einfach so ad acta legen, wie wir Erwachsenen es können? Für Kinder und Jugendliche führt ein Leben in Angst und Sorge zu einer »pädagogischen Klimakrise«, wie Ken Robinson (2018) es nennt, und damit zu gravierenden Fehlentwicklungen – physisch, psychisch und sozial.
Gerade auch deswegen ist eine Auseinandersetzung mit dem Prinzip Freude notwendig. Jugendliche brauchen Freude. Sie ist das Salz in der Suppe, ohne das nichts schmeckt und auch nichts schmecken kann. Freude ist der Gegenpol zur Sorge und daher in Zeiten von Krisen und globalen Herausforderungen wichtig. Aber was ist damit gemeint, wenn wir von Freude sprechen? Worin liegt der Unterschied zu Glück, Lust, Heiterkeit, Witz oder Humor? Freude zeigt sich also als schillernder Begriff. Allerdings wird dabei deutlich, dass jeder Schritt, das Verständnis von Freude zu schärfen, ihre Bedeutung für die Entwicklung des jungen Menschen sichtbar macht. Angesichts der bereits angesprochenen Krisen stellt sich die Frage, was heute die größten Verhinderer der Freude sind. Was kann man ihnen entgegensetzen? Dabei zeigt sich: Freude ist nicht nur ein Gefühl, sondern Freude hat immer Gründe, über die es sich nachzudenken lohnt. Ist es in einer Situation die Solidarität, die wichtig ist und Freude bereitet, kann es in einer anderen Situation die Ichbezogenheit sein, die antreibt und berechtigt ist. Ist es in einer Situation der Verzicht, der das Leben erfüllt, kann es in einer anderen Situation der Genuss sein. Schließlich zeigt sich bereits an diesen Überlegungen: Das Prinzip Freude ist nichts Einfaches, aber etwas Wichtiges. Menschen müssen lernen, sich zu freuen und ihre Freude zu reflektieren. Denn erst im Abwägen der jeweiligen Gründe kann sich wahre Freude entfalten. Der Mensch ist in der Lage, sich zu freuen, und er muss es auch, wenn er als Mensch leben möchte. Immer und immer wieder müssen wir uns selbst in den größten Krisen unseres Lebens fragen, wo es Gründe zur Freude gibt. Ebenso wichtig ist es, die Freude in Momenten, in denen sie offensichtlich zutage tritt, bewusst und besonnen wahrzunehmen. Es gibt folglich Wege zur Freude und damit wird Freude zum Bildungsziel. Der Ausruf »Freut euch!« wird zum pädagogischen Programm.
Dass es auch heute noch genügend Gründe zur Freude gibt, sollen diese Schlaglichter deutlich machen:
Die Shell-Jugendstudie 2019 (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel, 2019) berichtet, dass der Prozentsatz derjenigen, die sich sozial, politisch beziehungsweise ganz einfach für andere Menschen engagierten, zwischen 33 und 40 Prozent liege. Über die Hälfte der befragten Jugendlichen blickten optimistisch in die Zukunft – trotz Krisen.Die Studie u_count des DKJS (2020) belegt: Junge Menschen wollen sich engagieren und die Gesellschaft mitgestalten. Dafür brä