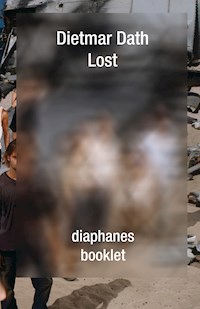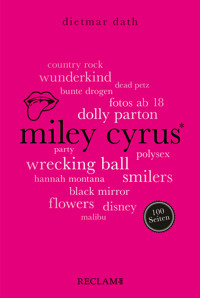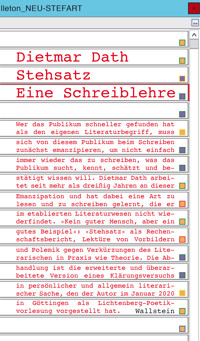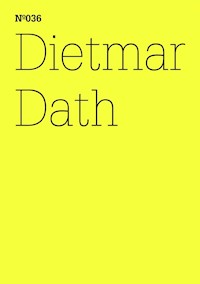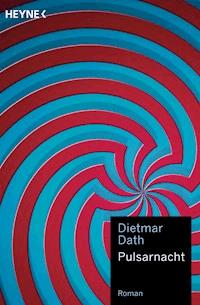
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Was wäre, wenn … eines Tages alles anders wäre?
Die Menschen der Zukunft haben sich weit von dem entfernt, was wir als »Mensch« kennen – und doch haben sie immer noch die alten Bedürfnisse, träumen die alten Träume, kämpfen die alten Kämpfe. Bis sich eines Tages die »Pulsarnacht« ankündigt, ein astronomisches Ereignis, nach dem sprichwörtlich nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Und wer das Geheimnis dieser Pulsarnacht kennt, kann die letzten Rätsel des Universums lösen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Ähnliche
Dietmar Dath
Pulsarnacht
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Copyright © 2012 by Dietmar DathCopyright © 2012 dieser Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHRedaktion: Sven-Eric WehmeyerUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, MünchenSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN 978-3-641-08693-0www.heyne.de
Die Ältesten in Rom wurden gefragt: Wenn Er an den Götzen keinen Gefallen hat, warum vernichtet Er sie nicht? Sie sagten zu ihnen: Wenn sie einer Sache dienen würden, deren die Welt nicht bedarf, so würde Er sie vernichten. Doch siehe, sie dienen der Sonne und dem Mond, den Fixsternen und den Wandelsternen. Soll er denn der Narren wegen Seine Welt zugrunde richten?
Talmud: Mischna Awoda Sara IV, 7
I think about a world to come
Where the books were found by the golden ones
David Bowie
Für Georg Fülberth
Erster Teil
Gesetzlose Dunkelheit
1
Hitze brannte in der elektrisierten Atemluft.
Flimmernd waberte sie über kalter, scharf riechender, metallisch schmeckender Flüssigkeit. Die Soldatin versuchte, nicht unterzugehen. Erstmals seit Beginn der Mission fürchtete sie um ihr Leben. Nahebei rührten sich Schatten, Flecken, vor ihr, hinter ihr, auch unter ihr. Das konnten Nachbilder der Angriffe von eben sein, Effekte der Memristorkatastrophe, die in der ersten Kammer die Waffenmeisterin getötet hatte, andererseits auch Überlebende aus der Crew, genauso gut unsichtbare Feinde.
Oder etwas wirklich Schlimmes.
Hitze, Kälte: Das erste schien flirrende Restwärme auf der Haut, von Flammenspießen in dem Raum, aus dem sie eben mit Armand und Sylvia geflohen war. Das zweite konnte Täuschung sein: Vielleicht war das nasse, schwappende Zeug in Wirklichkeit eher lauwarm und kam denen, die hineingesprungen waren, nur eisig vor, weil sie gerade beinahe verbrannt wären. Lauwarm – aber wahrscheinlich giftig, strahlend oder anders tödlich, etwa von Biomarcha durchwimmelt. Wenn Valentina daran dachte, kam es ihr vor, als könnte sie Geißelchen und Pseudopodien überall auf der Haut spüren.
Woher wollte sie überhaupt wissen, dass es sich bei der Flüssigkeit nicht um ein Lebewesen handelte, ein intelligentes womöglich? Sie befand sich ja nicht auf einem gewöhnlichen, trägen Himmelskörper. War die Suppe ein extremophiler Raumbewohner, eine Art besonders hässlicher Medea?
Zwei Stunden nachdem sie sich zusammen mit den anderen Bewaffneten Zugang zu der künstlichen, abgeschlossenen Welt verschafft hatte, in der das letzte gesuchte physische Attribut der flüchtigen Admiralin versteckt war, schwamm Valentina Elisabeta Bahareth ohne Schutzanzug im eisigen Schwappen.
Sie suchte nach einem Ausweg, einem Durchgang, bevor Arme und Beine zu müde wurden und sie sich aufgeben musste, versinken, ertrinken. Sie kam sich nackt vor, mit nichts als der hautengen goldenen Thermowäsche und ein paar Gurten am Leib.
Natürlich wusste sie, dass das eine alberne Panikattacke war. Genauso gut, wie man denken konnte: »Nackt – außer der Thermowäsche und den paar Gurten«, konnte man denken: »Tot – außer Herzschlag, Blutkreislauf und Atem.«
Valentina hatte die alten Lektionen nicht vergessen.
Was sie als Soldatin wusste, vom Drill bis zu den Parolen (»Wir fürchten nichts, schon gar nicht die Armeen aus dem Norden«), war jedoch bloßes Oberflächenwissen, etwas Andressiertes. Deshalb aktivierte sie auch ihre twiSicht nicht, auf die sie doch hätte setzen können, wenn ihr das Dunkel wirklich eine Last gewesen wäre und sie die Schatten naher bewegter Körper hätte durchschauen wollen.
Für den Verzicht auf die twiSicht gab es indes vernünftige Gründe: Nicht ausschließen konnte sie, dass es hier Sensoren gab, die auf die twiSignatur angesprochen und Valentina so als Zielscheibe erkannt hätten.
Keine technischen Hilfsmittel, dachte die Soldatin, solange Muskelkraft und Verstand reichen. So rief sie nichts auf, das vom Tlalok, der wertvollsten Marcha in ihr, versiegelt an der bestgeschützten Stelle tief im Schädel, gesteuert wurde.
Ähnlich hatte sie es schon auf der Akademie gehalten.
Dafür zog sie sich damals lange Erklärungen, Geschrei, harte Exerzierstrafen und Prügel zu.
»Typisch für Leute aus der Szewczyklinie!«, hatte ihr erster Marchatrainer ihr offen rassistisch ins Gesicht gebrüllt. »Dreckige, liederliche Bauern! Bei meinem Arsch, ich weiß nicht, wer euch Seuchenträger auf die Schulen lässt!«
Ein konzilianterer Kollege riet ihr: »Du lernst jetzt, wie du deinen Tlalok taktisch nutzt, oder ich verkaufe dich stückchenweise, Knochen für Knochen, Organ für Organ, an die Custai, dass sie wenigstens ein paar Läufer und Schlepper aus dir züchten!«
Valentinas immergleiche Erwiderung auf solche Vorhaltungen und Zurechtweisungen hatte gelautet: »Ich will meine Arbeit selber machen. Wenn der Tlalok alles regelt, ist er der Soldat, nicht ich.« Eine verhältnismäßig einfühlsame Lehrerin, am Ende von Valentinas Akademiezyklus, im entscheidenden Jahr, als die für den Einsatz in präsidialen Eliteeinheiten Rekrutierten lernen sollten, wie man schiffseigene sTlaloks mit dem eigenen Tlalok durch Ahtotüren und das Ahtomedium steuerte (»Tlalok ohne ›s‹ schlägt Tlalok mit«, hieß die Faustregel), hatte sie bei einem Grillfest am Rand der Föhrenwälder im autonomen Marginstaat auf Tamu ins Gebet genommen: »Mädchen, ich find’s ja charmant, dass jemand wie du, die offensichtlich den Tod nicht scheut, sich vor dem fürchtet, was im eigenen Kopf wohnt. Strohdummer Aberglaube ist es trotzdem.«
»Ich gebe einfach nicht gern die Kontrolle ab. An was anderes als mich. Was Fremdes.« Valentina suchte, wie so oft, nach den passenden Worten und fand keine, was nicht nur daran lag, dass der berühmte Margin-Himbeergeist ihre Zunge schwer und unbeweglich machte. Die weißhaarige Ausbilderin hatte mit den Lippen geschmatzt, den knochigen Kopf geschüttelt und leise widersprochen: »Was anderes als du … was Fremdes … den Tlalok so zu sehen, das ist, wie wenn man versucht, sich vom eigenen Hirn zu unterscheiden. Spaltungsirresein. Damit wirst du nicht weit kommen.«
Die anderen aus der damaligen dritten Klasse waren wahrscheinlich alle längst in irgendwelchen untergeordneten Sicherheitsjobs auf irgendwelchen Dreckklumpen im kartierten All der VL fett und langsam geworden – von wegen »die Besten der Besten«. Sie aber hatte sich in ehrgeiziger Dauerbereitschaft, auch die gefährlichsten Ausschreibungen mit Freiwilligenmeldung zu beantworten, das Privileg erkämpft, in diesem uneinnehmbaren, hinterhältigen, absolut tödlichen Sud zu ersaufen, erschossen zu werden, oder vom Stromschlag vernichtet.
Verbrannt, gefroren.
Gefressen.
Nicht weit kommen? Dieser Ausbilderin hatte sie es wirklich gezeigt.
Aus welcher Tiefe leuchtete das Silberweiß in der kühlen Brühe? Fünf Meter? Zehn? Sollte man das nicht doch per twiSicht messen? Kälte kroch wie eine Drohung mit Sehnenzerrung und Krampf unter die Haut. Valentinas blanker Kopf brannte und juckte eine Handbreit überm linken Ohr. Wahrscheinlich hatte sie einer der Flammenspieße doch berührt.
Es war stickig in der Höhle, dunstig, bedrückt. Bewegte sich da wieder was, dicht unter ihr? Gittertiere, oder jemand von der Crew?
Binturen waren gute Schwimmer, auch Taucher, obwohl sich das Fell eigentlich hätte vollsaugen und sie schwerfälliger machen sollen. Ein Fisch, ein Unterwasserwachhund, ein Raubtier, ein Monster aus lauter Zähnen?
Valentina hatte ihre Pistole in der Kammer oben zurückgelassen.
Sie lag auf irgendeinem Boden der komplizierten Architektur dieses lebensfeindlichen Ortes, wo jeder Boden im nächsten Moment eine Decke, jede Decke im nächsten Moment eine Wand sein konnte.
Die letzte Waffe, die sie bei sich hatte, war ihr Messer, ans linke Bein gebunden mit einem straff gezogenen Ledergurt, der noch ein paar andere Geräte festhielt. Es war ein sehr gutes Messer, Vollstahlkonstruktion, rutschsicherer Griff mit drei Löchern, die das Gesamtgewicht gegenüber herkömmlichen Kampfmessern entscheidend reduzierten, und einer Oberflächenbeschichtung aus diamantartigem Kohlenstoff. In der Ausbildung hatte sie keine Waffe lieber benutzt: robust war sie und gegen Störangriffe elektromagnetischer, chemischer und biologischer Art völlig unempfindlich. Sollte sie danach greifen?
Introspektiver Systemcheck: Der Juckreiz überm Ohr war irritierend, aber nicht bedrohlich, ihr Atem ging etwas zu flach, das Herz schlug einen Tick zu schnell.
Idiotische Reflexe: Sie brauchte eigentlich gar nicht zu atmen. Ein Befehl an den Tlalok genügte, und sie konnte bis zu zweihundertfünfzig Stunden von der C-Feldspeisung leben. Auch die Feuchtigkeit und Kälte hätte sie nicht auf sich einwirken lassen müssen. Im vom Tlalok auf Kommando ausgeworfenen Hautgitter überlebten Soldaten mitunter tagelang ohne irgendeinen Schutz nackt in Eisgräben, im Vakuum oder in Hochofenhitze. Im zweiten Linienkrieg sollten sogar Leute durch äußere Sternatmosphären geschleudert worden sein, deren Schiffe und Schutzanzüge zerstört worden waren, und dort für Sekunden, ja Minuten bis zum Wiederaustritt aus der Plasmahölle den ungeheuerlichsten Temperaturen widerstanden haben.
»Kinder, ich fürchte, jetzt wird gestorben«, sagte sie zu niemand Bestimmten, um noch einmal eine menschliche Stimme zu hören, bevor das Unvermeidliche geschah.
Dieses Kammerwetter, dachte sie, macht mich dumm. Wenn ich nicht bald aus der Suppe steige, vergesse ich, wer ich bin und was ich hier mache.
Schatten, jetzt schlank, paarweise, etwa anderthalb Menschen tief unter ihr. Doch der Bintur? Wie war der hier reingekommen, aus der STENELLA? Warum war er nicht tot? Valentina zog die Beine an, Knie auf die Brust.
Dann stabilisierte sie sich mit vorsichtigen Armruderbewegungen und machte sich bereit, nach dem Messer zu greifen.
»Mistviecher.« Die Stimme war rau, hallte trocken, dünn verzerrt, »bescheuerte Binturen gehören nicht in … unsere … Kommandos«, eine Art Glucksen folgte, zerhacktes Gurgeln.
»Armand?«, rief Valentina, die glaubte, die Stimme erkannt zu haben, und erschrak darüber, wie zaghaft ihre eigene klang. Platschen, Zischen war die Antwort.
»Armand? Comte, bist du das? Antworte, Soldat!« Das letzte Wort, im Befehlston, stärker und strenger als die Frage zuvor, kam ihr anmaßend vor, aber wenn sie nicht völlig falsch lag, war Kuroda tot, was sie selbst zur Ranghöchsten im Restverband machte.
»Antworte! Ich bin deine Vorgesetzte, ist dir das klar? Das ist keine Polizeioperation, das ist Krieg! Soldat!«, wiederholte sie. Es klang nicht mehr autoritär, nur von Schrecken gepresst. Immer noch ließ sie das Messer am Bein, trat jetzt auch wieder gestreckt durch – sie wusste, wenn sie das Werkzeug erst in der Hand hatte, waren ihre Schwimmbewegungen behindert.
Fliehen war meistens gescheiter als Kämpfen, wenn man einen Auftrag hatte.
Armand Mazurier, wenn er’s denn gewesen war, antwortete nicht.
Auch vom vermeintlichen Binturenschatten war nichts mehr zu sehen. Rechts von Valentina plumpsten zwei dicke Tropfen in die Flüssigkeit. Die kurze Aufregung verebbte, das Licht unter ihr nahm ab, verschleierte sich. Weil sie außer Wassertreten nichts zu tun hatte, rief Valentina Bahareth sich in Erinnerung, wie sie überhaupt in ihre heikle Lage geraten war.
2
Das Treiben aller Schiffe und Agenten und deren Wege einberechnet, hatte die Suche über vier Yasaka-Zentralzeit-Dekazyklen gedauert, also fast fünfmal so lange, wie die allermeisten Menschen auf den ärmeren kartierten Welten der Vereinigten Linien, vor allem hier draußen in den schwach erschlossenen Spiralarmen, überhaupt lebten.
Das Letzte, was den etwa zweitausend in beweglichen Einheiten organisierten Jägern des Präsidiums fehlte, um die Gesuchte gemäß der strikten Weisung Shavali Castanons wieder zusammenzusetzen und ihr den Auftrag der Präsidentin zuzustellen, war das Gesicht.
Man hatte die Admiralin Stück für Stück in Stürmen, kosmischen Eisschauern, unter der Oberfläche von Ozeanen und in Höhlen gesucht und gefunden. Dass sie den Ort freiwillig preisgeben würde, an dem ihr Gesicht zu finden war, galt als ausgeschlossen.
Das Gehirn und einen Großteil des Körpers hatte man in den ersten anderthalb Dekazyklen der Ermittlungen gefunden.
Weil bis auf das rechte Bein alle Gliedmaßen und bis auf etwas ganz Unnützes auch alle Organe der Verstreuten in der Milchstraße aufgebracht worden waren, konzentrierte sich auch die Gesichtsfahndung zunächst auf die schlecht kartierten Territorien im Skorpion und im Schützen. Als sich keiner der anfänglichen Hinweise erhärtete, stieß man auch ohne Ahtotüren weit in Richtung galaktisches Zentrum vor und trieb aufgrund der verschiedenen Dilatationseffekte und Konikenabstände bei konventioneller Raumfahrt mit Geschwindigkeiten nahe der des Lichts einigen Verrechnungsaufwand beim Koordinieren der Fahndungsrouten.
Die Verluste waren beträchtlich. Allein vierzehn Schiffe gingen in einer sinnlosen Konfrontation mit Festungen, gerüsteten Habitaten, planetaren Kesseln, zwei Dysonsphären und Zerstörern verloren, die zu aus den Linienkriegen verbliebenen, von der Nachricht des Kriegsendes offenbar noch nicht erreichten Siedlungen der Linien Kelemans und Durantaye gehörten.
Zum »Ausputzen«, wie das die Nachrichtenabteilung der CICs der VL nicht besonders feinfühlig nannte, wurde nach Eintreffen der Nachricht von diesem Zwischenfall in der Konik um den Präsidialsitz auf Yasaka eine kleine, aber schlagkräftige Flotte entsandt.
Ihrer sauberen, schnellen und von geschickter Frontspaltungs-Diplomatie flankierten Operationsweise verdankte sich die weitgehende Zerschlagung der Kelemans-Nester und die rasche Unterwerfung (»Friede in Ehre für beide Seiten«) der Durantaye-Relikte.
Mehr oder weniger gleichzeitig (die entsprechenden Lorentz-Transformationen einbegriffen) fand die Suche nach dem Gesicht der Admiralin einen neuen, von Gerüchten und Indizien unterschiedlichster Art nahegelegten Schwerpunkt im – von Yasaka aus durch die Zentralballung der menschlichen Heimatgalaxis gesehen – gegenüberliegenden Halobereich, wo viele Hundert Jägerschiffe weitere anderthalb Dekazyklen damit zubrachten, »so ziemlich jeden braunen Zwerg und jedes interstellare Stäubchen zu schütteln und zu quetschen, ob nicht das Gesicht der Verstreuten rausfallen würde«, wie die respektlose Rekrutin Sylvia Stuiving spottete, die am Custai-Hafen Tetwindsor zum Jägerverband um Kapitän Kuroda gestoßen war.
Stuiving hielt wohl grundsätzlich nicht viel von der Mission: »Die meisten langweilen sich tot bei so was, und dass ausgerechnet wir die Fratze finden, ist statistisch fast unmöglich.« Aussuchen aber konnte sie sich’s so wenig wie Valentina. Beide wollten aufsteigen und kamen aus schlechten Linien; für beide gab es zum Militär daher keine Alternative. So hatten sie an Bord schnell Freundschaft geschlossen.
Der einzige Unterschied zwischen ihnen war, dass Sylvia, die junge Spezialistin mit dem wilden roten Haar, der geraden Nase und den unzähligen Sommersprossen aus Erisberg, die ihren mangelnden Respekt vor nahezu allem – außer der Präsidentin – so gerne offen zur Schau stellte, ihre Qualifikation eben erst erworben hatte. Dass der ziemlich humorlose und in jede Art von Befehlskette verliebte Kuroda ausgerechnet ihrer Bewerbung gewogen gewesen war, unter denen aller Soldatinnen und Soldaten in allen Zwischenlandungshäfen, deutete zumindest auf gute Noten; Einblick in deren Charts erlaubte ihr Tlalok den Kameradinnen und Kameraden allerdings nicht.
Ursprünglich, das heißt beim Start vom Stützpunkt Saijo West auf dem waffenstarrenden Yasakamond Pelikan, war man an Bord von Kapitän Masaki Kurodas flinker STENELLA zu acht gewesen. Als ein Großteil des ursprünglichen Jägerschwarms sich im Halobereich auf die Suche machte und die STENELLA ihr Hin und Her auf der Westseite der galaktischen Scheibe, Richtung Zentrum, einstellen sollte, trafen verschlüsselte Auskünfte präsidialer Kundschafter beim Kapitän ein, die besagten, dass es neue, vielversprechende, möglicherweise ortungswissenschaftlich anspruchsvolle Hinweise gab, deren Verfolgung eine größere Späherzahl verlangte. Kuroda nahm deshalb zunächst drei neue menschliche Crewmitglieder auf, ließ dann einen Bintur an Bord kommen und verabschiedete sich, da die neuen Hinweise auch die Sicherheitsinteressen der VL betrafen, von den beiden Custai, die er mitsamt ihren fünf sehr gepflegten und fleißigen Dims an Bord gehabt hatte.
Die Reise sollte ja in einen entlegenen Ausläufer eines fast vollständig von Custai und wenigen Millionen Angehöriger besonders nichtmenschenfreundlicher Linien bevölkerten Milchstraßenspiralarms führen – »Da leben lauter Gerlich-, Degroote-, Vogwill- und Kelemans-Leute, das kann was werden«, hatte Sylvia Stuiving gestöhnt. »Kein Wunder, dass er die Custai laufen lassen muss. Nicht nur wir müssten sie dauernd beargwöhnen, auch sie selber hätten ständig Ärger mit ihren Verwaltungen und Firmenbossen, Anteilseignern, Aufsichtsräten und was weiß ich, was die Echsen sonst für Chefs haben.«
»Wieso Ärger?« Valentina fand die Idee abstrus.
»Na ja, weil es dann doch sicher gleich heißt, das ist Menschenpolitik, haltet euch raus. Die Vogwills und Kelemans sind noch nicht mal richtig rehabilitiert. Linienkriegs-Altlasten, das ist eine völlig verminte Konik da draußen, und wenn dann auch noch Custai reingezogen werden, sehen die das als beleidigende Indienstnahme ihrer Bürger für, ich weiß nicht, Laufburschendienste im Interesse zufällig siegreicher Fraktionen von Homo sapiens. Für die ist unsere Politik genauso unübersichtlich wie für uns ihr Handels- und Profitquatsch.«
Die Reptiloiden (»sind ja nicht wirklich Leute mit Echsengenom, erinnern uns nur physisch an den Phänotyp«, pflegte Schiffsarzt Dr. Zhou zu mahnen) wurden also verabschiedet. Auf EPR-Anordnung der Präsidentin hängte Kuroda ihnen noch ein paar »extrem sinnlos dekorative« (Sylvia Stuiving) Orden um die dicken Hälse und erklärte, »dass wir mit unseren beiden Custaifreunden auch ihre Dims verlieren, die uns ans Herz gewachsen sind« – das war’s.
»Herz, pfff. Als ob der eins hätte«, maulte Sylvia, »der fand bloß prima, wie die Dims sich rumkommandieren lassen. Ich finde sie eklig. Automaten sollten aus Metall sein, nicht biologisch. Sonst kann ich sie nicht von ernstzunehmenden intelligenten Lebewesen unterscheiden. Und dass sie ausgerechnet aussehen wie wir, jedenfalls sehr ähnlich, ist ja wohl ein ganz widerlicher Witz.«
Valentina mochte Sylvias Offenheit und ihre entschiedenen Meinungen zu allem Möglichen. Ihr zuzuhören war Valentinas Ventil für die Frustration infolge der langen Ergebnislosigkeit der Mission. Sie konnte die Kameradin stellvertretend für sich selbst mosern lassen und dann alles, was die so zischte, im eigenen Kopf wieder ein bisschen relativieren: So schlimm waren die Dinge ja meist doch nicht.
Kuroda hätte Sylvia den Kopf mit dem Schwert vom Rumpf gehauen, wenn er gewusst hätte, wie freimütig sie ihre Unmutsäußerungen überall anbrachte, wo man ihr zuhörte. Valentina hegte den Verdacht, dass viel davon auch Pose war. Sie konnte sich jedenfalls nicht vorstellen, dass man sich auf dem Schiff wirklich unwohl fühlte – sie selbst freute sich im Stillen eigentlich ständig darüber, dass die STENELLA so anders war als die fliegenden Personencontainer, in denen sie zuvor verschickt worden war, auf die üblichen taktischen, Command-Presence-, Boarding-, Antiterror-, Friedensstifter- und sonstigen Infanterie-Einsätze.
Kurodas Boot glich eher einem kleinen Ländchen, ein bisschen sogar dem autonomen Marginstaat ihrer Jugend. Es hatte seinen eigenen Wasserkreislauf mit künstlichen Gletschern am Kopfpunkt, weitestmöglich von den Schwerkraftmulden der Inertialinversionstriebwerke entfernt. Manchmal nieselte, regnete oder schneite es auf den Korridoren und in den größeren Hallen, oft gingen milde Winde.
Durch das ganze Schiff, die zwei echten und die sechsunddreißig eingefaltet virtuellen Kilometer, verlief ein als Wasserfall aus dem Kopfpunkt austretender, dort in einem von der Crew als natürliches Schwimmbad genutzten Becken zusammenfließender, sich dann über Mittellauf, Flussschlingen und Unterläufe schließlich in einer Art Marschlandschaft bei den schweren Maschinen sammelnder Strom.
Der verlief, was Valentina immer wieder entzückte, parallel zu zahlreichen kleinen Rasen-, Wiesen- oder Feldflächen in den Wänden, Decken und langen Röhrengelenkbögen des Schiffes. Der Strom fing, wenn man vom Kopf oder Bug zum Heck ging, immer wieder plötzlich an und hörte ebenso plötzlich wieder auf, weil er in die verborgenen Dimensionen der Innenarchitektur eingedreht war. Hielt man die Hand an einer Drehmannigfaltigkeit ins rauschende Wasser oder streckte die Zehen auf der Wiese etwas zu weit aus, verschwanden diese Gliedmaßen aus dem Hier und Jetzt und waren im Dort und Dann, präzise ausgestanzt, meistens entlang rhombischer Grenzen – wunderbar wie die kleinen Lichtfäden, die durch alle Räume schwebten und die Grundbeleuchtung sicherten, obwohl man sie nie direkt ansehen und auch nicht berühren konnte; eine Photofaktur, die sich mit der Vierdimensionalität menschlicher Körperlichkeit und Sensorik nicht reimte.
Valentina war kein grünes Mädchen.
Sie wusste genug über Luttingerflüssigkeiten, um die hübschen Leuchtwürmchen nicht für etwas Okkultes zu halten. Aber alles Wissen um eindimensionale Quantenzustände, in denen die Ladung und der magnetische Spin der Teilchen sich voneinander trennen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen ließen, sowie die an der Akademie erworbene Vertrautheit mit optischen Fasern, in denen man Atome zur Herstellung solcher Luttingerflüssigkeiten einfangen konnte, war nur ein Haufen abstrakter Ideen, die beim Anblick der gaukelnden Lichtmagie ins Vergessen fielen wie Regen aus Wolken.
»Man sieht sie aus den Augenwinkeln. Man denkt, man kann die Würmchen greifen, aber sie sind nicht zu fassen«, sagte Valentina zu Sylvia. Die lachte, schüttelte die roten Locken und antwortete: »Wenn ich so staunen könnte wie du, Kleine, wäre ich Wissenschaftlerin geworden, nicht Mörderin.«
Die STENELLA nahm, sobald die Echsen und ihre Dims verabschiedet waren, rasch Fahrt auf zur neuen Zielkonik. Erst wurden vier Ahtotüren durchquert, dann flog man mit 76 % der Lichtgeschwindigkeit durch Custai-Gebiet, danach passierte das Schiff zwei weitere Ahtotüren, und schließlich flog Kurodas Boot, halb lichtschnell, entlang der inneren Grenze eines »gurkenförmigen« (Sylvia Stuiving) Degroote-Sektors zur vergleichsweise sternarmen Region Troycas, einem lückenhaft kartierten Gebiet von abgerundet achtzehn Lichtjahren mittlerem Durchmesser.
Die Crew bestand, als man in Troycas eintraf, aus zehn Personen:
Tommi M. Bucksbaum, jr. war ein pummeliger, leicht maulfauler, allem Anschein nach aber zumeist gut gelaunter Chefnavigator, der während seiner Kernarbeitszeit, an skyphokonstruierten Tastleitungen aus Progma suspendiert, wie eine Spinne im Netz von der Decke der Brücke hing, wo man seinen Gesichtsausdruck hinterm blickdichten Visier des Kunstglashelms nur raten konnte. Arbeitete er gerade nicht, dann lag er selten in seiner Koje.
Stattdessen versuchte er für gewöhnlich, sein überschüssiges Körpergewicht durch vollständig wahnsinnige und aufgrund der Fressorgien, in die er sich hinterher fallen ließ, auch absolut sinnlose Trainingsexzesse zu reduzieren. Dass er bei alledem, einmal aus dem Tastleitungsgewebe gelöst, nicht ständig nach Schweiß roch, lag nur daran, dass er noch ausdauernder duschte, als er auf dem Fahrrad saß.
»Wenn der so weitermacht mit den Süßigkeiten und dem Frittierten«, mutmaßte Valentina, »wird er den Abschluss seines dritten Zyklus nicht mehr feiern können.«
»Und wenn er’s doch kann, tötet ihn spätestens die Torte zum Anlass«, ergänzte Sylvia.
Masaki Kuroda gab sich als Kapitän verschlossen und abweisend. »Die langen schwarzen Haare verraten aber, wie sensibel der Junge in Wirklichkeit ist. So seidig!«, schwärmte Sylvia. »Und dieses würdige Botschaftergesicht!«
Kuroda stammte aus einer alten Diplomatenfamilie der Mizuguchilinie, und zwar deren frühester Blütezeit: Der Kapitän war Mi 3++, wohl der einzige Mensch von so unvermischter Linienabkunft, den Valentina je aus der Nähe erleben würde. Seine Marotten sah man ihm nach: Literweise trank er auf der Brücke Tee, alle paar Tage wechselte seine Barttracht – Kinnbärtchen, Vollbart, Koteletten mit Schnauzer, ohne Schnauzer, Backenbart und alles wieder von vorn –, und aus seinen Privaträumen hörte man manchmal seltsame akustische Breven, düster und brummig gesungen von morschen Männerchorstimmen:
Auf Treue unterm windgepeitschten Weltbaum
Keiner kennt die Wurzeln
Gefesselt, durchbohrt von Pfeilen
Und seinem eigenen Speer
Schwimmt in Schmerzen, schaut in die Tiefe …
An Bord ging das Gerücht, Kuroda habe noch in den Linienkriegen gedient. Das hätte bedeutet, dass er sich bereits im letzten Zyklus befand. Sylvia war der Meinung, dass Andeutungen Kurodas und anderer Crewleute, die auf eine Beteiligung des Chefs an jenen Kampfhandlungen schließen ließen, lediglich gezielt vom Kapitän selbst ausgestreute Märchen waren, die seine Aura polieren sollten.
Dazu gehörte auch, dass er sich der Schrift- und Malbrevur mit einer für Beobachter, die ihn dabei in seinem Quartier überraschten, geradezu unheimlichen Geduld hingab. Am liebsten tuschte er, dabei in tiefes, oft halbe Tage anhaltendes Schweigen versunken, Porträts historischer Figuren, die in wenigen Strichen ihre Gegenstände unfehlbar trafen, darunter auffallend oft den Shunkan, der laut Bucksbaum und dem Polizisten Mazurier, aber auch Sylvia und dem Bintur, jedenfalls nicht verdient hatte, dass man sich für ihn interessierte.
»Der vielleicht gefährlichste, grausamste und größenwahnsinnigste Kriegstreiber der Geschichte der Menschheit«, posaunte Mazurier, während Dr. Zhou die Sache etwas gelassener sah: »Immerhin hat die Präsidentin der VL, die ihn damals so vernichtend geschlagen hat, ihn einen großen Menschen genannt.«
»Schon recht«, quengelte Sylvia, »die blöde Rede wieder.«
Gemeint war damit die Regierungserklärung Shavali Castanons ein halbes Jahr nach der entscheidenden Schlacht bei Alpha Lyrae.
»Der Feind, den wir besiegt haben, war kein Verbrecher. Die Gesetze, die er nicht anerkennen wollte, hätten ihm keine Nachteile eingebracht. Er war ohnehin davon ausgenommen. Er wollte sie nicht brechen, sondern abschaffen – nicht für sich, sondern für alle. Das ist ehrenhaft. Die Tugend hat er erst verlassen, als er für diesen Plan keine Mehrheit gewinnen konnte. Er rief zum Aufstand gegen die gesetzliche Ordnung als Ganze – und ist damit gescheitert. Wir sind erleichtert und glücklich über dieses Ergebnis. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Wir wollen den Frieden, den wir, wie unsere Gegner, mit gewaltigen Opfern bezahlt haben, allen gewähren, die sich am Wiederaufbau beteiligen werden. Ich rede nicht von einer Amnestie. Davon zu reden, wäre nur sinnvoll, wenn wir uns als eine Art Gericht aufführen wollten. Das haben wir nicht vor, denn, ich wiederhole mich: Der Feind war ein Feind, kein Verbrecher. Vergeltung an diesem Feind ist ein barbarischer Gedanke.
So haben wir uns denn für eine Lösung entschieden, die dem Shunkan und seinen Getreuen ihre Würde nicht raubt – also allen, die nicht eingesehen haben und auch weiterhin nicht einsehen wollen, dass die Ordnung, die sie beseitigen wollten, die beste ist, die wir finden konnten, wenn auch weit entfernt von Vollkommenheit, und ferneren Verbesserungen offensteht. Der Shunkan wird, so hoffen wir, seine Talente und die derer, die ihm beistehen, auf andere als politische und militärische Weise für jene einsetzen, für die er im guten Glauben an seine Sache gestritten hat. Die Armeen aus dem Norden sind nicht mehr. Das war unser einziges Ziel in diesem grausamen Krieg, und wir haben es erreicht.«
Eine vornehmere Art, den Shunkan und seine Vertrautesten ins Exil zu schicken, gab es nicht. Es war wohl diese damals alle Parteien auszeichnende Vornehmheit, eine gewisse Galantarie selbst beim Schlachten und Geschlachtetwerden, nach der sich Masaki Kuroda zurücksehnte. So tuschte er nicht nur oft den in drei Galaxien verhassten Shunkan, sondern manchmal auch die Präsidentin und ihren Stab, die Regierung, der er Treue geschworen hatte.
Aber er tuschte sie seltener als den Besiegten.
Saskia Hammarlund, Bucksbaums Ersatzkraft, weniger massig als er, gedrungen und quirlig, musste fast nie in die Tasterkabel steigen. »Tommi gibt nicht gern ab«, erkannte sie rasch, mit ihrem Los offenbar ganz zufrieden. In ihrer Koje, auf den Gängen des Schiffs oder im Gemeinschaftsraum spielte sie twiSicht-Spiele in allerlei selbstentworfenen Parcours, die angeblich die Sinne schärften, die Reaktionszeiten ihres Tlaloks verbesserten und generell »lehrreich« waren, wie sie meinte.
»Ehrlich gesagt«, verriet sie Valentina, »hoffe ich, wenn wir zurück sind, könnte das, was ich dabei rausgekriegt und erfunden hab, genug Aufmerksamkeit erzeugen, dass niemand über meine Bewerbung als Lehrerin an der Akademie lacht. Ich hab nicht vor, den Rest meiner kurz bemessenen Zeit als Siedlungsvorbereiterin, Jägerin oder Kurierin fürs Präsidium zu verschleudern. Einige der akademischen Welten – sagen wir, Kermaga oder Bäuml, auf jeden Fall aber Tamu – sind ja so schön, dass sie schwarz vom Touristenkrabbeln wären, wenn die VL-Marine sie sich nicht untern Nagel gerissen hätte. Das wird prima.«
In vielem verhielt sich Saskia wie eine Sparversion von Bucksbaum – ausgenommen seine etwas anstößige sexuelle Enthaltsamkeit (selbst der sonst asketische Kapitän ließ sich ja ab und an mit der Waffenmeisterin Norenzayan ein). Saskia, die weniger aß als der Chefnavigator und sich dabei klug auf Krabbenchips beschränkte, wählte ihre Begegnungen während der langen Wachzeiten tolerant und spielerisch.
Man konnte mit ihr auskommen. Zu ihren weniger einnehmenden Charakterzügen gehörte freilich ein Hauch von Speziesismus – nicht wirklich überraschend bei einer Angehörigen der späten Johansenlinie. Ihre Leute hatten während der großen Expansion der Menschheit unangenehme Abenteuer mit anderen Intelligenzen zu bestehen gehabt. Der Speziesismus, der ihr Erbteil war, entlud sich daher in gelegentlichen Beschwerden über »das Geschwirr an Bord«, womit die Speise-Insekten für den Bintur gemeint waren, deren Verhalten genetisch so kalibriert war, dass sie sich zwar in der Messe und einigen der Arbeitsbereiche, aber nur selten in den Gemeinschaftsräumen, an den Sportstätten oder auf der Brücke aufhielten, und überhaupt nie in den Kojen der Menschen. Wenn Valentina sich die Mühe machte, Saskia auf diese Tatsachen hinzuweisen, reagierte die Navigatorin brüsk: »Klar sitzen sie nicht plötzlich auf meinem Bett. Trotzdem: unangenehm. Findet ihr das nicht seltsam, ein Wesen, das aussieht wie eine Kreuzung aus Hund und Mensch, und es isst Käfer? Die er rumsausen lässt, wo sie wollen? Kann er sie nicht einfach in irgendwelchen Vivarien oder Terrarien züchten und da rausschnappen? Ist ja nicht so, dass er biologisch gezwungen wäre, sie fangen zu müssen, damit sie Nährwert haben.«
Dr. Zhou war der Einzige, der eine Antwort wusste: »Ich habe auf Binturenschiffen gedient und bin sogar mit Skypho geflogen. Überall hat man unsere exzentrischeren menschlichen Altertümlichkeiten, die wir längst hätten ablegen können – den Schlafrhythmus, die Paarungsabläufe, das Ernährungsspektrum notorischer Allesfresser –, bis kurz vor den Punkt der Selbstaufgabe respektiert. Wir sollten uns revanchieren. Dass sich, weil sie das selbst scheußlich fänden, die Insekten niemals auf deine Haut setzen, geschweige dich stechen oder sonstwie schädigen könnten, sollte dir genügen, Saskia.«
»Mein ja bloß. Es nervt halt«, grummelte die Belehrte, um das letzte Wort zu haben. Immerhin behielt sie ihren Artendünkel für sich, wenn der Bintur in Hörweite war.
Valentina Elisabeta Bahareth kam, weil sie keine Ansprüche stellte, eigentlich mit allen aus, am besten mit Sylvia. Das hatte eher Temperamentsgründe als sexuelle, auch wenn ihr die Liebe mit Sylvia am besten gefiel. Was deren eigene Vorlieben waren, ließ sich nicht so leicht erkennen. Eine Zeit lang übernachtete Sylvia häufiger beim Polizisten Mazurier, den sie allerdings als Person »vollständig unausstehlich« fand, wie sie Valentina mal nach einem längeren gemischten Tennisdoppel mit Mazurier und dem Kapitän verärgert beim Baden gestand.
»Der ist ein Komplettarsch. Der interessiert sich nur für seine Karriere.« Valentina beendete den Ärger mit einem längeren Kuss, dachte bei sich aber, dass das eigentlich ein ungerechter Vorwurf war, insofern er wahrscheinlich, etwas weniger zugespitzt, auf alle zutraf, die sich gegenwärtig an Bord der STENELLA befanden. Derart einerseits langweilige, andererseits strapaziöse Aufträge nahm man nicht an, wenn zu Hause, wo immer das sein mochte, irgendwer oder irgendetwas Nichtberufliches wartete. Das Thema beschäftigte Valentina bald mehr, als sie zugeben wollte, vor allem sich selbst gegenüber. Um sich nicht gänzlich darin zu verlieren, probierte sie, mit Sylvias großzügiger Hilfe, erstens neue Liebeskünste aus und brachte sich zweitens besser in Form, als sie seit der Qualifikation am Ende ihrer Akademiezeit gewesen war. Sogar längere koordinatorische twiSicht-Sitzungen nahm sie auf sich, bei aller Antipathie dagegen.
Sylvia Stuiving fiel selbst Kuroda als »Springquell der guten Laune« auf, auch wenn er sie, als er das sagte, zugleich ermahnte: »Immer nur sprudeln ist aber auch ein Fehler.«
Ihr Charme, ihre Ungeduld, rasche Auffassungsgabe, ihr lebendiger Geist und ihre beachtliche Schönheit belebten das Schiff, als wäre sie eine bewegliche Ergänzung zu den Wiesen an Wänden und Decken. Sylvia gab sich, als bemerkte sie nicht, dass alle in der Crew sie mochten und die Mehrzahl sie glühend liebte. Das herunterzuspielen gelang ihr vor allem deshalb, weil sie es sowieso gewohnt war. Schon auf der Akademie hatte es bei einer Eifersuchtsgeschichte um sie, einem Vorgang, wie er in dieser Epoche der Zivilisationshistorie im Grunde nicht mehr vorgesehen war, sogar Verletzte gegeben.
»Du bist nicht so perfekt wie die Stars in den Environs«, versuchte Valentina einmal, die Faszination in Worte zu fassen, die von Sylvia ausging, »aber du leuchtest halt. Und tanzt. Wo immer du bist. Was immer du tust.«
»Siehste, und weil ich mir dauernd so ’n Kitsch anhören muss«, erwiderte Sylvia, »bin ich dann wenigstens Mörderin geworden.«
Abhijat Kumaraswani diente auf der STENELLA als Marchandeur. Täglich inspizierte er penibel die Progmafakturen, die Nahrungssynthesizer, den zentralen Server der Tlalokeinschachtelung, die Lebenserhaltungssysteme, den Energiehaushalt, überhaupt alles außer den Waffen. Manchmal sah man ihn im Fluss stehen oder schwimmen und Selbstgespräche führen, während sein Tlalok ihm in twiSicht den inneren Zustand des Schiffes zeigte.
»Er redet mit dem Boot«, erklärte Tommi Bucksbaum. »Ich mach das auch oft, aber ich bin wenigstens nicht verknallt in die Kiste.«
Abhijat eignete nichts Maschinenartiges, Steifes oder Autistisches, wie man es bei Leuten, die hauptsächlich mit Marcha arbeiteten, manchmal fand. Privat war er witzig, aufgeschlossen, voller Anekdoten, lässig, nie nachlässig. Sehr selten zeigte er sich in der für den Aufenthalt an Bord keineswegs vorgeschriebenen, indes durchaus erwünschten und bei Hafengängen obligatorischen Präsidialgardeuniform. Lieber kleidete er sich in waldgrüne oder meerblaue, reinliche, aber immer etwas zerknitterte Stoffe. Sein rechts gescheiteltes, volles dunkles Haar sah stets aus, als wäre gerade eine ungebärdige Brise hindurchgefahren.
»Ich mag Apparate, und sie mögen mich. Aber ohne Menschen, Custai, Binturen, andere Leute würde ich bald durchdrehen, das ist klar« – das sagte er beim Umtrunk in der Sporthalle des Schiffs auf Nachfrage Sylvias, was er »eigentlich für ein Typ« sei.
Über seine Herkunft ließ er sich nicht aus. Er schien einem sehr späten Zweig der Tiltonlinie anzugehören. Das Skurrilste an ihm war sein Hobby: Er fertigte kleine Skulpturen, die sowohl Menschen wie anderen Spezies, intelligenten und trüben, glichen, aus Progma-Metallen, am liebsten synthetischem Damaszenerstahl und Chrom. Auf den Wiesen- und Feldflächen im Schiff stellte er diese Figuren zu kleinen Gruppen zusammen, die manchmal außerdem mit kleinen Lautsprechern versehen waren, aus denen Klangbreven emanierten, die sich mit dem Rauschen oder Pfeifen der sachten Winde zu melancholischer Traummusik verbanden. Wie die meisten Hobbybrevisten, denen Valentina begegnet war, trug Kumaraswani keinerlei Interesse daran, seine Arbeiten diskutiert oder explizit gewürdigt zu sehen. Er machte das, was er da machte, um der Sache selbst willen, und ließ es nie lange stehen.
Ob die Objekte sich selbst zersetzten oder er sie abbaute, bekam die Soldatin nicht mit, ihre Aufmerksamkeit gehörte ja anderen Dingen. Manchmal waren die Arrangements da, manchmal nicht, wie die lila Blütenpracht junger Zistrosen, die Düfte der Rosmarinbüsche, die Vielfalt der Nebenbach-Wasserläufe des Schiffsstroms, die Lavendelwinkelchen und verschlungenen Weinreben an der Außenwand des Motorenraums.
Armand »Comte« Mazurier, Leutnant beim Staatsschutz, sah gut aus und legte Wert darauf. Sein blondes Haar war rasiermesserscharf ausrasiert, seine gereizte Ungeduld trug er wie ein Parfüm. Natürlich missfiel ihm, dass er aus Zuständigkeits- und Dienstordnungskonfliktgründen nicht Erster Offizier des Schiffes sein konnte, sondern diese Position Valentina überlassen musste. Sie war dazu ohne jeden Ehrgeiz gelangt: Kuroda hatte ursprünglich damit gerechnet, dass man ihm während der ganzen Suche nach dem Gesicht der Admiralin gestatten würde, einen Cust als rechte Hand – und einen zweiten als formell nicht anerkannte linke – mitzunehmen. Die territorialpolitischen Imperative in der neuen Suchkonik schlossen das jedoch aus; so gab er sich mit Valentina zufrieden. Mazurier hätte der Kapitän freilich ohnehin ungern auf dem Posten gesehen; er gab sich nur widerstrebend mit dem Polizisten ab und ertrug mit zwar verhaltener, aber unverkennbarer Wut dessen unerbetene Lektionen in Politik und Verantwortung: »Wenn ich in die Gesetze schaue, ist die Admiralin, indem sie sich zerstreut hat, nicht weit von der Schwerkriminalität entfernt. Wenn ich aber in meine Befehle schaue, ist sie eine Kriegsheldin, die wir freundlich zu behandeln haben, falls wir sie oder irgendein Teil von ihr finden, etwa das Gesicht. Selbstverständlich löschen die Befehle die Gesetze aus. Dies ist eine der wichtigsten Wahrheiten über das, was wir hier tun – eine Wahrheit, die wir den Bürgern auf den gemütlichen kartierten Welten natürlich niemals erzählen dürften, weil sie sonst daran zweifeln könnten, dass die Vereinigten Linien ein Rechtsstaat sind. Das aber sind sie, und zwar der größte und beste und freieste, in dem Menschen jemals gelebt haben. Der Garant dafür sind nicht irgendwelche Gesetze, sondern allein die Klugheit, die Erfahrung und das niemals irrende Rechtsempfinden der Präsidentin.« In Sylvias Paraphrase: »Bla bla bla Arschkriech bla bla bla Buckel bla bla bla ich möchte in die Muschi von Shavali Castanon und dort ein Büro für Strebertum, Rechthaberei und Willkürherrschaft einrichten. Bla.«
Seinen Spitznamen, »der Comte«, hatte der Polizist sich als Environ-Süchtiger erworben. Noch lieber hätte er »der Chevalier« geheißen, was »Reiter« oder »Ritter« bedeutete, aber die Aussprache des alten Wortes glich zu sehr derjenigen des Vornamens der Präsidentin, den man ja, anders als diverse antike Orts- und Personennamen derselben Schreibung, auf dem »i« am Ende betonte, und »der Shavali« wäre selbst Mazurier zu loyalistisch vorgekommen. Wenn er gerade nicht wegen irgendeines EPR-Nachrichtenverkehrs mit den Organen des Präsidiums an Deck sein musste, trieb er sich nahezu ununterbrochen in einer twiGeschichte herum, die im Uralten spielte: Terra Firma, Frankreich, vor der Revolution gegen die Stände.
Mazurier gehörte im Spielszenario zu den Gegnern jener bürgerlichen Aufstände, weil diese, wie er sagte, »viel mit dem Verhalten der Abtrünnigen in den Linienkriegen gemein haben. Vor allem das Gemeine«. Obwohl er unablässig bei andern darum warb, ihn in diese virtuelle Welt zu begleiten, beließen es die meisten bei ein, zwei Besuchen auf seinem fiktiven Schloss. Die Einzige, die häufiger dort – und fast so häufig in seiner Koje wie Sylvia und Abhijat – herumturnte, Saskia Hammerlund, hatte dafür berufliche, mit der Programmierung von twiSicht-Environs verknüpfte Gründe.
Mazuriers Beitrag zum Gelingen der Mission war in Nebel getaucht. Bei jedem Landgang, in jedem Hafen, auf jeder Werft verschwand er – manchmal tagelang – ins Innere der jeweiligen Habitate oder Städte und traf sich dort mit Gewährsleuten unterschiedlichster sozialer Räume sowie ganz verschiedener Spezies, um Spuren nachzugehen, Gerüchte einzusammeln und zu erhärten – »Mantel und Degen, wie in seinem Environ«, erkannte Sylvia.
Jedes Mal zog er sich nach einem solchen Abstecher mit dem Kapitän und Tommi ins Quartier des Letzteren zurück, wo dann eine zwei- bis fünfstündige Besprechung stattfand, aus der die drei jeweils mit genauen astrogatorischen Daten für die nächste Etappe der Fahndungsroute an Deck zurückkehrten.
Dr. Bin Zhou, der Bordmediziner, war ein drahtiger, starker und geschickter Fechter, Tennisspieler und Boxer. Er bedauerte den Abgang der Custai noch mehr als der Kapitän:
Die beiden Reptiloiden hatten ihm ihre Dims für physiologische und metabolische Tests zur Verfügung gestellt. Dimforschung gehörte zu seinen Freizeitbeschäftigungen, die zweifellos exotischer waren als Abhijats oder Kurodas Brevenhobbies. »Auf einer bewohnten Welt«, erklärte er Valentina einmal nachdenklich, »egal, wie sehr sich die Custaikultur und unsere auf einigen davon vermischt haben, wären solche biologischen Dimstudien nicht möglich. Erstens aus kulturellen Gründen, zweitens, weil es Gesetze dagegen gibt – man hat in den VL überall große Angst vor den Tätowierungen, es wird viel geraunt darüber, was es mit denen auf sich hat. Rhinovirenschutz, adaptive Immungeschichten, defensive Biomarcha – die Dinger geben angeblich Sporen ab. Die Tabus sind unsere, nicht die der Custai. Man möchte nicht so recht wissen, was diese, na ja, Andro- und Gynoiden, diese … seltsamen Helfer unserer Freunde wirklich mit uns Menschen zu tun haben, denen sie so verteufelt ähnlich sehen. Ich werde diese Unwissenheit beseitigen, gegen die unvermeidlichen Anfangswiderstände. So geht es allen Aufklärern.«
Dr. Zhou gab sich keine Mühe zu verbergen, dass er überhaupt nur für die Präsidentin reiste, weil ihm das seine Studien ermöglichte. Die entsprechende Monografie war bereits weit gediehen: »Ich arbeite von unten nach oben – also erst mal Anatomie, Physiologie, Stoffwechsel, Neuroapparat und so weiter. Dann Verhalten, soziale und psychologische Eigenschaften, Kultur – lach nicht, die haben so was. Eigene Geschichten. Legenden.«
Valentina schnaubte: »Klar, und was für dumme. Die kapieren nicht mal die Relativität und die Koniken, sonst hätten sie ja nicht dieses Märchen vom großen Zeichen für den Weltuntergang. Die Dunkelheit von … wie heißt es?«
»Die Pulsarnacht.«
»Richtig. Was war da genau der … wie ging der Unsinn?«
»Die Pulse aller bekannten Neutronensterne werden aussetzen. Und man wird das an jedem Punkt des Kosmos gleichzeitig beobachten.«
»Was, da sie in unterschiedlich weit voneinander entfernten Koniken zu finden sind, bedeuten würde, dass diese Aussetzer zu ganz verschiedenen Zeiten …«
»Man darf«, unterbrach Dr. Zhou, »solche Sachen nicht wörtlich nehmen. Es ist wie mit den Regengöttern, von denen Custai und Binturen reden. Ich meine einfach, Spuren einer Art … Religion … bei den Dims entdeckt zu haben. Es geht darin vor allem um eine eigene Kosmogonie und Evolutionslehre. Um Mutmaßungen darüber, woher sie kommen.«
»Wie, woher sie kommen?«, schnauzte Sylvia, die das Gespräch bis dahin stumm verfolgt hatte. »Ist doch einfach: Die Eidechsen haben sie gezüchtet.«
»Aber warum sehen sie dann aus wie wir?«, fragte der Arzt mit leicht spöttischem Gesichtsausdruck.
Sylvia machte ein obszönes Lippengeräusch und spuckte: »Was, die sehen aus wie wir, Quatsch. Die sehen nicht aus wie wir. Die sind viel größer. Anderthalbmal so groß wie ein Mensch, und irgendwie quallig, ich meine, diese Gesichter, da lässt sich gar nichts draus … lesen und … nee, die sehen nicht aus wie wir. Vielleicht wie undeutliche Karikaturen.«
»Sie sind eine humanoide Lebensform«, insistierte Bin Zhou ruhig, »die menschenähnlichste jedenfalls, die ich je gesehen habe.«
»Auf der Akademie«, versuchte Valentina zu vermitteln, »hieß es, die wären von den Custai designt worden, um uns ein bisschen zu beleidigen. Am Anfang gab’s ja Reibereien, in den drei Metazyklen nach dem ersten Kontakt zwischen den Menschen – ich glaube, Asvanylinie, richtig, ja – und den Custai.«
»Aber das genau ist es doch«, erwiderte Zhou, dessen Stimme jetzt einen verschwörerischen Tonfall annahm, »das ist der springende Punkt. Ich habe für den historischen Teil meiner Studien einige Berichte und Dokumentationen aus dieser frühen Zeit studiert, und alles deutet darauf hin, dass die Custai schon bei der ersten Begegnung Dims mit sich führten. Versteht ihr? Diese Biomarcha in Menschengestalt, die unseren inzwischen … treuen … Verbündeten ihrerseits treu ist bis zum Tod, hat schon immer ausgesehen wie … ungenaue, zu große Kopien von Menschen. Hier liegt ein Rätsel, das ich zu lösen beabsichtige.«
»Viel Spaß dabei«, grummelte Sylvia und sammelte die Spielsteine vom Go-Brett, an dem sie sich eben gegen Zhou hatte geschlagen geben müssen.
»Erstmal gibt’s Revanche.«
Emanuelle Dinah Norenzayan war die Waffenmeisterin, kahlköpfig wie Valentina, mit hohen Wangenknochen und kohlschwarzen, großen Augen.
»Die Frau würde mir Angst machen, wenn ich wüsste, was Angst ist«, aus Sylvias Mund das größtmögliche Kompliment
Nur der Kapitän, Sylvia, Abhijat und der Bintur durften sich längere Zeit in ihrer Nähe aufhalten. »Mit Kuroda ist sie regelrecht verheiratet«, schwärmte Saskia, die wohl ihrerseits gern entweder Norenzayan oder Kuroda geheiratet hätte.
Was dem Arzt seine Monografie über Dims, der zweiten Navigatorin ihr Lehrbuch, Abhijat seine Skulpturen und Sylvia ihr Gemecker waren, stellten für Norenzayan Arbeiten an der Schiffsaußenhülle dar.
Ständig gab es, geschützt nur vom C-Feld-Hautgitter, irgendetwas auszubessern, Folgen von Mikrometeoritenschäden zu beobachten oder zu beseitigen und Flanken neu zu beschichten. Kroch Norenzayan gerade nicht auf dem Schiff herum, dann widmete sie sich rastlosen Tätigkeiten im Fahrzeugpark – dies oft zusammen mit dem Bintur, wobei etwa Kleingleiter in Amphibienfahrzeuge umgerüstet und anschließend wieder zu atmosphärenflugtauglichen Jets modifiziert wurden. Norenzayan schuf Tanks aus Progma, setzte sie auf Tragflächen oder probierte in der Makrofertigung neues, eigenes Design für ein geschütztes 8X8-Radfahrzeug aus, bastelte drei Monate an der zentralen Reifendruckregelung entsprechend dem erwarteten Zugkraftbedarf, ließ einen neuen Gefechtsturm dran schweißen, spickte das Spielzeug mit Scharfschützengewehren – und nahm schließlich alles wieder auseinander.
Hatte sie zu Schwerstarbeit einmal keine Lust, schliff sie altmodische Messer und Äxte.
»Sie sieht aus, als ob sie Leuten beim Sport den Kopf abreißen könnte. Aber ich glaube, sie ist ganz lieb«, fand Sylvia, deren Perspektive allerdings davon getrübt war, dass Norenzayan ihre Küsse schmeckten.
N’’//K’H/’G’ hieß der Bintur an Bord. Sein Name bestand aus in seiner Sprache geläufigen, für Menschenmünder eben noch artikulierbaren Konsonanten sowie einigen unaussprechlichen Paravokalen – »Pfeifhusten« nannte Sylvia dieses durch melodische Modulation bedeutungstragende Element der Binturensprache. Die Menschen nannten ihn, wenn sie im Imitieren jener Laute nicht so gut waren wie Bin Zhou, einfach »Naka«.
Naka besaß keinen bestimmten, nur ihm zugewiesenen Aufgabenbereich. Dank seinen binturenüblichen polymarchiden und polyhistorischen Begabungen konnte er einfach helfen, wo er gebraucht wurde. Wie alle Individuen seiner Art schätzte man ihn im Gegensatz zu den in kühlen Zylindern schwebenden Skypho und den massigen Custai als angenehmen Gesellschafter. Saskia sagte es deutlich: »Der Naka ist ziemlich heiß, mit seinen Pinselöhrchen und diesem Schweif, der greifen kann und streicheln.«
»Behalt’s für dich«, sagte Tommi säuerlich, weil ihm nicht klar war, was alle andern wussten, nämlich dass Saskia von ihren sehr vereinzelten Begegnungen mit dem Bintur mehr Aufhebens machte, als die verdienten. In Wirklichkeit war N’’//K’H/’G’ Menschenkörpern nicht sonderlich zugetan, wenn er auch Sylvia so wenig verschmähte wie irgendwer sonst. Nur zu Emanuelle Norenzayan pflegte er ein etwas innigeres Verhältnis, als bloße Kollegialität gerechtfertigt hätte.
»Die Binturen sind uns erotisch überlegen«, erklärte Dr. Zhou Valentina einmal. »Unsere erst etwa sechs Metazyklen alte Sitte der mehrerlei Geschlechter – bei uns sind es, wenn ich das richtig überblicke, derzeit etwa vier bis fünf, bei ihnen acht – samt Wechsel dazwischen haben wir seinerzeit von ihnen übernommen, inklusive der Brechung des Rollenkontexts, der Abschaffung der Definition des eigenen Geschlechts über Vorlieben für andere oder ähnliche. Schön, bei den Custai weiß andererseits überhaupt niemand, wie viele Geschlechter die haben, zumal es weit mehr als zwei Individuen braucht, damit sie sich fortpflanzen können. Aber die Custai sind prüde. Die Binturen dagegen leben liberaler, als wir in absehbarer Zukunft wagen werden, und das schüchtert natürlich ein.«
Valentina erinnerte sich, dass sie in ihrem ersten Zyklus auf der Akademie einmal einige Monate lang versucht hatte, ein Junge zu sein. Sie rechtfertigte das eher langweilige Experiment, das ihr nicht viel gab, vor sich selbst später damit, sie hätte das Gefühl gehabt, ihren Eltern, die über ihr Verlassen der Heimatwelt und den Eintritt ins präsidiale Militär nicht eben glücklich gewesen waren – »du verschenkst alle Möglichkeiten, die oder der zu sein, die oder der du willst, Kind«, hatte die Mutter geseufzt –, eine Art Dankesschuld abtragen zu müssen. So hatte sie denn versucht, wenigstens eine dieser »Möglichkeiten« wahrzunehmen. Anderthalb Zyklen vor Valentinas Geburt war Valentinas Mutter ja selbst noch ein Mann gewesen. Der Name, den man Valentina gegeben hatte, suggerierte wohl, dass man ihn leicht gegen einen eng verwandten männlichen würde eintauschen können, »Valentin«, wie die Rekrutin als junger Rekrut denn auch ein Weilchen geheißen hatte – »bis es mir einfach zu blöd wurde. Ich kann damit nichts anfangen, tut mir leid. Vielleicht ist mein Horizont zu eng, aber meine Eltern wollen hoffentlich vor allem, dass ich zufrieden bin. Und als Typ wäre ich das nie«, gestand sie Sylvia.
Der Bintur mochte den Arzt; sie schlossen Freundschaft.
Die beiden führten lange und offenbar für beide bereichernde Unterhaltungen über binturische Kosmologie und Theologie. Besonders interessierte sich der Mediziner für Erzählungen und Spekulationen, die mit den großen Driften in den drei nächstgelegenen Galaxien in Epochen zu tun hatten, als Binturen und Custai noch jung, die Menschen nicht einmal vorhanden waren. Vieles davon betraf hypothetische ältere Arten, die einige der größten und rätselhaftesten Ingenieursleistungen in ebendiesen Galaxien hinterlassen hatten.
Dass etwa weder Custai noch Binturen noch die zweifellos älteste sternenfahrende Spezies, die Skypho, als Erbauer der Ahtotüren und erste Vermesser des Ahtomediums gelten konnten, war Konsens unter diesen dreien, den die Menschen nur übernehmen konnten. Dass das Wissen über Existenz und Beschaffenheit des C-Felds zwar von den Skypho weitergegeben, von ihnen aber nicht entdeckt worden war, sagten Letztere selbst.
»Wir verdanken all dies den Meergöttern und dem, was man aus ihrem Erbe lesen kann«, erklärten die Zylinderwesen, »vor allem aber dem, was die Medeen uns erzählt haben.«
Die Medeen gehörten nicht nur zu den zahlreichen Arten großer Nichtatmer, wie man sie in einigen Sternumwelten und auch in den interstellaren Dunkelheiten fand, sondern waren nach übereinstimmender Ansicht verschiedenster Zivilisationen Boten höherer Mächte. In den VL hielt man diese Ansicht für eine bewusst von den Skypho ausgestreute Mystifikation. Die Geschöpfe in den schwebenden Zylindern standen im Verdacht, die wahren Quellen ihrer Wissenschaften und ihrer Marcha nicht preisgeben zu wollen.
Armand Mazurier war überzeugt davon: »Sie halten uns, die Binturen, die Custai und alles, was sonst noch in groben Körpern herumläuft, für so blöde, dass wir uns mit jedem Mist abspeisen lassen. Fabeln, Mythen, Religion. Und sie scheinen recht zu haben.«
Dr. Bin Zhou erfuhr von N’’//K’H/’G’ eine interessante Einzelheit zu diesem Themenkomplex: »Die ›Meergötter‹ oder ›Meerhände‹ der Skypho kommen auch bei manchen Kulten der Binturen vor, und sogar bei den Custai. Da heißen sie ›Regengötter‹, bei uns Binturen ursprünglich ›die Tiefen‹, seit einigen Dekazyklen haben wir allerdings in vielen Regionen die Rede von den ›Regengöttern‹ übernommen. Es mischt sich. In allen diesen Mythologien gibt es allerdings mehr oder weniger undeutliche Verbindungen zu den Medeen und anderen Extremophilen.«
In langen nächtlichen Sitzungen bei Nachos und Insekten verglichen der Arzt und der Bintur so ihre Kenntnisse in Astroarchäologie sowie Astrobiologie und unterhielten sich darüber, welche der sternfahrenden Spezies wohl genau woher gekommen waren.
An einem dieser Abende hatte Naka beim Nachdenken übers Spurenlesen eine Idee.
3
»Die Idee«, schnurrte der Bintur auf der vollbesetzten Brücke, umgeben von sechs sehr neugierigen und drei bereits unterrichteten Menschen, »ist ein simpler Analogieschluss. Der Doktor und ich, wir plaudern, wie ihr wisst, gern über ganz alte Zeiten. Und da tauchte einmal die Frage auf: Wie haben die das eigentlich gemacht damals, mit ihren primitiven optischen Teleskopen, wie haben die Planeten gefunden, weit draußen, die bewohnbar waren, die sich für die Besiedlung eigneten, weil sie an Shenik, Tliluamen oder …« Er hatte Schwierigkeiten, auf den Namen zu kommen, Sylvia half aus: »Terra Firma. So hieß der Felsen, wo die Menschen hergekommen sind.«
»Gut«, sagte Naka; die Menschensprache zu gebrauchen fiel ihm etwa so leicht wie einem einigermaßen gescheiten erwachsenen Menschen, das Lallen menschlicher Babys nachzuahmen, sehr leicht also. »Welten, die an diese Heimatplaneten erinnerten, die ihnen hinreichend ähnlich waren, wie haben sie die gefunden? Ich wusste es im Fall von uns Binturen, und mein Freund hier, der wusste es im Falle der Menschen. Das war gar nicht so verschieden, am Anfang: Man suchte mühsam den Sternenhimmel ab, wir hatten zwar die Raumfahrt erst … also, anders als die Menschen, die zweimal Raumfahrtzeitalter anfingen und wieder aufgeben mussten, hatten wir die Raumfahrt nicht eher, als bis wir wussten, dass es die Ahtotüren gab. Aber unsere nächstgelegene Ahtotür war sogar noch weiter weg als bei euch – eure, na, ein paar Lichtjahre waren es, oder?«
»Etwa acht Parsec von unserer Sonne aus«, sagte Kuroda, »nahe Alpha Lyrae.«
»Aha, genau da«, nickte der Bintur, »wo euer, wie hieß das? Wo eure Linienkriege entschieden wurden. Bei uns sind es sogar zwölf Parsec gewesen. Da musste man erst mal hinkommen.«
Er schüttelte den Kopf so heftig, dass es aussah, als wolle er ihn drehen. Dann fuhr er fort: »Gut, jedenfalls, wie haben sie es gemacht? Simpel: Wenn so ein Planet vor seinem Stern im Durchgang durchs Sichtfeld ist, kann man ihn mitbekommen, und mehr – man kann seinen Radius bestimmen, anhand der Abnahme des Sternenlichts in der Richtung, in die man die Teleskope ausgerichtet hat, die es damals gab, und seine Orbitaldauer weiß man aufgrund der Zeit, die zwischen den Durchgängen vergeht. Wenn der betreffende Stern gleich mehrere Planeten aufweist, kann man vieles durch einfaches Hingucken herauskriegen – wechselseitige gravitationale Interaktionen zum Beispiel verraten Planetenmassen und Formen der Umlaufbahnen, die Planarität des jeweiligen Systems lässt sich auch ermitteln –, man schaut sich Lichtkurven an, periodische Dips, Photometrie, ermittelt Masse-Radius-Beziehungen. Als wir so weit waren, fiel ihm«, der hübsche schmale Kopf mit den Pinselohren nickte in Richtung Bin Zhou, »ein, was der Comte«, das nächste Nicken wies auf diesen, der versuchte, eingeweiht auszusehen, »uns neulich über seinen Informationsstand erzählt hat: Das … Objekt, auf dem wir, das heißt, der Staatsschutz der VL, das Gesicht von Admiralin Schemura vermuten, ist neuesten Berichten von …«
»Spitzeln«, sagte Sylvia in einem Ton, als habe sie das Wort gehustet statt gesprochen.
Der Bintur nickte: »Also, die Informanten sagen, es soll sich um einen mit Marcha aller Art gründlich aufgerüsteten Asteroiden handeln. Vielleicht sogar einen kleinen Planeten. Jedenfalls nicht um ein Raumschiff oder ein Lebewesen.«
Sylvias Mund verzog sich zu einem bösen kleinen Lächeln, Valentina dachte: Das hätte ihr gefallen, eine Medea zu entern. Die großen Geschöpfe wurden in letzter Zeit häufiger kolonisiert, man wollte mehr Habitate wie Treue und Schere und Mut, die drei ersten bewohnten Medeen. Vor zwei Dekazyklen war diese Mode aufgekommen, nahe der kamäischen Sternwiege und bei S Monocerotis.
Medeen und deren künstliche, angeblich nach genetischen Plänen der Meerhände geschaffene Varianten sollten nach dem Willen gewisser Politiker im Kolonisationsamt auf Yasaka die Amtssitze der Zukunft für Castanons Regierung sein.
»Ein Asteroid«, fuhr der Bintur fort, »so was findet man in Oortwolken, auf Umlaufbahnen, im Müll um Sternensysteme, im Leerraum …«
Kuroda sagte: »Sie hatten einen schönen Vergleich.« Er verbeugte sich andeutungsweise und sehr förmlich vor Mazurier, der sich effekthascherisch räusperte und erwiderte: »Es gibt ja dieses uralte Bild von der Nadel im Heuhaufen. Und ich habe gesagt, was ist, wenn man nicht mal genau weiß, welcher Heuhaufen es ist, sondern ungefähr sieben oder acht Heuhaufen vor sich hat und die Nadel kann nicht nur da drin sein, sondern … auch zwischen den Heuhaufen, weil sie unordentlich aufgeschüttet wurden, liegt immer mal der eine oder andere Strohhalm, in der Nähe der Haufen natürlich mehr als im Zwischenhaufenraum, wo sie dünner gesät sind, aber in einem dieser Strohfragmente steckt vermutlich die Nadel, die man sucht …«
»Nur dass wir die Magnetsignatur der Nadel finden können«, sagte der Arzt, »das heißt, natürlich nicht die magnetische, aber die Spur im C-Feld und im Ahtomedium, wenn das Objekt, was anzunehmen ist, eine Bahn hat, die intelligent programmiert wurde. Denn dann fand ein Start, ein Abschuss statt. Die seit der Verstreuung der Admiralin verstrichene Zeit reicht nicht, irgendein Artefakt aus den kartierten Gebieten in eine hinreichend entlegene Gegend zu bringen, ohne Ahtotüren zu benutzen, ohne das Ahtomedium zu durchqueren. Es müssen Bewegungen stattgefunden haben. Danach wird wahrscheinlich etwas Stabileres angestrebt, ein … wie soll ich sagen …«
»Parkplatz«, half Sylvia.
Der Doktor stimmte zu: »Richtig. Ein orbitaler Parkplatz. Eine sichere Bahn, kreisförmig, elliptisch, irgendwo … was N’’//K’H/’G’« – er sprach das nahezu fehlerfrei aus – »gemerkt hat, ist: Da haben Bewegungen stattgefunden, so wie im Gesichtsfelddurchgang vor Sternen sich Planeten bewegen. Und wenn wir jetzt in einer Progmafaktur ein paar Hunderttausend sTlalok-Sonden bauen …«
»Eher ein paar Millionen. Wahrscheinlich sogar im zweistelligen Millionenbereich«, berichtigte ihn Bucksbaum, der offenbar schon an der Sache herumgerechnet hatte.
»Wenn wir die«, nahm der Bintur den Faden wieder auf, »analog den Sehzellen oder Linsenkomponenten eines gigantischen optischen Teleskops synchronisiert auf die Konik richten, in der das Artefakt vermutet wird, und ihre Daten im zentralen sTlalok der STENELLA so verrechnen lassen, dass alles rausgefiltert wird, was schon kartiert ist …«
Der Polizist beendete den Gedanken: »… dann könnten wir schnell sein. Schneller als alle andern. Wie lange wird das dauern, bis der gesamte fragliche Raum …«
Tommi hatte die Rechnung fertig: »Der gesamte … na, das wäre fast ein Zyklus.«
Das dämpfte die Stimmung im Raum ein wenig. Dann jedoch sagte Sylvia: »Dass wir die volle Zeit brauchen, setzt voraus, dass wir kein bisschen Glück haben. Rückenwind. Schwein. Und so was mag ich nicht voraussetzen – klug und schön, wie wir sind.«
»Ich denke«, erklärte der Kapitän knapp, »wir müssen das weder diskutieren noch darüber abstimmen. Es ist richtig. Es wird gemacht.«
4
Die Umsetzung des Plans koordinierte der Polizist.
Niemand konnte später sagen, wie das gekommen war. Emanuelle Norenzayan, Valentina oder Abhijat wären, aus unterschiedlichsten Gründen, genauso geeignet gewesen. Aber es war der Comte, der sich zusammen mit dem Bintur zu Tommi ins Tastnetz hängte.
»Auf der Brücke sieht es jetzt aus, als ob eine Spinne mit zwei Fliegen kämpft«, spottete Sylvia.
Von dort aus ließ Mazurier die ersten unter seiner Aufsicht von der Waffenmeisterin und dem Marchandeur hergestellten sechshunderttausend sTlaloks Testläufe von Messungen durchführen, wie sie der Bintur vorgeschlagen hatte.
Die anderen Crewmitglieder wurden nicht weiter eingeweiht. Valentina bekam lediglich mit, wie Naka und der Comte über irgendein Geheimwissen des Letzteren unterschiedlicher Meinung waren. Sie trugen diese Auseinandersetzung im halb öffentlichen Raum der Messe, beim Abendessen, miteinander aus.
»Ich sage Ihnen«, erregte sich der Mensch, »ich kann Ihnen vorher eben nicht verraten, was Sie da finden werden. Es genügt – es muss Ihnen genügen –, dass ich es weiß. Streng geheim ist es zwar nicht, sonst würde ich unsere sTlaloks nicht darauf loslassen. Aber darin besteht eben der Test: Falls die sTlaloks wirklich das finden, wovon ich weiß, dass es da ist, werde ich überzeugt sein.«
»Schön«, sagte der Bintur mit schwach vergifteter Liebenswürdigkeit, »ich richte die Schläfer also nach diesem Stern aus. Vespertilio, oder Lisin, oder Qalbu l-’Aqrab, oder Antares.«
»Ihre Spezies kennt ihn als R’’’B’KK//R«, konzedierte der Polizist mit aufgesetzter Jovialität in scheußlichem Binturisch.
N’’//K’H/’G’ ignorierte die Geste. »Schön, da findet irgendein nicht in offiziellen Karten verzeichneter Verkehr von … Frachtgut, haben Sie gesagt …«
»Etwas in der Art.« Der Mensch wirkte jetzt gereizt.
»Und Sie sagen«, ließ der Bintur nicht locker, »wenn ich die Daten finde, von denen Sie erwarten, dass ich sie finden werde, aber nicht deuten kann, dann sind Sie zufrieden. Ich sage Ihnen: Ich mag das Spiel nicht. Es kommt mir vor, als ob mir jemand die Augen verbindet und die Ohren verklebt und mich dann in einen Raum schickt, wo ich gegen einen Hammer laufen soll. Wenn ich mit einer Beule zurückkomme, kriege ich ein Bonbon. So dürfen Erwachsene nicht miteinander umgehen.«
An diesem Punkt der Diskussion lag es für die drei übrigen Anwesenden – Sylvia, Abhijat und die derzeit etwas mürrische Waffenmeisterin – nahe, sich in den Streit auf einer der beiden Seiten einzumischen.
Dass der Marchandeur, der sich seit der Entscheidung für die neue Suchmethode ohnehin am liebsten aus allem heraushielt, stattdessen sein Tablett, halb voll, wie es auf einigen Tellern und in einem Schälchen noch war, zum Entsorgungsfach brachte und hinter irgendeine Wand davonschlich, wo es etwas neu zu verdrahten gab; dass die Waffenmeisterin noch mürrischer weiter aß und den Blick tief in ihr Nudelgewirr senkte; dass Valentina sich mit ihrem Nachtisch ins untere Achsengewächshaus des Schiffs verdrückte, war einigermaßen blamabel. Einem Menschen hätten sie wohl beigestanden.
Dass Mazurier im Unrecht war, ließ sich nicht übersehen.
Valentina, trüber Stimmung, hockte sich in einen lauschig tiefgrünen, vom künstlichen Tau feuchten Alkoven zwischen Palmblättern, verdrückte missmutig ihr Zitroneneis und sann darüber nach, was gerade passiert war.
Menschen sind feige Arschlöcher, dachte sie, was gibt’s sonst Neues?
Mit einem leisen Fluch warf sie Schale und Löffelchen auf den krumigen Boden, wo sie sich in dreißig Minuten selbst zersetzen und in den Nahrungskreislauf der STENELLA zurückfinden würden.
Durch diverse Kletterröhren, zwei Fahrstühle und über ein Laufband begab sie sich zum Quartier ihres direkten Vorgesetzten.
»Treten Sie ein, Bahareth«, sagte der Kapitän, dessen runde Tür frei war und der ihr den Rücken zugekehrt hatte. Wie macht er das, woher weiß er, dass ich es bin, ist seine twiSicht aktiv, und das dauernd?, fragte sich die Soldatin.
»Setzen Sie sich. Und nehmen Sie grünen Tee.« Das tat sie, dann sah sie ihm ein Weilchen dabei zu, wie er Sienatusche abwechselnd mit einer Rohrfeder und mit einem Chinapinsel aufs Papier tupfte, drüberzog, lang hinstrich, bis die Umrisse einer ländlichen Szene in den regnerischeren Teilen der Gioca-Präfektur des Kontinents Arock auf Lazarus entstanden waren, stimmiger und stimmungsvoller als auf allen Fotos, die sie kannte: Die bescheidene Hütte, der gekrümmte Flusslauf, die Reisplantagen, die Hügelkämme mit den windgebeugten Großpflanzen.
»Also«, sagte der Mann, dessen aristokratische Gesichtszüge und neueste Barttracht – sehr präzise gestutzt, an die Mode der Händlerdynastien in der frühen Wiegraebe-Linie erinnernd – ihn eher wie einen alten Feudalherrn aussehen ließen als wie einen Raumfahrer, »was haben Sie auf dem Herzen?«
»Muss ich was auf dem Herzen haben, wenn ich Sie besuche?«, fragte Valentina, eine Spur zu defensiv.
Der kerzengerade Dasitzende erwiderte: »Sie seufzen oft, wenn auch kaum hörbar. Und merken es nicht. Erleichtern Sie sich. Reden Sie mit mir. Auch dafür bin ich da.«
Valentina holte tief Luft und gab dann zu: »Die Stimmung ist schlecht. Kumaraswami kramt nur noch in den sTlalokkammern rum und redet mit der Waffenmeisterin kaum drei Worte, wenn sie zusammen eine neue Serie zusammenschmelzen lassen. Wie viele sind es eigentlich inzwischen?«
»Vier Millionen. Und es werden noch mehr werden, wenn Naka mit seiner Idee recht hat. Falls die Sonden die Tests bestehen, fängt die eigentliche Suche an. Die müssen wir breit streuen.«
»Das geht uns doch auch an die Ressourcen, oder?«
»Das lassen Sie meine Sorge sein«, sagte Kuroda, nicht unfreundlich, aber deutlich genug; darüber gab es weiter nichts zu reden.
»Gut, aber … ist Ihnen nicht aufgefallen, wie unruhig jetzt alle sind? Seit es vielleicht wirklich sein könnte, dass wir was finden? Sylvia zum Beispiel …« – an die dachte sie, außer an den Polizisten und sein Gehabe, in Wahrheit in erster Linie, wenn sie an die Stimmungsverschlechterung an Bord dachte: Ihre einzige echte Freundin, eigentlich längst ihre Liebste, war zwar immer noch voller Energie, aber in letzter Zeit ruppig, sowohl in sich gekehrter als sonst wie paradoxerweise zugleich aufbrausender, was Valentina dem Kapitän direkt allerdings nicht verraten wollte. Es kam ihr zu persönlich vor.
»Stuiving, meine ich, die hat sich ja nun schon immer gerne gestritten mit Zhou über die Trüben …«
»Die Dims«, berichtigte der Kapitän. Speziesistische Schimpfwörter duldete er auch dann nicht, wenn sie Wesen bezeichneten, die nicht für sich selber sorgen konnten.
Valentina setzte neu an. »Ja … also, die beiden haben sich immer schon über die Dims unterhalten und gezankt. Über seine Theorien. Aber in letzter Zeit ist das alles so … verbissen. Er fängt plötzlich an zu behaupten, ihm wären, das hab ich ihn wirklich sagen hören, die Dims lieber als manche Menschen und er freue sich nach diesen klaustrophobischen Zyklen hier im Schiff schon auf seine nächste stationäre Arbeit mit … ausrangierten Dims auf Hauxpartilla. Bei den Custai, denen er sich anbieten wird. Da bringt sie dann einen Spruch, der wirklich unter der Gürtellinie … also einen, den ich gar nicht wiederholen kann. Und das beim Wachdienst, den wir drei neulich zusammen hatten, auf der Brücke, mit Saskia und Tommi und dem Comte über uns im Geflecht … ich hab mich richtig geschämt. Wie in so einem Klischee-Environ aus dem Krieg, darüber, wie es auf den Schlachtschiffen gewesen sein soll, in den engen Reihen, als es noch keine Geflechte gab, und die Leute wie Vieh dicht an dicht zusammengepfercht …«